Kommentar
Die Welt braucht weniger Globalisierung und mehr Nationalstaat
Die ersten Nachkriegsjahrzehnte waren geprägt vom Keynesianismus, benannt nach dem britischen Ökonomen John Maynard Keynes. Das ging so: Der Nationalstaat orchestriert eine starke Sozialpartnerschaft mit dem Zweck, dass die Löhne im Gleichschritt mit der Produktivität real steigen. Sozialwerke sorgen zudem dafür, dass die Risiken der Spezialisierung auf Tätigkeiten, die morgen vielleicht schon nicht mehr gefragt sind, und der konjunkturellen Schwankungen abgefedert werden. Zweck der Übung: Die Nachfrage soll mit dem steigenden Angebot Schritt halten, die Vollbeschäftigung und der soziale Frieden sollen gewahrt werden. Das waren die «goldenen 30 Jahre» nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das lange Sündenregister der Globalisierung
Dann kam die Ölkrise. Sie gab den neoliberalen Globalisten die Chance, ihre Ideen durchzusetzen. Keynes hatte vor ihnen gewarnt.
Ihre Ideen gingen so: Die Nachfrage holen wir uns im Wettbewerb auf den globalen Märkten. Hohe Löhne und Sozialleistungen gefährden die Wettbewerbsfähigkeit. Freier Kapital- und Personenverkehr sorgen dafür, dass alle Produktionskräfte weltweit immer genau dann und dort eingesetzt werden, wo sie den höchsten Nutzen bieten. Wenn wir das konsequent durchziehen, steigt der Wohlstand für alle.
Diese Idee ist auf allen Ebenen – Wohlstand, Demokratie, sozialer Frieden – grandios gescheitert. Das lässt sich am überzeugendsten am Beispiel des Landes zeigen, das weltweit als eines der erfolgreichsten Sieger des globalen Standortwettbewerbs gilt: an der Schweiz.
Steuern runter, Mieten massiv rauf
Blenden wir zurück. Seit 1980, am Beginn der neoliberalen Wende hat sich die Schweiz für den globalen Standortwettbewerb fit gemacht: Die Gewinnsteuern sind seither von 33 auf 14,4 Prozent, die Vermögenssteuer von 8 auf weniger als 5 Promille und die Spitzensteuersätze (etwa in Zürich) von 29,7 auf 20,9 Prozent gesunken.
Seit 2014 dürfen Expats zudem die Kosten für den Umzug, die Wohnkosten in der Schweiz sowie die Gebühren für fremdsprachige Privatschulen von den Steuern abziehen. Neu angesiedelte Firmen erhalten substantielle Zuschüsse und Steuerrabatte.
In fast allen Kantonen ist zudem die Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen gestrichen worden. Und trotz massiv gesunkenen Steuersätzen leistet sich das Land weiterhin eine Infrastruktur und Sozialausgaben, die weit über dem Niveau in den Nachbarländern liegen. Ein Erfolg?
Massenwanderung ausgelöst
Nicht für alle. Mit ihren superattraktiven Steuern lockt die Schweiz Firmen und gut bezahlte Fachkräfte ins Land, die ihre Arbeit sonst anderswo gemacht hätten. Und weil diese Expats in der Schweiz leben und konsumieren, beanspruchen sie hier zusätzliche Arbeitskräfte. Die entsprechende Sprachregelung geht so: Die «Wirtschaft» braucht dringend Arbeitskräfte, und die Personenfreizügigkeit hindert uns daran, diesen Zustrom zu begrenzen. Alles höhere Gewalt. Dass der eigentliche Auslöser unsere selbstgemachte Steuerpolitik ist, vergessen wir lieber.
Denn rein finanzpolitisch geht die Rechnung auf: Die importierten Fachkräfte und die Steuerflüchtlinge treiben das durchschnittliche steuerbare Einkommen auf ein Niveau, das die tieferen Steuersätze mehr als kompensiert und die Staatskassen füllt. Der Haken dabei ist, dass diese Zuwanderung die Immobilienpreise auf ein Niveau getrieben hat, das für die reichen Einwanderer noch tragbar ist, das aber das Budget der einheimischen Normalverdiener zunehmend sprengt.
90 bis 150 Milliarden für die Bodenbesitzer
Das Ausmass der dadurch verursachten Umverteilung von den Mietern und den Käufern zu den Bodenbesitzern und ihren Financiers wird immer noch weit unterschätzt. Gut bekannt ist die von der SP-Nationalrätin Jacqueline Badran immer wieder ins Feld geführte Zahl von zehn Milliarden Franken. So viel müssten die Wohnungsmieter jährlich weniger ausgeben, wenn das geltende Mietrecht strikt angewandt würde.
Doch diese Betrachtungsweise klammert den wichtigsten Faktor aus: die hohen Bodenpreise, die in die Miete oder in den Kaufpreis eingerechnet werden dürfen. Berücksichtigt man erstens auch diesen Teil der Umverteilung und zweitens auch die Mieten auf Gewerbe-Immobilien (deren Kosten auf die Kunden abgewälzt werden), kommt man auf eine Grössenordnung von 80 bis 90 Milliarden – jährlich.
Die Professoren Felix Schläpfer und Michael Lobsiger haben sich die gleiche Frage gestellt. In ihrer Studie kommen sie sogar auf eine jährliche Einkommens- und Vermögensumschichtung von rund 150 Milliarden Franken. Der Unterschied kommt vor allem daher, dass die beiden den ganzen Wertzuwachs von Bauland mitberücksichtigt haben (55 Milliarden Franken) und nicht nur den durch Verkauf realisierten Wertzuwachs (20 Milliarden Franken). Wie auch immer: Ob 90 oder 150 Milliarden, die Summe sprengt alles, was wir an Umverteilung bisher gesehen haben, wie etwa die jährlich rund fünf Milliarden für die 13. AHV-Rente.
Die Lasten der hohen Bodenpreise sind extrem ungleich verteilt. Das Ausmass der Umverteilung illustriert ein stilisiertes, aber nicht untypisches Rechenbeispiel: Die vier Haushalte A, B, C und D haben zu Beginn je ein Einkommen von 10’000 Franken und sie zahlen je 2000 Franken Miete pro Monat. Alle haben somit ein Einkommen nach Miete von 8000 Franken. Nun erbt A ein Einfamilienhaus am Stadtrand und macht daraus ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen, von denen er eines bewohnt, und dafür die effektiven Kosten von 1500 Franken trägt.
Die anderen drei vermietet er für je 3000 Franken an B, C und D. Jetzt sieht die Einkommensverteilung nach Miete und Mietertrag wie folgt aus: B, C und D haben je 7000 Franken. A zahlt nur die 1500 Franken Wohnkosten und kassiert noch 4500 Franken netto aus Mieteinnahmen. Total: 13’000 Franken. Also rund doppelt so viel. Anders formuliert: Drei büssen 12,5 Prozent ihres Nettoeinkommens ein, einer steigert seines um fast 70 Prozent.
Die Schweiz wird gentrifiziert
Diese durch den Sieg im globalen Steuerwettbewerb ausgelöste massive Umverteilung wird nun durch den kantonalen und den kommunalen Steuerwettbewerb weiter vorangetrieben. Die Reichen ziehen dahin, wo die Steuern tief sind. Das zieht weitere Reiche an, was den betroffenen Gemeinden und Kantonen noch tiefere Steuersätze ermöglicht, die Mieten weiter nach oben treibt und die Normalverdiener zum Umzug zwingt. Die Schweiz wird gentrifiziert.
Das zeigt sich an der Statistik der Steuerkraft pro Person (gemessen an der direkten Bundessteuer). Während der gesamtschweizerische Schnitt bei 2994 Franken jährlich liegt, bringen es die Kantone Bern und Jura nur auf 1738 beziehungsweise 1250 Franken. In den Kantonen Zug und Schwyz hingegen ist die Steuerkraft beziehungsweise sind die steuerbaren Einkommen inzwischen mit 9432 beziehungsweise 7134 Franken bis zu gut sieben Mal so hoch.
Auch innerhalb der Kantone sind die Unterschiede riesig. So hat etwa Kilchberg ZH mit 15’105 Franken eine fast viermal so hohe Steuerkraft wie die Nachbargemeinde Adliswil ZH mit ihren 4327 Franken.

Demokratie verliert die Bodenhaftung
Auch die Demokratie leidet unter der Globalisierung. Erstens weil diese die wirtschaftliche – und damit auch die politische – Macht in den Händen von wenigen Multimilliardären und der Kapitalmärkte konzentriert. Sie entscheiden, wo Jobs geschaffen oder wohin sie ausgelagert werden. Sie senken oder erhöhen die Zinsen, die er Staat bezahlen muss.
Die Bürger haben der Macht der Gläubiger immer weniger entgegenzusetzen. Zudem greifen die Multimilliardäre auch direkt in die Politik ein. In der Schweiz wären da etwa Christoph Blocher von der SVP zu nennen oder der Finanzmogul Alfred Gantner von der «Allianz Kompass Europa».
Zudem: Ein politisches Engagement setzt ein Mindestmass an Sesshaftigkeit voraus. Doch damit hapert es immer mehr. Der berufliche Aufstieg setzt mehr als einst einen häufigen Stellenwechsel voraus. Und immer öfter werden die Normalverdiener von ihren Vermietern «ausgebürgert». Im Zuge von Renovationen und Totalsanierungen müssen sie ihren Wohnort verlassen.
Die reiche Oberschicht zieht dahin, wo die Steuerlast am niedrigsten ist. Im Schnitt ziehen heute fast 10 Prozent aller Schweizer jedes Jahr um. Bei den 20- bis 40-Jährigen (in der Altersklasse, in der politische Karrieren beginnen) liegt dieser Anteil sogar bei gut 20 Prozent. Das sind keine guten Voraussetzungen für ein politisches oder soziales Engagement.
Immer mehr Finanzvermögen vernebelt unsere Sicht
Weiter in der Aufzählung der schädlichen Auswirkungen der Globalisierung: Die zunehmend einseitige Einkommensverteilung führt dazu, dass die reiche Oberschicht immer mehr reine Finanzvermögen anhäuft. In der Schweiz belaufen sich die Vermögen der Privathaushalte aktuell auf 5920 Milliarden Franken. Das ist rund das Siebenfache des BIP. Sie sind im Schnitt der letzten fünf Jahre um rund 200 Milliarden jährlich gewachsen – rund zehn Mal so schnell wie das BIP.
Dies bedeutet erstens, dass immer grössere Teile des BIP für die Aufbewahrung und Verwaltung von Finanzvermögen verschwendet werden. Zweitens bedeutet es, dass die jungen Schweizer in eine Welt hineinwachsen, in der man mit reinen Finanzspekulationen viel mehr verdienen kann als mit produktiver Arbeit. Alfred Gantners Vermögen von 3,4 Milliarden Dollar entspricht dem Einkommen von mehr als 30’000 normalen Arbeitsjahren.
Befürworter der Globalisierung argumentieren oft, dass unser BIP pro Kopf wegen oder trotz der Einwanderung immer noch steigt. Sie unterschlagen, dass immer grössere Teile des BIP bloss dafür verwendet werden müssen, die zunehmende Komplexität einer globalen Marktwirtschaft zu bewältigen. Es braucht immer mehr Transporte, Werbung, eine grössere Finanzindustrie, mehr Vermögensverwalter, eine grosse Rückverteilungsbürokratie. Ökonomen reden von «Transaktionskosten und haben deren Anteil am BIP schon 1986 (am Anfang der Globalisierung) auf «über 50 Prozent». Das BIP mag steigen, aber der brauchbare Teil schrumpft schneller.
Die Wertschöpfungsketten schöpfen ab
Der Aussenhandel spielt sich heute nicht mehr im Stile von Wein aus Portugal gegen Textilien aus England zwischen Ländern ab, sondern entlang von globalen Wertabschöpfungsketten. Diese werden von Multis kontrolliert. Es geht darum, möglichst viel Arbeit dort anfallen zu lassen, wo die Löhne niedrig sind, und die Produkte dort zu vermarkten, wo die Kaufkraft hoch ist.
Beispiel On-Schuhe. Gearbeitet wird in Vietnam für zwei Franken pro Stunde, kassiert wird in Zürich, wo für die drei Gründer beim Börsengang je über eine halbe Milliarde angefallen ist. Das schafft Kaufkraft, welche die Grössenordnungen des Binnenmarktes sprengen.
Für die abgehängten Länder wird es unter dem Regime der globalen Wertschöpfungsketten zunehmend schwierig, sich – im Sinne des Keynesianismus – auf der Grundlage der eigenen Nachfrage zu entwickeln. Sie bleiben das Arbeitskräftereservoir der Weltwirtschaft. Entweder als billige Industriearbeiter zuhause oder als Dienstboten in den Siegerländern. Als dritte Chance bleibt die organisierte Auswanderung in deren Sozialstaat.
Transportkosten und Umweltschäden
Die neoliberale Wirtschaftsordnung mit ihren globalen Lieferketten bis hin zu den Retouren der Versandhäuser wie Zalando und den immer längeren Arbeitswegen ist mit hohen Transportkosten und entsprechenden Umweltschäden verbunden. Die Einwanderung in die Hotspots führt zudem zu punktuellen Überlastungen.
Beispiel: Die Schweiz braucht dringend mehr Strom. Eine 145 Meter hohe Staumauer im Wallis könnte 150’000 Haushalte versorgen. Doch die Planung stockt. Hält die Einwanderung an, müsste die Schweiz alle drei Jahre solche Staumauern bauen.
Die geldlose Wirtschaft verliert ihre Produktionskraft
Kommen wir zum Schluss noch zum wohl wichtigsten Nachteil der Globalisierung und insbesondere des freien Personenverkehrs: Wir verdanken unseren Wohlstand und das Überleben allen produktiven und reproduktiven (den Nachwuchs betreffenden) Tätigkeiten. Davon leisten wir weiterhin gut 50 Prozent unentgeltlich im Rahmen der Familie und der Nachbarschaft. Diese sind sozusagen die Produktionsstätten der Bedarfswirtschaft.
Ihre Leistungsfähigkeit hängt in hohem Masse von der Sesshaftigkeit ab. Jedes Mal, wenn wir den Wohnort wechseln oder auch nur lange Arbeitswege auf uns nehmen müssen, sinkt die Produktivität rasant. Dem stehen die Gewinne, die dank einem flexiblen Einsatz von Arbeitskräften erzielt werden können, gegenüber. Doch sie decken oft nicht einmal die zusätzlichen Wege – und Transportkosten. Der Mensch ist mehr als eine bezahlte Arbeitskraft.
Fazit: Krachend gescheitert
Das Experiment der «Global Governance» mit freiem Kapitalverkehr und Personenfreizügigkeit ist krachend gescheitert und muss dringend gestoppt werden. Es produziert immer mehr mächtige Multimilliardäre und vernichtet damit den Wohlstand der anderen. Es unterminiert die Demokratie und gefährdet den (sozialen) Frieden.
Man weiss das schon lange. Im Jahr 2000 formulierte der US-Ökonom Dani Rodrik sein «politisches Trilemma der Weltwirtschaft. Demnach sei es unmöglich, Globalisierung, Demokratie und nationale Souveränität gleichzeitig zu haben beziehungsweise anzustreben. Inzwischen hat das Beispiel der EU und ihr ohnmächtiges Parlament gezeigt, dass auch die Demokratie nicht mit der Globalisierung vereinbar ist. Ein Zuviel davon zerstört den Nationalstaat und die Demokratie. Und nebenbei auch noch den Wohlstand.
Die Lösung liegt auf der Hand und steht ganz oben auf der politischen Agenda: Wir müssen den Nationalstaat stärken und die Globalisierung zurückfahren, den freien Kapital- und den Personenverkehr einschränken. In allen westlichen Staaten sind die Parteien auf dem Vormarsch, die gegen die Globalisierung sind und für einen starken Nationalstaat, der seine Grenzen kontrolliert. Das Ziel sollte sein, die nationale Wirtschaft so zu organisieren, dass sich alle von ihrem Lohn einen der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechenden Lebensstandard leisten können, ohne dass der Staat mithelfen muss.
Die Voraussetzungen sind gut
Die Schweiz ist von diesem Ziel weniger weit entfernt als viele andere Staaten. Wir haben eine lange Tradition von Sozialpartnerschaft und genossenschaftlicher Verwaltung. Wir haben einen starken Binnenmarkt, auf den fast 90 Prozent aller bezahlten Arbeit entfällt. Und wir können diesen Weg ein gutes Stück weit alleine gehen. Wir haben es selbst in der Hand, die Mieten und die Immobilienpreise wieder auf ein binnenmarkttaugliches Niveau zu bringen.
Wir sind zwar vertraglich zur Personenfreizügigkeit verpflichtet, aber niemand zwingt uns zum Sieg im Steuerwettbewerb. Unser Einwanderungsüberschuss ist zu einem guten Teil hausgemacht. Die Fachkräfte fehlen uns vor allem deshalb, weil wir alles tun, um immer neue Firmen anzusiedeln. Auf mittlere Sicht können wir darauf hoffen, dass sich auch in der EU die Erkenntnis durchsetzt, dass Personenfreizügigkeit schadet, die Zentren überfüllt und die Randgebiete entvölkert.
Der Nationalstaat muss auch seine Grenzen kontrollieren können. Das kann auch zu Fremdenfeindlichkeit oder gar Rassismus führen. Deshalb warnt die vereinte Linke jetzt vor der Gefahr einer Wiederbelebung des historischen Nationalismus der 1930er Jahre. Die Warnungen sind berechtigt. Aber sie sollten uns nicht daran hindern, über das zu reden, was tatsächlich schon sehr schiefläuft. Wir brauchen eine offene Diskussion darüber, wie wir unsere Wirtschaft intelligenter organisieren können. Und da ist Keynes, der eher ein Linker als ein Nazi war, ein guter Ratgeber: Wirtschaftliche Entwicklung muss von unten kommen.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





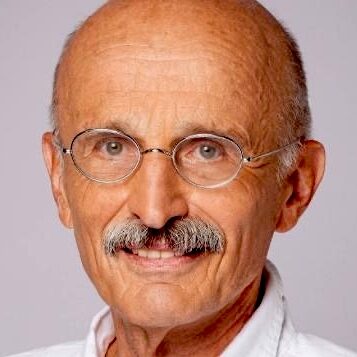









Ich bin mit ihrer Übersicht einverstanden bis auf den Satz «Als dritte Chance bleibt die organisierte Auswanderung in deren (= unseren) Sozialstaat.» Das impliziert, sie kämen wegen unserem Sozialstaat, so wie von der SVP seit Jahrzehnten behauptet, um von den Auswirkungen ihrer neoliberalen Politik abzulenken.
Die MigrantInnen kommen zu uns aus den gleichen Gründen, wie die SchweizerInnen im 19. Jahrhundert ausgewandert sind. Sie haben in ihren Herkunftsländern aus Gründen, die sie i.d.R. nicht beeinflussen können, keine Perspektiven mehr. Sie arbeiten (wenn man sie lässt!!), tragen hier zur AHV bei und unterstützen ihre Angehörigen im Heimatland mit inzwischen 7 Milliarden pro Jahr. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Zur Aussage im Artikel: «Die Globalisierung gefährdet die Demokratie. Eine Umkehr tut Not. Die Nationalstaaten müssen sich wieder auf sich selber besinnen.» Eine Antwort könnte sein: die globalen Grossbanken haben erkannt, dass die Globalisierung eine höchstprofitables Geschäft ist, wenn man die beherrscht, das mittlerweile wohl der Fall . Die Kohle bestimmt die Politik und die Polit-Kaste scheint das respektiert zu haben. Mit dem Resultat: Profit muss gemacht werden, damit die Gross-Finanz-Gambler Spielgeld zum verzocken haben. Die Staaten versinken in den Schulden und werden handlungsunfähig. Mit anderen Worten nicht die Globalisierung gefährdet die Demokratie, sondern die Politik, die sich den Grossfinanz-Zockern unterworfen haben könnte. Vereinfacht ausgedrückt, die Macht der Kohle muss gebrochen werden.
Gunther Kropp, Basel
Klar, die Macht der Kohle muss gebrochen werden.
Das kann sie aber nur durch Nationalstaaten. Nur dort ist die Bevölkerung noch einigermassen nahe am Geschehen dran, so dass sie, wenn sie es einmal merken würde, Einfluss nehmen könnte.
In globalen Organisationen sind die Stimmbürger weit, weit weg. Dafür sind die Lobbyisten ganz dicht am Ball.
@Daniel Heierli, Zürich
Handelsblatt 03.01.2025 – 05:17: «Berlin. Banken, Versicherungen und Fondsindustrie geben Millionenbeträge aus, um mit Hunderten Lobbyisten Einfluss auf Gesetze im Bundestag zu nehmen. Nach einer Auswertung der Bürgerbewegung Finanzwende ist keine andere Branche unter den 100 finanzstärksten Lobbyakteuren so stark vertreten wie die Finanzbranche. Das gehe aus dem öffentlich einsehbaren Lobbyregister des Bundestags hervor, erklärte der Verein.»
Zu Ihrer Aussage: «Klar, die Macht der Kohle muss gebrochen werden.
Das kann sie aber nur durch Nationalstaaten» Ist eine Antwort: Dann müssen wohl die Regierungen, Parlamente und deren Abgeordnete immun werden von den Verlockungen der Finanzlobby.
«Die Macht der Kohle brechen» – von dieser Illusion sollten wir uns endgültig frei machen. Es sei denn, die «Kohle» hätte die Form von großen Steinringen (wie irgendwo in der Südsee,früher). Hat sie aber nicht.Ganz im Gegenteil – Geld wird (leider!) immer mehr zu einer elektronisch gehandelte Digitalzahl.
Und schlußendlich wird Geld zu DER Waffe der Zukunft, im Großen wie im Kleinen. Einem TV- Bericht zufolge kämpft Putin tatsächlich mit Geld schon viel erfolgreicher als mit Panzern,Drohnen.Hat nicht schon Jesus im Tempel das Problem erkannt? Und der Erfolg? NULL! Nein, mit dem Gift dieser infamen Erfindung werden wir immer leben müssen – es sei denn, wir schaffen den «Neuen Menschen» – aber die diesbezüglichen Versuche sind ja schon alle gescheitert.
Wenn man die Analyse Vontobels zu Ende denkt, kommt man unweigerlich zur Gretchenfrage: wie halten wir es mit dem neuen bilateralen Paket? Gerne würde ich hoffen, dass die Schweiz aus der neoliberalen Sackgasse fände und Weichenstellungen zugunsten deutlich weniger Ungleichheiten einleiten würde. Dafür gibt es beim gegenwärtigen Personal noch bei den herrschenden Mehrheiten kaum Anlass. Und das Stimmvolk wird in die Illusion eingelullt, dass schliesslich jeder einmal reich oder Erbe sein könnte. Blöd nur, dass sich die Sache wie beim Lotto verhält: alle dürfen mitspielen, nur die allerwendigsten gewinnen. Und betrachtet man die Personal- und Ideologiesituation in Brüssel und Strassburg, bleibt noch weniger Hoffnung. Also wird man wohl Nein stimmen und die Personenfreizügigkeit als Schaden-Treiber «opfern» müssen. Das wäre dann auch der Lakmustest für die SVP, deren Auftraggeber bisher schamlos davon profitieren. Die Lösung findet sich beim Neudenken des Nationalstaates – ohne SVP.
Ein interessanter Artikel – aber beim Lesen habe ich ein zwiespältiges Gefühl bekommen. Warum ?Der Begriff «Globalisierung» ist zu pauschal benutzt – und verdammt worden. Denn Globalisierung bedeutet im positiven Sinn so etwas wie Integration,Zusammenfassung – nämlich der Belange der Weltgemeinschaft und DAS ist bitter nötig. Wenn man es auf eine Kurzformel bringen will, etwa SO :
Die Globalisierung von Masseströmungen(im physikalischen Sinn) ist vom Übel – egal ob Menschen oder Güter.Denn die Bewegung von Masse erfordert Energie und jeder vermeidbare Energieumsatz muß vermieden werden. Aber die Globalisierung von Ideen un Projekten ist genau das,was wir brauchen und was ja auch mit den modernen Kommunikationen schon geschieht. Beispiel: wenn in China zum Generalstreik gegen Rüstung aufgerufen werden würde, wäre das auch hier von Bedeutung.
Immer wenn ich ON-Schuhe an anderer Leute Füße sehe, denke ich an diesen und andere Artikel die die unfassbare Ausbeutung und Abzocke der globalisierten Wirtschaft beschreiben. Der Konsument hat es aber schon ein bißchen in der Hand: müssen es ON-Schuhe sein? Muss bei Zalanda, Amazon usw. bestellt werden? Braucht man ein neues Smartphone oder reicht ein einfaches altes Tastentelefon? Läuft nicht ein alter Laptop mit Linux genausogut wie ein neuer mit Windows 11? Muss man dreimal im Jahr zu weit entfernten Urlaubsdestinationen fliegen? Muss man jeden Konsumterror mitmachen und sich ständig den neuesten Trend in die Bude stellen – Dyson, Thermomix, Mähroboter, Dampfgarer, zweiter Kühlschrank, Kaffeevollautomaten? Sosehr wir auch von globalen Finanzgesellschaften geknebelt sind, können wir auch selber was tun, um die Situation etwas zu verbessern.
Es ist unmöglich, die Probleme, die durch eine gewisse Denkweise entstanden sind, mit der gleichen Denkweise zu lösen. Wir müssen weg kommen von diesem «welches ist das beste System» hin zu einem «Was sind die Bedürfnisse von Menschen und wie können wir die Befriedigung dieser vom Einzelnen aus gehend sicherstellen». Die Lösung ist in jedem Einzelnen von uns vorhanden.
Auch wenn ich mit der Argumentation von Werner Vontobel teilweise nicht übereinstimme, komme ich zum gleichen Schluss wie er: Die Welt braucht weniger Globalisierung und mehr Nationalstaat, denn die Demokratie leidet unter der Globalisierung. Die Personenfreizügigkeit schadet, der Nationalstaat muss auch seine Grenzen kontrollieren können.
Gleiches Ziel aus anderen Gründen: Das macht mich für die politische Zukunft der Schweiz optimistisch, denn die Schweiz ist von diesen Zielen weniger weit entfernt als viele andere Staaten.