«Wir haben erschreckende Hinweise» – woran Tierversuche kranken
Red. Im ersten Teil dieses Beitrags ging es um Forschende, die Ergebnisse früherer Tierversuche nicht reproduzieren konnten – bis heraus kam, dass das Geschlecht des Versuchsleiters eine entscheidende Rolle spielte. Der folgende zweite Teil nennt weitere Punkte, die zur schlechten Reproduzierbarkeit beitragen. Viele Tierversuche erfüllen deshalb ein wesentliches Kriterium der Wissenschaft nicht.
Seit über einem Jahrzehnt beklagen Wissenschaftler, dass viele Ergebnisse von Experimenten – insbesondere an Tieren – nicht reproduzierbar sind: Von über 100 Substanzen beispielsweise, die in Labor- und Tierexperimenten gegen die schwere Nervenkrankheit ALS zu helfen schienen, konnte ein auf diese Krankheit spezialisiertes Institut bei keiner Substanz den gleichen Effekt reproduzieren.
Nicht viel besser ist es in der Krebsforschung: In einem acht Jahre dauernden Projekt versuchten Forscher, massgebliche Experimente aus der Grundlagenforschung so exakt wie möglich zu wiederholen. Doch nicht einmal die Hälfte der Ergebnisse fielen bei der Wiederholung ungefähr so aus wie zuvor (Infosperber berichtete). Bei den Tierversuchen war dieses Problem besonders gross.
Bei Tierversuchen sei die Reproduzierbarkeit «erstaunlich schlecht», schrieb die Universität Bern 2020. Viele Tierversuche kranken an «ungeeigneten Versuchsplänen, unsorgfältiger Versuchsdurchführung, ungenügenden Statistikkenntnissen und ungerechtfertigten Schlussfolgerungen», fasste der Berner Professor Hanno Würbel die wichtigsten Mankos 2017 im «Laborjournal» zusammen. Würbel ist Leiter Tierschutz am Departement für Klinische Forschung und öffentliche Tiergesundheit an der Universität Bern.
Das Problem betrifft Millionen von Versuchstieren – jedes Jahr
Für die Forschung sind die nicht-reproduzierbaren Resultate ein grosses Problem. Denn nur wenn Experimente verlässlich immer wieder zum selben Resultat kommen, ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Erkenntnisse gültig sind.
Dieses Problem ist nicht bloss ein akademisches oder eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Nicht-Reproduzierbarkeit könne Patienten auch unnötigen Risiken aussetzen und den für die Versuche benützen Labortieren nicht zu rechtfertigende Schäden zufügen, kritisierte Würbel im Fachblatt «PLOS Biology». Schätzungsweise 50 bis 100 Millionen Tiere würden pro Jahr weltweit für Tierversuche benötigt.
Sogar die Einstreu im Käfig kann einen Unterschied machen
Wenn ein Labor die Befunde des anderen nicht replizieren könne, sei es nicht notwendigerweise so, dass eines recht habe und das andere falsch liege, schrieb der kanadische Schmerzforscher Jeffrey Mogil. Beide könnten akkurate Daten erhoben haben – die aber von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wurden. Mogil zählte im Fachblatt «labanimal» einige Beispiele auf:
- Stress kann bei Nagetieren bewirken, dass sie schmerzresistenter oder schmerzempfindlicher werden. Das wiederum beeinflusst das Versuchsergebnis.
- Werden die Mäuse in «artgerechteren» Käfigen gehalten mit mehr Spielzeug, empfinden sie weniger Schmerzen.
- Auch wie die Tiere als Jungtiere behandelt werden, beeinflusst ihr Leben lang ihre Schmerzempfindung. Die Schmerzwahrnehmung kann sich sogar bis in die nächste Generation auswirken: Bekommt die Rattenmutter beispielsweise kein Material für den Nestbau, dann sind ihre Nachkommen später schmerzempfindlicher.
- Der soziale Status innerhalb der Gruppe spielt eine Rolle: Ranghohe Nager reagieren auf Schmerzen anders als rangtiefe.
- Selbst der Sojagehalt im Futter oder die Einstreu kann den Ausgang eines Experiments beeinflussen: Mäuse, die auf Espenholzeinstreu lebten, reagierten in einer Studie schmerzempfindlicher als solche, deren Käfige mit Zellulose eingestreut waren.
- Tagesrhythmen, möglichst sterile Haltung, Umgebungslärm, Feuchtigkeit, Temperatur, kurzzeitiger Futtermangel oder ein ungewohnter Versuchsraum können das Schmerzempfinden der Tiere verändern – und wirken sich damit auf den Ausgang eines Experiments aus. «Eine Maus, die bei 24 Grad Celsius gehalten wird, könnte auf ein Medikament anders reagieren als eine, die bei 20 Grad gehalten wird», gab Würbel zu bedenken.
- Die Person, die mit den Tieren arbeite, habe unwissentlich vermutlich den grössten Einfluss auf die Schmerzwahrnehmung, mehr als zum Beispiel genetische Faktoren. Zu diesem Schluss kam Jeffrey Mogil nach Analyse von Experimenten mit über 8’000 Mäusen zur Schmerzempfindlichkeit. Einer der Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, ist das Geschlecht des Versuchsleiters.
«Die Experimentatoren ergreifen wichtige Massnahmen nicht«
«In der Wissenschaft arbeitet man mit vereinfachten Systemen, die der Wirklichkeit nicht vollständig gerecht werden. Deshalb muss man erwarten, dass viele Forschungsergebnisse nicht reproduziert werden können», gibt Hanno Würbel zu bedenken. Man könne nicht sagen, dass ein Ergebnis nutzlos sei, wenn es nicht reproduziert werden kann. «Nicht-reproduzierbare Ergebnisse deuten einfach darauf hin, dass wichtige Einflussfaktoren nicht berücksichtigt wurden. Es braucht dann weitere Forschung, um diese Faktoren zu erkennen.»
«Unentschuldbar» aber ist es aus Würbels Sicht, «wenn aus Ignoranz oder vorsätzlich Kriterien der guten Forschungspraxis ausser Acht gelassen werden. Wir haben erschreckende Hinweise darauf, dass in vielen Studien die Ergebnisse verzerrt sein könnten, weil die Experimentatoren wichtige Massnahmen dagegen nicht ergreifen.»
Wissenschaftler wie Würbel kritisieren mehrere Punkte:
- Forschende berichten eher über auffällige Ergebnisse. Von den «Nullresultaten» dagegen erfährt die Fachwelt allzu oft nichts. Würden alle Tierversuche vorab in einem Register erfasst, liesse sich feststellen, welche nachträglich geändert wurden oder wo Resultate in der Schublade verschwanden.
- Tierexperimente sind mehrheitlich nicht randomisiert. Das heisst, die Tiere für das Experiment werden nicht zufällig (also randomisiert) auf die Versuchs- und die Kontrollgruppe verteilt. Das kann die Versuchsergebnisse verzerren.
- In den allermeisten Fällen verzichten die Forschenden auch auf «Verblindung». Sie wissen also, welches Tier zum Beispiel einen Wirkstoff erhielt und welches Placebo. Dies kann bei der Datenerhebung ihre Einschätzung beeinflussen, «selbst wenn sie das nicht wollen», gibt Würbel zu bedenken.
- Ob Massnahmen zur Fehlerreduktion (Verblindung, Randomisierung) ergriffen wurden, berichten die Forschenden oft nicht. «Wenn im Fachartikel davon nichts erwähnt wird, kann man mit grosser Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es auch nicht gemacht wurde», sagt Würbel. «Studien, bei denen diese Kriterien nicht berichtet wurden, finden systematisch grössere Effekte als Studien, wo man randomisiert und / oder verblindet hat.»
- Bei weniger als zehn Prozent der Fachartikel wurde vor Beginn des Experiments seriös abgeschätzt, wie viele Labortiere dafür nötig sind. Erwartet ein Forscher einen grossen Unterschied zwischen Placebo und Wirkstoff, sind weniger Versuchstiere nötig, um diesen zu erkennen, als bei nur kleinem Unterschied. Die Folge dieser Unterlassung ist, dass die Anzahl der untersuchten Tiere oft zu klein bemessen ist, so dass gar keine statistisch nachweisbaren Unterschiede gefunden werden können.
- Hinzu kommt, dass die Versuchstiere – beispielsweise, ob es Weibchen oder Männchen waren – in den Fachartikeln häufig unzureichend beschrieben werden.
All das erschwert die Reproduzierbarkeit, mindert die Aussagekraft und bürdet den Versuchstieren unnötiges Leid auf.
Hoffnungen ruhen auf der nachrückenden Forschergeneration
Schon seit 2010 hält die «ARRIVE»-Richtlinie Forschende und Zeitschriftenherausgeber dazu an, die im Kasten erwähnten wichtigen Punkte in den Fachartikeln einzubeziehen. Es seien zwar Fortschritte erkennbar, doch mit der Umsetzung hapere es noch immer, stellten Würbel und ein internationales Autorenteam 2020 in «PLOS Biology» fest. «Solche Dinge ändern sich nie von heute auf morgen. Vieles davon wird sich verbessern, wenn die jüngere Forschergeneration nachrückt», hofft der Tierschutz-Professor. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von den Universitäten Zürich und Genf gründete Würbel deshalb 2020 das Swiss Reproducibility Network, ein Netzwerk von Forschenden, das die Reproduzierbarkeit von Experimenten verbessern will.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.








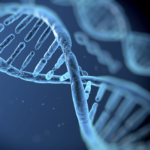


Eine entscheidende Erkenntnis lässt sich aus diesen missglückten Tierversuchen wohl schon gewinnen, nämlich, dass Medikamente die Gesundheit viel weniger beeinflussen als Veränderungen des Lebensstils. Je artgerechter, desto besser. Der Alzheimerforscher Michael Nehls etwa hat Mäuse allein dadurch vor Alzheimer bewahrt, dass er ihnen ein Laufrad in den Käfig gestellt hat. Schon eine kleine Änderung des Lebensstils in Richtung artgerecht kann viel bewirken.
https://www.youtube.com/watch?v=Zw5YRzTDYQk. ab Minute 6:20
(siehe hier Minute 6:20)
Fragt sich dann, wozu die «peer review» gut sein soll, wenn solch grundsätzliche Mängel offenbar seit langem bestehen. Hackt da eine Krähe der andern kein Auge aus, oder wird Kritik einfach ignoriert? Und warum schimpfen sich die Fachjournale «renommiert», wenn solche Misstände nicht bemerkt oder nicht korrigiert werden. Als Ingenieur, der sich selbst als «wissenschaftsgläubig» bezeichnen würde, tut mir das weh bis ins Mark. Mir ist während der «Pandemie» schon sehr bewusst geworden, wie sehr die Wissenschaft hier nicht als Methode versagt, sondern offenbar absichtlich, von wem auch immer, gegen die Wand gefahren wird. Dann können wir anschliessend wieder auf Voodoo vertrauen? Oder zurück in den Schoss der «Mutter Kirche»? Gute Nacht, Aufklärung!
Womöglich krankt die Wissenschaft am gleichen wie die Religionen. Dogmatismus, Machtstreben, Arroganz, Ueberheblichkeit, Absolutismus und dem großen Geschäft mit der Angst. Ich begleite gerade einen krebskranken Freund. Das Einholen verschiedener medizinischer Meinungen nach gründlichen Untersuchungen wie Analysen, Kontrast-Ct, Biopsie, Blutwerte, Messung der tumorspezifischen Antikörper, brachte nach vier verschiedenen onkologischen Beurteilungen (Wo der Patient z.T. eingeschüchtert wurde) und vier verschiedenen Behandlungsangeboten den vollen Horror zu Tage. Alle Angebote richteten sich nicht nach der beweisbaren erfolgträchtigsten Methode aus, waren radikal und sehr Einkommensträchtig für die jeweiligen Spitäler und in keinem Falle entsprachen sie einer ganzheitlichen Medizin. Erst der Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe geheilter Krebspatienten führte zu einer ganzheitlichen, schonenden Behandlung welche nun im Kontrast-Ct erste Erfolge zeigt. Ich denke, das sagt vieles.
Das Problem mit der fehlenden Reproduzierbarkeit betrifft die akademische Grundlagenforschung in sämlichen lifesciences. Dort sind im längjährigen Mittel höchstens 15 bis 18% der Experimente reproduzierbar. Das betrifft nicht nur die Tierversuche sondern auch die Zellbiologe. Fünf von sechs Publikationen in Fachzeitschriften sind Ramsch.
Diese Grundlagenforschung führt nur mittelbar zur Entwicklung von Medikamenten. Der Pharmaindustire liefert sie einzig Hinweise aus mögliche Angriffspunkte zur Behandlung von Krankheiten. Die Novartis betreiben in Basel mit Milliardenkosten Labors, wo sie solche Forschung systematisch zu reproduzieren versuchen. Nur wenn die Experimente reproduzierbar sind,werden anschliessend Wirkstoffe für Medikamente entwickelt.
Das ganze zeigt, in welch katastrophalem Zustand die akademische Forschung ist. Das ist die Folge davon, dass junge Wissenschaftler gezwungen werden ständig immer neue Ergebniss e zu publizieren ansonsten sie ihre Arbeit verlieren.