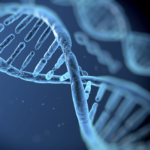Woran Tierversuche kranken: Die falschen «Tiermodelle»
Red. Im ersten Teil dieses Beitrags ging es um Forschende, die Ergebnisse früherer Tierversuche nicht reproduzieren konnten – bis heraus kam, dass das Geschlecht des Versuchsleiters eine entscheidende Rolle spielte. Der zweite Teil befasste sich mit der mangelnden Reproduzierbarkeit vieler Tierversuche, die deshalb ein wesentliches Kriterium der Wissenschaft nicht erfüllen. Schlechte Reproduzierbarkeit ist aber nur das eine, schlechte Übertragbarkeit auf den Menschen das andere. Darum geht es im Folgenden.
In der Alzheimer-Medikamentenforschung sind seit 2002 über 400 Studien an Menschen fehlgeschlagen. Die Versagerquote liege bei über 99 Prozent, berichtete die niederländische Wissenschaftlerin Desirée Veening-Griffioen im «European Journal of Pharmacology». Einer der Gründe für dieses schlechte Ergebnis: Die Resultate aus den Tierversuchen liessen sich nicht auf kranke Menschen übertragen.
Bei 20 (vermuteten) Wirkstoffen oder Behandlungen gegen Alzheimer, die es mindestens bis in die Studien-Phase II geschafft hatten, suchten Veening-Griffioen und ihre Kollegen nach den vorgängig durchgeführten Tierexperimenten, bei denen die geistige Leistung der Tiere gemessen wurden – ein Kriterium, das bei einer späteren Anwendung der Behandlung bei kranken Menschen sehr wichtig wäre.
Im Idealfall sind solche Tiermodelle ein exaktes Abbild der Krankheit beim Menschen. Doch das ist oft genug nur Wunschdenken. Die Wissenschaftlerinnen nahmen insgesamt 208 solcher Tierversuche an 63 verschiedenen «Tiermodellen» unter die Lupe, die überwiegende Mehrheit davon an Mäusen und Ratten, selten aber auch an Lemuren, Fruchtfliegen, Kaninchen und anderen Tierarten. 33 dieser Tiermodelle wurden nur ein einziges Mal verwendet.
Derselbe Gendefekt beispielsweise, der bei Menschen zu einer erblichen Form von Alzheimer führt, bewirkt bei Labormäusen nur «relativ milde geistige Einschränkungen», berichteten zwei Wissenschaftler 2010 in «Nature Neuroscience». «Um die Wirksamkeit eines neuen Medikaments gegen Alzheimer zu prüfen, sind die Tiermodelle, so wie sie gegenwärtig benützt werden, nicht nützlich für Vorhersagen», hielten Veening-Griffioen und ihre Kollegen 2019 fest.
Junge, männliche Ratten dienen als «Tiermodell» für meist weibliche, ältere Patientinnen
Der kanadische Schmerzforscher Jeffrey Mogil wies auf ähnliche Probleme in seinem Fachgebiet hin. Dort werden für Experimente überwiegend junge, männliche Ratten oder Mäuse benützt – an Schmerzen leiden aber insbesondere ältere Frauen.
Menschen haben vor allem Kreuz-, Gelenk- und Kopfschmerzen – doch in den Experimenten werden den Tieren vor allem Schmerzen durch Verletzungen, Hitze oder Substanzen zugefügt, die in die Pfote gespritzt werden und starke Entzündungen hervorrufen.
Welches Tiermodell gewählt wird, hänge in erster Linie davon ab, welches gerade verfügbar sei und mit welchem das betreffende Labor bereits Erfahrung habe. Die Frage, ob es das für diese Krankheit am besten geeignete ist, ist eigentlich die wichtigste – spielt in der Realität aber allzu oft nur eine untergeordnete Rolle. Das ergab eine Stichprobe von 125 Tiermodellen, die zwischen 2017 und 2019 bei Forschungsprojekten an zwei niederländischen Universitäten eingesetzt wurden. Erst an dritter Stelle stand dort die Ähnlichkeit von Symptomen bei Tier und Mensch. «Tradition, nicht Wissenschaft, ist die Grundlage für die Auswahl eines Tiermodells», folgerten Veening-Griffioen und ihre Kollegen, darunter der bekannte niederländische Pharmazeut Huub Schellekens.
Hinzu kommt: Maus ist nicht gleich Maus. Für die Tiermodelle werden verschiedene Mäuse- oder Rattenstämme eingesetzt. Die oft verwendete «Sprague Dewley»-Ratte etwa sei genetisch vielfältiger als Inzucht-Stämme. Um kleine Unterschiede zu erkennen, benötige man von den «Sprague Dewley»-Ratten deshalb mehr Tiere als von solchen, die genetisch sehr ähnlich sind, fand Schellekens. Mehr Versuchstiere bedeuten mehr Tierleid, mehr Aufwand, mehr Kosten, mehr Widerstand von Tierschützern – aber belastbarere Aussagen.
Schwimmtest bei Mäusen als Mass für Depression beim Menschen
Ein weiteres Problem sind die Versuchsanordnungen – und was die Forschenden daraus ableiten. Die Depressionsforschung zum Beispiel arbeitet unter anderem mit dem «forced swim test». Dabei wird die Maus in einen teilweise mit Wasser gefüllten Behälter getan, aus dem sie nicht entkommen kann und in dem sie schwimmen muss, wenn sie nicht untergehen will.
Sechs Minuten lang wird dann gemessen, wie lange das Tier zunächst erfolglos versucht, dem Wasser zu entkommen, und wie lange es aufgibt und sich bloss noch treiben lässt. Das Experiment soll «Verzweiflung» und «erlernte Hilflosigkeit» messen. Es dient beispielsweise dazu, die Wirkung von Antidepressiva an Mäusen zu erforschen.
Kritiker wenden jedoch ein, dass ein solcher Sechs-Minuten-Test nur wenig mit der Krankheit Depression zu tun habe, bei der genetische und Umweltfaktoren lang anhaltende Verhaltensänderungen bewirken. «Allzu oft wird danach argumentiert, dass eine bestimmte genetische Veränderung oder eine andere experimentelle Massnahme bei den Nagetieren einen Depressions- oder einen antidepressiven Effekt hervorgerufen hat», kritisierten zwei Wissenschaftler 2010 in «Nature Neuroscience».
Je nach Labor bis zu 100 Prozent Unterschied
Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Tierversuche soweit als möglich zu standardisieren und möglichst alle Faktoren auszuschalten, die «hineinfunken» könnten. Dazu gehört, die Labortiere unter streng kontrollierten, einheitlichen Bedingungen zu halten. Der Berner Professor Hanno Würbel schrieb vom «unseligen Anspruch, Versuchstiere wie Messinstrumente zu kalibrieren». Würbel ist Leiter Tierschutz am Departement für Klinische Forschung und öffentliche Tiergesundheit an der Universität Bern.
Doch selbst wenn verschiedene Labore sehr darauf achten, genetisch gleiche Labormäuse zu benützen und alles gleich zu machen – wie in einem Experiment unter Leitung Würbels geschehen – schwanken die Ergebnisse stark, ohne dass klar ist, woran es gelegen haben könnte. Das Kühlen des Gehirns nach einem Schlaganfall zum Beispiel reduzierte die geschädigte Hirnregion bei Mäusen in 50 verschiedenen Experimenten zwischen Null und 100 Prozent – je nach Labor, in dem das Experiment durchgeführt worden war.
Auch Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Schlaganfällen, die im Tierversuch nützlich waren, «haben sich allesamt als unwirksam herausgestellt», sagt Würbel und fügt an: «Wenn man Tierversuche richtig durchführen würde, könnte man sich einiges ersparen. Von den Forschenden würde ich mir wünschen, dass sie die Kriterien guter Forschungspraxis ernster nehmen und Umwelteinflüsse gezielt berücksichtigen.»
Absichtliche, kontrollierte Variation anstatt Vereinheitlichung
Anstatt alle möglichen Faktoren zu standardisieren, schlägt Würbel vor, die Umweltbedingungen für die Versuchstiere gezielt zu variieren oder ein und dasselbe Experiment in mindestens drei Laboren durchzuführen. Habe das Resultat unter diesen Bedingungen Bestand, steige die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich etwas dran sei.
«Laien stellen sich oft vor, dass es einen Versuch braucht und dann ist eine Forschungsfrage geklärt. Die Realität sieht aber anders aus. Ein einzelner Tierversuch liefert meist nur sehr wenig neue Erkenntnisse», sagt der Tierschutz-Professor. Die Fragen müssten aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, mehrfach untersucht und wiederholt werden. Nur in der Gesamtheit könne man danach gesicherte Aussagen treffen, so Würbel. «Dieser Tatsache müssen wir uns als Gesellschaft stellen und gemeinsam aushandeln, für welche Erkenntnisse sich Tierversuche rechtfertigen lassen.»
Andere Standards bei Affen als bei «niederen» Tieren wie Mäusen und Fischen
Jeden Tierversuch hier zu Lande muss eine Ethikkommission bewilligen. Anhand der Gesuche prüften der Berner Tierschutzprofessor Hanno Würbel und seine Kollegen für die Jahre 2008, 2010 und 2012 in über 1’000 Fällen, ob die Forschenden wissenschaftliche Qualitätsmerkmale beachtet hatten. Würbels Team fand «verbreitete Mängel». Wie wissenschaftlich aussagekräftig die geplanten Experimente waren, liess sich anhand der Tierversuchsgesuche nicht zuverlässig feststellen. Trotzdem hatten die Tierversuchskommissionen diese Experimente zur Bewilligung empfohlen.
Am ehesten wurde noch bei Affen und anderen als «höher» geltenden Tieren auf wissenschaftliche Standards geachtet, am wenigsten bei Nagern und Nicht-Säugetieren, schreibt Würbels Team in «PLOS Biology». Angesichts der dürftigen Ergebnisse kamen den Berner Wissenschaftlern «ernste Zweifel am gegenwärtigen Bewilligungsverfahren und am Peer-review Prozess für wissenschaftliche Publikationen» von Tierexperimenten. Als Folge dessen forderte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen die Vertreter der kantonalen Tierversuchskommissionen auf, künftig bei den Gesuchen besser hinzuschauen und änderte 2021 das Gesuchsformular für Tierversuche entsprechend.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.