Greta, die Seele der Station
Red.– Der Autor Rainer Jund ist Hals-Nasen-Ohren-Arzt in der Nähe von München und Buchautor. In seinem Buch «Tage in Weiss» *, dessen Titel an ein Gedicht von Ingeborg Bachmann erinnert, schildert er Situationen im Spital – ungeschönt. Alles ist fiktiv, aber es könnte sich genau so zugetragen haben. Infosperber veröffentlicht drei leicht gekürzte Kapitel aus dem Buch.
Die Sonne hatte an Kraft verloren, am frühen Nachmittag wärmte sie zwar immer noch die Oberarme der Frauen, auf denen sich warme Strandnachmittage abspielten. Doch am Morgen schmeckte es bereits nach Vergänglichkeit.
Ich ging in die Klinik, in der ungewöhnlich wenig los war, die Menschen zogen es vor, am Ende des Sommers draussen zu bleiben. Auf dem Stationsflur roch es nach Putzmitteln und Kaffee, quietschende Sandalen schleppten sich von links nach rechts und umgekehrt.
Ich zog mich um, fand in den Kitteltaschen Notizen über Patienten, die schon längst entlassen waren, und ging ins Arztzimmer. Alle sassen rum. Assistenten, Studenten, sogar die Stationsschwester war da.
Ich sah ihren Blicken sofort an, dass etwas nicht stimmte. Sie sahen schwer aus, mitgenommen, nicht traurig, aber kurz davor.
«Was ist denn los?», fragte ich in den Raum. Alle rutschten auf ihren Sitzen herum.
«Hast du’s noch nicht gehört?», posaunte die Stationsschwester mir entgegen. Ihr Atem roch nach Kaffee.
«Was denn?»
«Der Mann von Greta hat sich umgebracht. Ist mit hundertachtzig in seinem BMW gegen einen Brückenpfeiler gefahren.»
Alle heulten sich bei Greta aus
Greta war die Stationshilfe. Sie stand ganz unten in der Hierarchie. Ganz weit weg von den wichtigen Lebensläufen. Ein einfacher, liebenswürdiger Mensch, italienisch oder albanisch, das wusste keiner so genau, immer ein authentisches, lässiges Lächeln auf den Lippen, als ob sie die ganze Geschichte hier nur am Rande etwas angehen würde.
Aber an Greta gerieten alle. Alle heulten sich bei ihr aus. Sie war die Therapeutin der Ärzte. Sie war die Seele der Station.
Immer hatte sie einen Kaffee für uns, eine Süssigkeit, ein übrig gebliebenes Essen. An den Freitagen wusste sie ganz genau, ob der Fisch gut war oder ob man lieber die Mehlspeise nehmen sollte. Schon bevor das Essen kam. Sie war eine Synapse im Nervensystem der Klinik. Und sie schien zu fühlen, was man brauchte. Sogar Zigaretten bot sie den Kollegen an, wenn sie völlig erschöpft aus dem OP auf die Station hochkamen. Als Informationsquelle ersten Ranges wusste sie von Personalveränderungen früher Bescheid als die Betroffenen selbst.
Greta hatte schwarze Haare und dunkle Ringe unter den Augen. Dass ihr Leben nicht ohne Sorgen war, konnte man jeder Falte ihres Gesichts entnehmen. Weiche Kartoffeln auf einem regennassen Acker im Oktober.
Sätze aus dem Herzen
Sie war vor dreissig Jahren nach Deutschland gekommen und fing als Putzhilfe an. Wurde schliesslich Stationshilfe.
Manchmal sass man allein mit Greta im Stationszimmer und trank Kaffee, während sie rauchte und das Geschirr in die Spülmaschine räumte. Dann drehte sie sich von Zeit zu Zeit um und schnurrte mit tiefwarmer Frauenrauchstimme kurze, einfache Sätze zu einem hin.
«Daaa, bleiben S’ ein bisschen sitzen, manchmal muss man sitzen bleiben.»
Sätze voller Allgemeingültigkeit, ehrlich, aus dem Herzen, mild, ohne Schmerzen. Man konnte einfach dasitzen und zustimmen. Und dabei an nichts denken. Es geschehen lassen. Die leichte Bewegung der Luft im Gesicht spüren. Riechen, mit was sie angefüllt ist, die Müdigkeit ganz tief in sich stehen lassen und sich innerlich heimlich davonschleichen. Es war eine Meditation. Einfach und «Ach». Ist schon okay. Die Gleichgültigkeit des Südens. Nicht ärgern, einfach da sein. Ruhe rauchen und gewohntes Parfum, so wie immer.
Ach.
Jetzt hatte sich Gretas Mann also das Leben genommen. Ein kleiner, untersetzter Südländer, zwei Hemdknöpfe offen, Augen, aus denen süsser Espresso schwappte. Niemand von uns kannte ihn gut, manchmal holte er Greta auf der Station ab, und dann tranken die beiden einen Kaffee mit uns. Nicht selten versammelten sich alle Ärzte um den Tisch, an dem die beiden sassen.
Er war einfach aus dem Haus gegangen, hatte sich nicht verabschiedet und war weggefahren.
Bis Mitternacht hatte Greta gewartet. Um zwei Uhr war sie auf die Station gekommen und hatte sich mit der Nachschwester unterhalten. Gefragt, was sie tun soll. Noch mal zu Hause angerufen. Als sie nach der Schicht gegangen war, stand die Polizei bereits vor der Tür ihrer Wohnung.
Mit hundertachtzig stangengerade gegen einen Brückenpfeiler der Autobahn. Spielschulden.
Wir mieden sie
Sie erlitt einen Nervenzusammenbruch.
Ein halbes Jahr später kam sie auf die Station zurück. Als ich sie das erste Mal wiedersah, war sie nicht mehr Greta. Sie war ein anderer Mensch. Ihre Augenringe hatten sich wie Brandwunden tief in die Backenknochen eingearbeitet, an den Rändern der Stirn lief ihr das Haar weg, an den Mundwinkeln zog eine starke Strömung nach unten. Sie redete kaum. Keine einfachen Sätze mehr, keine Meditation, kein Ach.
Ich fühlte mich nicht mehr wohl in ihrer Nähe, verspürte eine Art Schuldbewusstsein, wenn ich bei ihr sass, wir alle mieden sie. In ihren Pausen sass sie immer häufiger allein an den weissen Tischen herum und faltete die Ecken der Tischdecken hin und her.
Sie roch anders.
Der Kaffee schmeckte anders.
Wir wollten nicht mehr bei ihr sein.
______________________
* Rainer Jund: «Tage in Weiss». Piper Verlag 2019, ca. 14 bis 29 Franken bzw. 12 Euro, je nach Buchhändler.
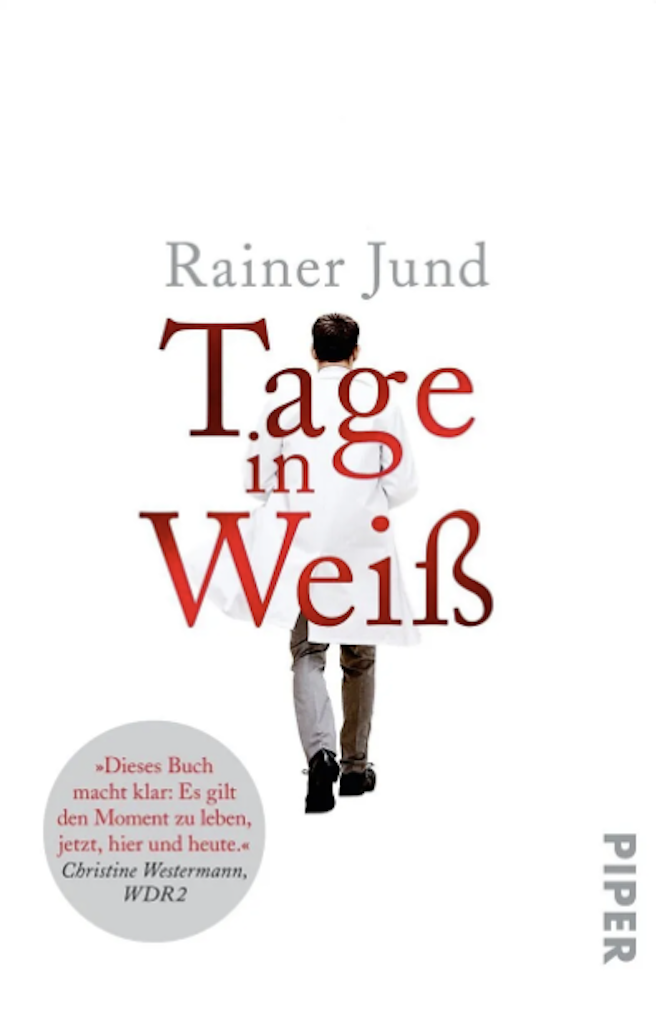
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.









