Die Frage «Warum» bimmelte wie der Alarm der Infusionsmaschinen
Red.– Der Autor Rainer Jund ist Hals-Nasen-Ohren-Arzt in der Nähe von München und Buchautor. In seinem Buch «Tage in Weiss»*, dessen Titel an ein Gedicht von Ingeborg Bachmann erinnert, schildert er Situationen im Spital – ungeschönt. Alles ist fiktiv, aber es könnte sich genau so zugetragen haben. Infosperber veröffentlicht drei leicht gekürzte Kapitel aus dem Buch.
Ich war in der Ausbildung. In einer neurochirurgischen Klinik. Ich war jung, interessiert, ein Rekrut im System.
In die Klinik hinein. Durch eine Tür, über der zwei teilnahmslose Engel aus Stein kauerten. Sofort begannen meine Sohlen, am glatt geschliffenen Steinboden zu kleben. Bademantelmenschen kamen mir wie Inselbewohner entgegen. Manche mit einer Zigarette im Mund, die nicht brannte.
Auf der Station zog ich mich schnell um, nicht ohne aus dem Augenwinkel schon gesehen zu haben, welche Schwestern heute da waren. Welche Frauen heute an meiner Seite stehen sollten.
Die Klinik war gross. Und kalt. Alles war da: Anästhesie, Neurochirurgie, Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, mehrere Abteilungen für Innere Medizin, Radiologie, Onkologie, Pathologie. Sie stand am Rand des Ballungsraumes. Jeden Tag kam der Notarzt. Mit dem Auto, mit dem Hubschrauber. Brachte Menschen, die einen ansahen, als ob man sie einfach ausgeschaltet hätte, kein Gefühl mehr in den Augen.
Das Dilemma der Neurochirurgen
Wenn Gefässe im Kopf platzen und Blut ins Gehirn schiesst, stirbt ein Drittel, ein Drittel überlebt schwerbehindert, ein Drittel der Menschen schafft es ohne Behinderung. Manche Zusammenhänge sind leicht in Zahlen zu fassen.
Tritt eine solche Blutung auf, entladen sich entsetzliche Kopfschmerzen. Vernichtungsschmerzen.
Viele von uns haben Aussackungen der Blutgefässe im Kopf, ohne es zu wissen. Sie können ganz plötzlich reissen. Oder sie halten ein ganzes Leben lang. Wir wissen es nicht so genau. Wird bei einer Magnetresonanztomografie (MRI) zufälligerweise eine solche Aussackung gefunden, die eine bestimmte Grösse überschritten hat, werden die Patienten operiert, weil das Risiko, dass das Aneurysma unkontrolliert einreisst, einfach zu gross wird.
Das Problem: Auch die OP ist riskant und birgt Probleme. Es kann sein, dass das Gefäss dabei platzt, dass Hirnanteile nicht mehr durchblutet werden. Dann entstehen Störungen, ähnlich wie bei einem Schlaganfall.
Neurochirurgen stehen ständig vor einem Dilemma. Sie entscheiden. Manchmal müssen sie das ganz allein tun, weil bei so einem Geröllhaufen von Eventualitäten kein Mensch weiss, was richtig ist. Weil das Sprechen über Risiken wie ein Schrapnell zwischen «nicht ausgeschlossen», «vorstellbar», «erdenklich», «wahrscheinlich» hin- und herkreischt. Eine solche Entscheidung, wie auch immer sie ausfällt, kann gravierende Konsequenzen haben für einen Menschen.
Flitterwochen in Florenz
Die Frau, die an diesem Morgen zu uns kam, hatte rotblonde Haare. Sie war dreissig Jahre alt, hatte ebenso viele rosa leuchtende Sommersprossen und gerade in Kunstgeschichte promoviert. Über eine Skulptur. Über eine einzige Skulptur, die zwei Liebende zeigt, die sich innig umarmen, hatte diese Frau eine Doktorarbeit geschrieben. Sie wollte an der Universität bleiben, lehren, die Faszination, die Gefühle weitergeben an andere Menschen. Menschen für die Kunst begeistern. Sie wollte auch: Kinder bekommen. Gerade hatte sie geheiratet.
In den Flitterwochen, die sie in Florenz mit ihrem Mann verbrachte, bekam sie beim Betrachten eines Bildes im Duomo Santa Maria del Fiore einen Krampfanfall. Zuerst spürte sie ein Zucken im Arm. Er bewegte sich unkontrolliert. Dieses Zucken breitete sich über die Schultern bis in den Brustkorb aus. Die anderen Besucher schauten sich erschrocken um.
Sie hatte unglaubliche Angst, erlebte alles bei vollem Bewusstsein. Als ihr Mann aus einer Seitenkapelle gerannt kam, lag seine Frau auf dem Boden, der Mund offen, die Augen weit aufgerissen, sie starrten an die Wand des Seitenschiffs.
Da war Dante Alighieri. Auf dem Bild hält Dante mit steinernem Gesicht in seiner linken Hand die Göttliche Komödie und weist, mit seiner Rechten, fast verächtlich auf die Hölle und das Paradies hinter ihm.
Das sah sie aber nicht mehr, durch ihr Gehirn schossen Blitze und Stürme, unkontrollierte Entladungen schlugen wie Wellen an die Mauern ihres Bewusstseins. Sie pinkelte auf den jahrhundertealten Boden. Ihr Mann verzweifelt, um Hilfe rufend. Der vierundachtzig Meter hohe Kuppelbau des Doms wirkte unnahbar.
Als sie im Krankenhaus von Careggi aufwachte, stand ihr Mann nicht am Bett. Sondern am Schreibtisch eines Arztes. Noch bevor dieser dem frisch verheirateten Ehemann die Diagnose erklärte, war dem eleganten Etrusker die Hilflosigkeit vor Ort klar. Er zeigte ihm die Computertomografie seiner Frau. Graue Abbildungen ihres Gehirns auf schwarzer Folie. Der Mann sah den weissen Fleck erst, als der Arzt darauf deutete und ihm mit schmalen Lippen erklärte, dass seine Frau einen Blutschwamm im Kleinhirn und einen weiteren im Grosshirn habe, der geplatzt sei. Dadurch sei Blut ausgetreten, das den Anfall ausgelöst habe. Mit Glück werde sie wieder ganz gesund. Auf die Frage, ob man gegen den Blutschwamm nicht etwas machen müsse, antwortete der Arzt, dass man dies in Deutschland besprechen werde.
Der Ehemann hatte gerötete Augen und spürte einen Druck im Magen, als er auf die Intensivstation ging. Sie würden seine Frau nach Deutschland zurückbringen. Zu uns, in die Neurochirurgie. Er begleitete sie.
Die Hochzeitsreise wurde dadurch nicht verkürzt, weil sie noch einige Tage in Florenz warten mussten, bis die Frau stabil genug war, um die Heimreise im Rettungsflugzeug antreten zu können. Alles ging anders aus, als die beiden sich das vorgestellt hatten. Ihr ganzes Leben, ihre Planung, ihr Wunsch, Kinder zu haben, glücklich zu werden, veränderte sich innerhalb einer Sekunde beim Betrachten eines fünfhundertdreissig Jahre alten Bildes im Duomo Santa Maria Del Fiore.
«Wir sollten operieren»
Als sie bei uns in der Klinik ankam, war sie fast unauffällig. Kopfschmerzen und leichte Doppelbilder beim starken Seitwärtsblick. Sonst zeigte die hübsche rothaarige Frau keine medizinischen Auffälligkeiten.
Sie sass vor uns, die MRI-Bilder auf den Knien. Der Chef sah sich die Bilder lange an. Er murmelte seinem Oberarzt etwas zu. Dann drehte er sich wieder zu der Patientin und ihrem Mann um.
«Ein Hämangiom. Im Kleinhirn, da, wo die Bewegungen gesteuert werden. Blutungen in diesem Bereich können aber auch leicht den Hirnstamm mit beeinflussen, und wenn der abgedrückt wird, dann ist das lebensgefährlich.»
Die beiden schluckten.
«Das im Grosshirn liegt oberflächlich, das dürfte kein Problem sein.»
Sie knüllte ein Taschentuch.
«Das Risiko, dass es an dieser Stelle noch einmal zu einer Blutung kommt, ist sehr hoch. Darum sollten wir operieren.»
Er machte keine Pause, sondern sah den Oberarzt an. Dieser murmelte wieder etwas. Die Sonne schien schräg hinter dem Rücken des Kollegen ins Krankenzimmer. Die rotblonden Haare schimmerten wie ein Korallenstock.
Ihr Mann sass so versunken da, er war kaum wahrzunehmen. Nur noch eine Hülle. Seine Augen waren matt, und man sah ihm den Kummer der letzten zwei Wochen an. Violette Schatten klebten unter seinen Lidern. Die Lippen trocken.
Zwei Wochen nach dem Aufklärungsgespräch durch den Chef der Abteilung kam sie zur Operation in die Klinik. In Begleitung ihres Mannes, dessen Konturen zerrissen wirkten, fast gegen die Umgebung verschoben. Sie stellte eine Postkarte mit den Liebenden auf ihr Nachtkästchen. Ein Mann, an dessen Schultern man jede Muskelfaser erkennen kann, drückt sein erstaunlich ausdrucksloses Gesicht an die Wange einer faltigen Frau. Sie schenkte mir eine davon. Noch Wochen später lag die Karte auf dem Beifahrersitz meines Alfas.
Zehn Stunden später
Sie wurde in einer zehnstündigen Operation behandelt. Sie wachte auf. Das war gut. Ihr rechtes Auge sah in eine andere Richtung als ihr linkes. Und sie konnte nicht schlucken.
Die Gründe für diese Veränderungen waren schlicht: Der Blutschwamm lag in der Nähe von Gehirnzentren, die die Augenbewegungen steuern. Und beim Eingriff waren die Nervenkerne des Glossopharyngeus zerstört worden, des Hirnnerven, der für Schluckprozesse mitverantwortlich ist.
Dieser Nerv steuert die Empfindlichkeit im Rachen, sorgt dafür, dass es uns würgt, wenn wir mit der Zahnbürste zu weit nach hinten kommen. Ausserdem leitet er die Impulse für das Schlucken an die Rachenmuskeln weiter. Was das bedeutet, wenn beide Kerngebiete dieses Nervs – der Mensch hat zwei, auf jeder Seite einen – ausgefallen sind?
Man kann nicht trinken, weil das Wasser einfach in die Lunge läuft. Man verschluckt sich und spürt, wie unangenehm es ist, kann aber nichts dagegen machen. Man kann nicht essen, weil man gar nicht schlucken kann. Der Reflex wird einfach nicht ausgelöst. Das Essen klebt wie ein Pappeknödel im Mund, und wenn man diesen nach hinten schleudern würde, bliebe er auch da liegen. Man könnte nicht schlucken, man könnte nicht würgen, das Essen würde den Weg verkleben. Bevorzugt den Weg in die Lunge. Man ist nicht mehr lebensfähig.
Ihr Zustand war grauenhaft. Sie lag im Bett. Ihr rechtes Auge sah nach rechts, aus dem Fenster hinaus. Ihr linkes Auge sah nach links oben, zur Decke hin. Beide Augen tränten ohne Unterlass. Ihre Haut war aufgequollen und verpickelt durch das Kortison, das wir geben mussten, um eine Schwellung im Kopf zu verhindern. Die Sommersprossen waren verschwunden. In ihrer Nase steckte eine Magensonde. Sie war tracheotomiert. Permanent musste sie abgesaugt werden, was dazu führte, dass ihr roter Kopf noch röter wurde und sie unheimliche Grunzlaute von sich gab, die heiser klangen. Der Grund dafür war eine Lähmung des Vagusnervs und damit auch des Recurrens-Astes, der die Bewegung der Stimmlippen steuert. Sie würde nie wieder normal sprechen können.
Ich sass an ihrem Bett. Ich sah in ein Auge. Das andere blickte auf die Fotografie der Liebenden. Ihre Augen schwammen in einem Tränensee. Aus ihrem Tracheostoma blubberte es bedrohlich. Die Maschinen gaben ständig Alarm, es bimmelte, dann erschien eine Intensivschwester, die zehn solcher Patienten betreute, und stellte das Geräusch mit muffigem Gesicht durch einen Knopfdruck wieder aus.
Die Liebenden
Ich sah das Bild an. Die Liebenden. Sie sah es auch, glaube ich.
Und dann passierte etwas Unheimliches. Ganz zart, langsam, tastend nahm sie meine Hand. Drückte sie kurz. Und liess sie wieder los. Vielleicht wollte sie mir damit sagen, dass alles, alles, alles auf dieser Welt, selbst die Schönheit und die Liebe und alle Wertschätzung, die wir aufbringen können, vergänglich ist. Dass Paradies und Hölle nur durch einen millimeterdicken Nerv voneinander getrennt sind. Vielleicht standen in ihren Augen Tränen, weil sie sie durch die Nervenschädigung kaum schliessen konnte. Vielleicht weinte sie aber auch. Vielleicht war sie unendlich traurig darüber, wie profan das Schicksal sein kann, eine göttliche Komödie.
Ein kleiner, einige Millimeter grosser Blutschwamm löschte alles aus. Riss die Liebenden auseinander. Zerstörte erst den einen, liess den anderen, nach Hoffnung ringend, zurück und beachtete ihn gar nicht mehr. Und die Frage nach dem Warum bimmelte so regelmässig in ihrem Kopf wie die Alarmfunktion der Infusionsmaschinen. Aber wir konnten ihr keine Antwort geben; stattdessen schickten wir Phrasen wie bunte Pfeile, die ihre Suche für ein paar Minuten ausschalteten.
Später, auf der Station, traf ich den Ehemann. Er war deutlich gefasster. Er erkundigte sich nach Pflegeheimen, die seine Ehefrau aufnehmen konnten. Das Leben muss weitergehen, sagen viele Menschen in solchen Momenten. Vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht muss das Leben gar nicht weitergehen, vielleicht muss es einfach gar nichts.
Nichts.
Nur eines müssen wir: ein Wunder sein. Verletzlich sein. Sterben.
_____________________
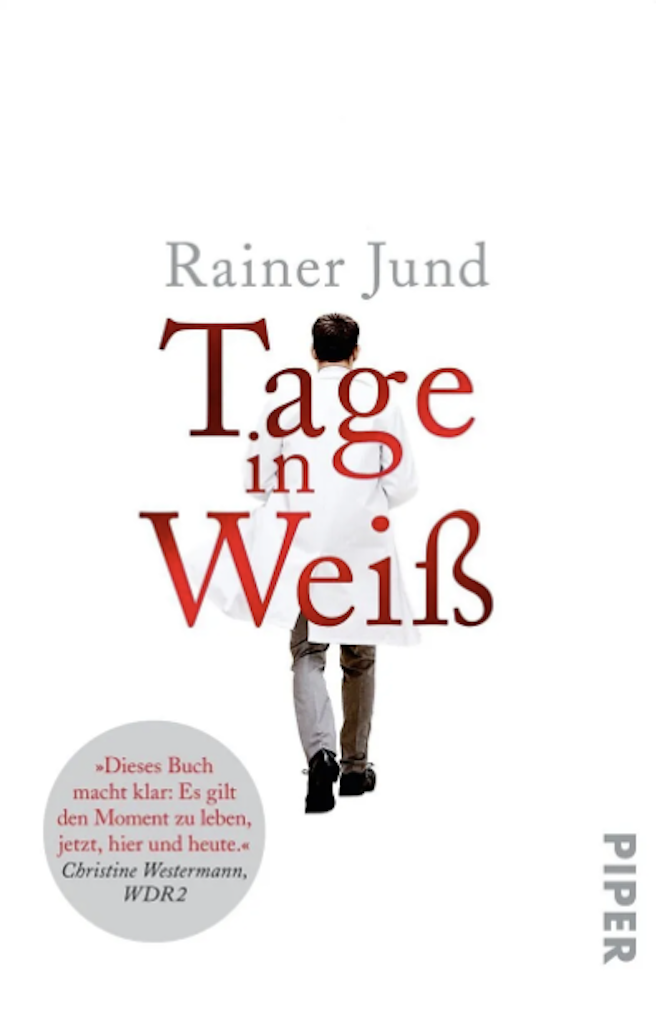
* Rainer Jund: «Tage in Weiss». Piper Verlag 2019, ca. 14 bis 29 Franken bzw. 12 Euro, je nach Buchhändler.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.











Danke, ein lebensnaher Beitrag, schön geschrieben, Himmel und Hölle auf Erden im Alltag. Die Realität wirft Fragen auf, warum, wieso, für was? Warum Leben, wenn wir ohnehin sterben? Und Leiden? Was schädigte die Blutgefäße dieser jungen Frau so sehr, dass sie nicht mehr dem Druck standhalten konnten? Von nichts kommt nichts. Vielleicht dürfen wir es nicht wissen.