Kommentar
Unser Sieg im Standortwettbewerb ist schwer auszuhalten
«Eine moderne Gesellschaft sollte es aushalten, dass internationale Firmen ihr Personal nach internationalen Standards bezahlen», schreibt der Kollege Guido Schätti am letzten Samstag in seinem Leitartikel für die «NZZ». Und er sagt auch, warum dies auszuhalten sei: Weil die «Produktivität der multinationalen Konzerne höher ist, heben sie die Löhne im ganzen Land». Auch die der Bäckerinnen. Und: «Die Segnungen der Multis zeigen sich auch bei den Steuern. Aus ihren Kassen stammen fast die gesamten Einnahmen der direkten Bundessteuer.»
Damit liegt die «NZZ» ganz auf der Linie der kürzlich vom «Tages-Anzeiger» zitierten «bürgerliche Kreise», die auf Grund der gelockerten Steuerregeln der OECD die Chance sehen, «wertschöpfende Grosskonzerne» durch gezielte Anreize langfristig zu binden». Sprich in die Schweiz zu holen.
Doch ist die Ansiedlung von «wertschöpfenden Grosskonzernen» wirklich im Interesse des Durchschnittsbürgers?
Für jede zugewanderte Fachkraft braucht es weitere Arbeitskräfte
Schauen wir uns das einmal im Detail an: Angenommen der «Greater Zurich Aera» (GZA) gelinge es, einen Grosskonzern mit 1000 Fachkräften in die Schweiz zu holen – und 10 reiche Steuerflüchtlingen als Beigabe. Die Erfahrung (etwa mit Google) zeigt, dass solche Fachkräfte in Normalfall etwa 150‘000, nicht selten aber auch 300‘000 Franken im Jahr verdienen.
Weil es der Schweiz – mit ihrem hausgemachten Fachkräftemangel – an Fachkräften mangelt, müssen diese 1000 Jobs im Ausland rekrutiert werden. Doch die Tausend Fachkräfte sind nur die Spitze des Eisbergs. Es braucht Spezialisten, die sie erst einmal rekrutieren, ihre Ansiedlung steuerlich und logistisch vorbereiten, Immobilienmakler und vor allem Arbeiter, die ihre Wohnsitze bauen und ausrüsten. Eine Wohnung kostet mindestens 500’000 Franken plus Einrichtung. Allein das dürfte pro Eingewanderten mindestens 5 Mannjahre Arbeit beanspruchen.
Einmal in der Schweiz angekommen, können sich Fachkräfte oder Steuerflüchtlinge einen relativ hohen Lebensstandard gönnen. Sie dinieren in Nobel-Restaurants, gehen in den Fitnessclub, schicken ihre Kinder in die Schule, werden krank, beanspruchen die Infrastruktur. Mit ihrem gehobenen Konsum beanspruchen sie eine hohe Zahl von deutlich schlechter bezahlten, zusätzlichen Arbeitskräften. Diese brauchen ebenfalls Wohnraum und Infrastruktur. Dieser selbst gemachte Einwanderungssog dürfte den Hauptharst der jährlichen 80‘000 bis 100‘000 Arbeitsimmigranten erklären.
Die Gewinner sind die Eigentümer von Bauland
Dieser Ansturm trifft die Eingesessenen sehr unterschiedlich. Der zunehmende Dichtestress belastet vor allem die Aktiven, deren Arbeitswege tendenziell länger und teurer werden. Dazu gibt es eine Studie, der man entnehmen kann, dass ein nur schon um sechs Minuten längerer Arbeitsweg die Lebenszufriedenheit gleich stark beeinträchtigt wie fünf Prozent weniger Lohn.
Profiteure sind hingegen die Bodenbesitzer. Das typische Beispiel sind die Erben eines Grundstücks auf dem jetzt an Stelle des früheren Einfamilienhauses der Eltern ein Wohnblock mit fünf Mietparteien steht, der ihnen ein arbeitsloses Nettoeinkommen von 10‘000 Franken pro Monat beschert.
Die Verlierer sind Mieter – und auch die Expats selbst
Zu den Verlierern gehören – um ein aktuelles Beispiel zu nehmen – die 146 gekündigten Mietparteien an der Hardstrasse in Zürich, die jetzt eine neue Bleibe suchen und mit monatlichen Mehrkosten von mindestens 1000 Franken rechnen müssen. Ihnen stehen stressige Zeiten bevor. Denn die Wohnungssuche ist schon fast ein Vollzeit-Job. Dazu kommt der Verlust des gewohnten Umfelds. Und davon sind sehr viele betroffen. Laut einer Umfrage befürchten 55 Prozent der Mieter der Stadt Zürich, dass sie ihre Wohnung in absehbarer Zeit verlassen müssen.
Auch die gut bezahlten Expats sind insofern Verlierer als sie für ihre Wohnungen aktuelle Marktpreise zahlen müssen, die um eine Million Franken oder mehr über den effektiven Baukosten liegen – ein teures Eintrittsticket. Ähnliches gilt auch für die Masse der ins Land geholten Bauarbeiter, Monteure, Pizzakuriere etc. Ihr Wohlstand wird durch die im Verhältnis zum Lohn sehr hohen Mietkosten massiv geschmälert.
Nicht zuletzt leidet auch die Produktionskraft der informellen Wirtschaft in Familien und Nachbarschaften unter der durch die Einwanderung bedingten Gentrifizierung, den langen Arbeitswegen, häufigen Umzügen etc. Das beeinträchtigt die Lebensqualität und verursacht beträchtliche Zusatzkosten: Kita statt Familie, Altersheim statt Nachbarschaft und für die Geselligkeit Kreuzfahren statt Grillparties und Jassabende mit den Nachbarn.
Weniger Pflegekräfte, mehr Todesfälle in Spitälern
Doch was ist mit den «Löhnen im ganzen Land», die laut Schätti dank der «Produktivität der multinationalen Konzerne» angehoben worden sind? Richtig ist, dass die Produktivität steigt. Im Schnitt um ein Prozent pro Jahr, bei den Grossunternehmen gar um drei Prozent (siehe hier). Das hat aber die Löhne keineswegs angehoben. Von 2015 bis 2024 sind diese real praktisch unverändert geblieben. Richtig bleibt, dass das Schweizer Lohnniveau immer noch deutlich höher ist als im umliegenden Ausland.
Doch wie halten es Gesellschaften aus, wenn ihre Arbeitskräfte in die Schweiz pendeln? Diese Frage beleuchtet diese aktuelle Studie. Die Autoren haben herausgefunden, dass die Sterblichkeit in den grenznahen deutschen Spitälern nach 2011 um 4,4 Prozent, entsprechend 280 zusätzlichen Todesfällen pro Jahr, gestiegen ist. Der Grund: Wegen des starken Anstiegs des Frankens und der um rund 2500 Franken höheren Löhnen in der Schweiz hat sich die Zahl der GrenzgängerInnen im Gesundheitswesen verdoppelt – zulasten der deutschen Krankenhäuser.
Damit ist klar: Eine moderne Gesellschaft hält es nur mit grossen Schmerzen aus, «dass internationale Firmen ihr Personal nach internationalen Standards bezahlen» – und einige sterben sogar daran. Das wirft die Frage auf, warum die internationalen Firmen so viel höhere Löhne bezahlen können und warum dieser Unterschied früher offenbar viel weniger ins Gewicht fiel. Dazu müssen wir ein wenig ausholen (für regelmässige Leserinnen und Leser des Infosperber ist es eine Wiederholung).
Löhne, die den Rahmen des Binnenmarkts sprengen
Die klassische Lehrbuch-Wirtschaft beschreibt den ganz normalen Binnenmarkt: Arbeit von Einheimischen für Einheimische. Der Wettbewerb sorgt dafür, dass die Löhne in etwa den Kosten der Lebenshaltung, entsprechen, deren Niveau wiederum von der gesamtwirtschaftlichen Produktivität abhängt. Diese erlaubt in der Schweiz Jahreslöhne von rund 80’000 Franken pro Vollzeitstelle. Eine gute Wirtschafts- und Antikartellpolitik sorgt dafür, dass die Löhne im Binnenmarkt nicht allzu weit auseinanderklaffen.
Die internationalen Firmen funktionieren jedoch anders. Sie verkaufen ihre Produkte zwar in Hochlohnländern, stellen sie aber überwiegend in Ländern mit tiefem Lebenshaltungsniveau und entsprechend tiefen Löhnen her. Deshalb können sie für das bisschen Arbeit, das in den Hochlohnländern – etwa am Hauptsitz – geleistet wird, Löhne bezahlen, die den Rahmen des Binnenmarktes bei weitem sprengen. Das gilt auch für alle globalen Finanzdienstleister und Portale.
Halten wir die Folgen des Standort-Wettbewerbs aus?
Dank den Fortschritten in der Kommunikationstechnologie ist es in den letzten Jahrzehnten gelungen, immer grössere Teile der Produktion in globalen Wertschöpfungsketten zu organisieren und die Wertabschöpfung an wenigen Orten zu konzentrieren. Dies wiederum hat zu einem verschärften Standortwettbewerb geführt. Alle sind sich einig, dass «unser Standort» zu den Siegern in diesem Wettbewerb gehört. Doch jetzt stellt sich die Frage, ob «wir Schweizer» die Folgen dieses Sieges aushalten wollen.
Die Frage stellt sich auch global. Das Regime des Standortwettbewerbs bewirkt, dass sich die Kaufkraft immer mehr bei den global tätigen Firmen und deren Besitzern konzentriert. Die Zahl Milliardäre nimmt rasant zu – auch in den Randregionen. Statt mit ihrem Geld vor Ort tätig zu werden, ziehen die Reichen dorthin, wo die Steuern tief und ihr Leben sicher ist. Ihren Landleuten bleibt damit nur die Wahl, dem Geld ihrer mobilen «Elite» nachzuwandern. Mit der Folge, dass die Schweiz trotz rekordtiefen Geburtenraten wächst und wächst – und damit die globalen «Randregionen» noch weiter ins Abseits drängt.

Eine kleine Geldelite schafft für die Normalverdiener Probleme
Die Welt bräuchte dringend eine intelligentere Wirtschaftsordnung. Doch kann auch ein einzelnes Land – wie die Schweiz – etwas tun, um die negativen Folgen des Standortwettbewerbs zu mildern? Können wir darauf verzichten, noch mehr global tätige Firmen mit Steuervorteilen in die Schweiz zu locken? Und wenn ja: Laufen wir damit nicht Gefahr, selbst zu einem Randgebiet zu werden?
Zunächst: Die Schweiz ist auf Importe angewiesen: Energie, Rohstoffe, Industriegüter etc. Und diese müssen mit Exporten finanziert werden. Daran führt kein Weg vorbei. Zudem schafft unsere Exportindustrie auch Arbeitsplätze, deren quantitative Bedeutung allerdings stark überschätzt wird. Gemäss dieser Studie werden fast 90 Prozent der bezahlten Arbeit von Einheimischen für Einheimische auf den Binnenmärkten erbracht. Mit steigender Tendenz. Punkto Einkommen ist der Anteil der Exporte allerdings deutlich grösser. So ist etwa die Wertschöpfung pro Arbeitsplatz in der Pharmaindustrie siebenmal höher als in der Bauindustrie und elfmal höher als in der Gastronomie.
Allerdings profitieren insgesamt nur wenige vom Manna der Exportindustrie. Die Pharma-Industrie etwa zahlt zwar überdurchschnittliche Löhne, beschäftigt aber weniger als 1,5 Prozent der Schweizer Arbeitnehmer. Die grossen Profiteure sind die wenigen Topkader und Spezialisten und die Investoren. Und diese schmale Geldelite schafft mit ihrer geballten Kaufkraft die oben beschriebenen Probleme für die Normalverdiener des Binnenmarkts. So gesehen ist eine einseitige steuerliche Förderung der Exportindustrien eher nicht im Interesse der Allgemeinheit.
Es braucht etwas Hirnschmalz, um schadlos aus dem Hamsterrad des Standortwettbewerbs auszusteigen. Aber damit der nötige Denkprozess überhaupt in Gang kommt, müssten nicht nur die «bürgerlichen Kreise» endlich mal auch die grösseren Zusammenhänge ins Auge fassen.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





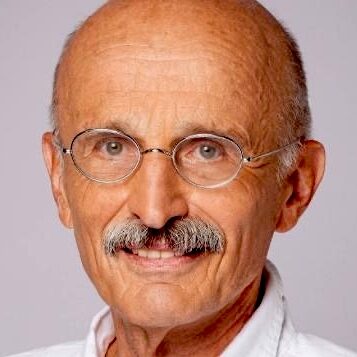






«…hat sich die Zahl der GrenzgängerInnen im Gesundheitswesen verdoppelt – zulasten der deutschen Krankenhäuser.»
Hätte man in D die Mitarbeiter des Gesundheitswesen mal ein bisschen netter behandelt!
Ich weise nur auf die monatelange FFP-Maskenpflicht und die sog. Einrichtungsbezogene Impfpflicht mit den Covid-Präparaten hin. Infosperber hat dankenswerterweise schon wiederholt Kritik an diesen Präparaten geäußert. Aber auch der Personalschlüssel ist in D dramatisch schlechter als in CH. Das deutsche Krankenhauswesen wir auf Kosten der Pflegemitarbeiter kaputt gespart.
So ist es bei weitem nicht nur die Bezahlung, die ehemalige Mitarbeiter des Gesundheitswesens aus D dazu motiviert lieber in der CH zu arbeiten. Vielmehr ist der Grenzgang eine Strategie, um im erlernten Beruf unter erträglichen Bedingungen weiterarbeiten zu können.
Zur Aussage im Artikel: «Die grossen Profiteure sind die wenigen Topkader und Spezialisten und die Investoren. Und diese schmale Geldelite schafft mit ihrer geballten Kaufkraft die oben beschriebenen Probleme für die Normalverdiener des Binnenmarkts…» Die Frage ist wohl, ob eine «schmale Geldelite» wie ein Staubsauger den Mittelstand aufsaugt und in die Unterschicht in weiterleitet, um an die Kohle der Mittelschicht zu kommen und deren Macht kippt, um so Nonstop-Milliardengewinnen in die Tasche zu stopfen, weil die die absolute Mehrheit eines Staates zu niedigrist Löhnen arbeiten müssen, das ist gewinnbringend für die «schmale Geldelite». Der soziale Frieden eines Staates ist nur gesichert, wenn es eine breite, gutverdienden und starke Mittelschicht gibt. Das heisst, es kann gesetzlich nicht geduldet werden, dass Grossabzocker die Mittelschicht und somit den Wohlstand eines Staates aus raffgier zerstören können, um an die grosse Kohle zu kommen.
Gunther Kropp, Basel
Die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge werden viel zu selten und gerade mal auf Infosperber, WOZ & Republik (Yves Wegelin) mit der nötigen Flughöhe behandelt.
Würde SRF auf die täglichen Börsen- und Devisenkurse verzichten, bliebe täglich Sendezeit für versierte Volkswirte, die wesentlichen Wirtschaftsmechanismen zu erklären.
Lesen sie Aldous Huxley «Zeit der Oligarchen» aus dem Jahr 1946.