Kommentar
Auf den Binnenmarkt kommt es an – Ermotti!
Nach dem Frankenschock denken die Schweizer wieder vermehrt über eine unsicher gewordene Zukunft nach. Meist kreisen diese Überlegungen um den «Standort Schweiz», doch damit ist die Lösung programmiert, bevor das Denken angefangen hat. Jüngstes Beispiel dafür ist die «Fünf-Pfeiler-Strategie» von UBS-Chef Sergio P. Ermotti. Alle fünf laufen darauf hinaus, die Unternehmen von Steuern und Vorschriften zu entlasten, den «Zugang zu den Weltmärkten» zu sichern, Wettbewerbsfähigkeit zu sichern etc. Kurz: Export gut, alles gut.
Doch ist die Strategie, Arbeitsplätze und Wohlstand über den Export zu sichern, wirklich sinnvoll und nachhaltig? Nun, man kann argumentieren, dass diese Rechnung bisher aufgegangen sei. Unser Land hat in den vergangenen vier Quartalen für rund 65 Milliarden Franken mehr Güter und Dienste produziert als konsumiert, das ist ein Exportüberschuss von gut zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts. Selbst wenn man die Wertschöpfung pro Vollzeitstelle in der Exportindustrie mit hohen 200’000 Franken veranschlagt, hängen davon gut 300’000 Stellen ab. Ohne diesen vom Ausland geborgten Konsum läge die Schweizer Arbeitslosenquote tief im europäischen Mittelfeld.
Ökonomischer Leerlauf
Doch eine Strategie der Beschäftigung durch chronische Exportüberschüsse ist weder nachhaltig noch fair gegenüber den Handelspartnern. Zudem ist sie ein ökonomischer Leerlauf. In Zahlen: Ende 1994 hatte die Schweiz noch ein Nettoauslandvermögen von 320 Milliarden Franken. In der Zwischenzeit haben wir Leistungsbilanzüberschüsse von 965 Milliarden angehäuft, wovon 580 Milliarden durch Kapitalerträge. Doch statt auf fast 1300 ist unser Nettovermögen (geschätzter Stand Ende Januar) bloss auf gut 400 Milliarden angestiegen. Grund dafür sind laufende Wertverluste auf dem Bestand. Diese haben nicht nur sämtliche Kapitalerträge weggefressen, sondern auch noch rund drei Viertel der Handelsüberschüsse. Das macht den Export zur Beschäftigungstherapie.
Wir sollten also davon ausgehen, dass wir – wie alle andern Länder im Schnitt auch – nur noch soviel exportieren, wie wir zur Finanzierung unserer Importe brauchen. Damit aber werden rund 300’000 Jobs mittelfristig wegfallen. Weitere rund 30’000 Jobs pro Jahr sind durch die Zunahme der Produktivität (um jährlich rund 1%) gefährdet. Woher also soll die Nachfrage kommen, die uns auch in Zukunft Vollbeschäftigung ermöglicht? Ein Blick zurück zeigt, in welcher Richtung wir unterwegs sind.
Bescheidene Job-Bilanz
In der Zeit1991 bis 2014 ist zwar die Schweizer Bevölkerung um rund 1,4 Millionen gestiegen, es sind aber nur 240’000 zusätzliche (auf Vollzeit umgerechnete) Stellen geschaffen worden. Per Saldo mehr Stellen gab es im Sozialwesen 93’000, in der Gesundheit 83’000, in der Bildung 67’000 und in der öffentlichen Verwaltung 38’000. Alle anderen Sektoren haben per Saldo rund 40’000 Jobs abgebaut. Obwohl der Exportüberschuss in dieser Periode um rund 8 BIP-Prozent zugenommen hat, haben die klassischen Exportbranchen Pharma, Finanzdienstleistungen, Maschinen, Elektro und Uhren keine zusätzlichen Jobs geschaffen.
In Anbetracht des Bevölkerungswachstums ist das eine sehr bescheidene Job-Bilanz. Dass die Arbeitslosigkeit dennoch nur leicht gestiegen ist, hat einen wichtigen Grund: Die durchschnittliche Arbeitszeit ist um etwa 7 Prozent zurückgegangen. Man kann dies so auslegen, dass das Bedürfnis nach mehr Freizeit rund 220’000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen hat. Die Hitparade der Job-Schaffer sieht deshalb so aus: Freizeit, Sozialwesen, Gesundheit, Bildung, öffentliche Verwaltung.
Kollektive Güter
An diesen Trends dürfte sich auch in Zukunft nicht viel ändern. Ganz oben in der Bedürfnispyramide hängen nun mal vor allem kollektive Güter. Der technologische Fortschritt schlägt bekanntlich vor allem in der Industrie zu. Und Finanzdienstleistungen dürften erst recht gefährdet sein, da es sich dabei zur Hauptsache um Datenverarbeitung handelt. Fast alles, was Banker können, können Computer besser und billiger. Laut dem SVP-Bänker Thomas Matter sind deshalb etwa 50’000 Bankenjobs mittelfristig gefährdet.
Neue Arbeit wird also auch in Zukunft fast ausschliesslich durch die Befriedigung jener Bedürfnisse geschaffen werden, die von bürgerlichen Politikern gemeinhin als «Begehrlichkeiten» eingestuft werden. Wer sich die Rückführung der Staatsquote und den «reinen Markt» auf die Fahne geschrieben hat, sagt damit auch Nein zum Wachstum. Dahinter steckt das Problem, dass der «reine Markt» ein sehr beschränktes Repertoire hat. Er funktioniert nur gut, wenn es darum geht, Güter und Dienstleistungen zu produzieren und zu vermarkten, die erstens privat sind und zweitens aus dem laufenden Einkommen finanziert werden können. Die meisten Gesundheits- oder Bildungsausgaben fallen nicht in dieser Kategorie, ebenso wenig wie die Altersvorsorge und die Arbeitslosenversicherung. Von den eigentlichen kollektiven Gütern schon gar nicht zu reden. Doch leider geht gerade hier die Post ab.
Das Problem ist aber nicht nur ideologisch. Kollektive Güter zu finanzieren ist auch objektiv schwierig. Steuern kann man umgehen, Lohnprozente auch. Die zunehmend ungleiche Einkommensverteilung und die geographische Mobilität der Superreichen und der Armen macht die Sache auch nicht leichter. Und Freizeit wird zwar individuell «konsumiert», muss aber kollektiv ausgehandelt werden.
Politik der Standortattraktivität
Diese Überlegungen zeigen, dass die Aufrechterhaltung eines der Produktivität entsprechenden hohen Konsumniveaus eine reife politische und kulturelle Leistung ist. Der Schweiz ist dies bisher insgesamt recht gut gelungen. Wir haben insbesondere nicht den Fehler gemacht, Beschäftigung mit der Schaffung eines Niedriglohnsektors, bzw. durch den Abbau von Sozialleistungen, erzwingen zu wollen. Bei uns können sich auch Beschäftigte im Detailhandel oder im Reinigungsgewerbe ein halbwegs anständiges Leben leisten. Und tragen damit zur Beschäftigung bei. Die staatliche Infrastruktur ist intakt.
Dies war aber wohl auch deshalb möglich, weil die Beschäftigung durch eine Politik der Standortattraktivität stabilisiert wurde: Durch chronische Exportüberschüsse und durch einen permanenten Einwanderungsboom. Über den Daumen gepeilt haben wir seit 1991 einen Produktivitätszuwachs von 24 Prozent zu je etwa einen Drittel durch mehr Export, durch mehr Konsum von kollektiven Gütern und durch kürzere Arbeitszeiten abgefedert. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein.
Mehr Freizeit statt mehr Produktivität
Was also ist zu tun? Der wichtigste Beitrag muss weiterhin von der Umwandlung von Produktivitätsfortschritt in Freizeit (statt Arbeitslosigkeit) kommen. Der durchschnittliche Schweizer Arbeitnehmer arbeitet heute 1540 Jahresstunden. Für jede Person, die ein volles Pensum ergattert, muss sich eine andere mit einen halben begnügen. Wenn beim durchschnittlichen Arbeitspensum der Siebzigerjahre die 40-Stundenwoche richtig war, wäre heute eine 33-Stundenwoche angebracht. Um den Trend zu kürzeren Arbeitszeiten zu fördern, könnte man z.B. die Sozialwerke konsequent auf das durchschnittliche Arbeitsvolumen ausrichten. Beispiel: Wer 42 Stunden arbeitet, zahlt Beiträge auf den vollen Lohn (z.B. gegen Arbeitslosigkeit), versichert ist aber nur der Lohn von 33 Stunden. Wer überdurchschnittlich viel arbeitet, und den anderen damit Arbeit wegnimmt, subventioniert deren Sozialversicherung.
Staat von unnötigen Aufgaben entlasten
Eine weitere Konsumbremse ist das Trittbrettfahren. Je höher der Anteil der kollektiv finanzierten Ausgaben, desto höher ist der Anreiz, sich durch Schwarzarbeit oder Steuerhinterziehung um die Bezahlung zu drücken. Man muss sich zwar darüber streiten, welche Steuern die richtigen sind, aber man kann nicht – wie Ermotti – alle ablehnen. Vor allem aber muss man den Staat von unnötigen Aufgaben entlasten bzw. diese Kosten auf die Verursacher abzuwälzen. Beispiel: Bei einem Mindestlohn von 8.50 Euro in Deutschland muss der Staat pro Stunde mindestens noch einmal 8.50 Euro draufbuttern, um die Lebenshaltungskosten (inklusive Altersvorsorge, Schule, Gesundheit) zu decken. Je ungleicher die Unternehmen ihren Mehrwert verteilen, desto höher die Soziallasten des Staates. Die Schweiz hat auch hier bisher relativ gut abgeschnitten.
Export kann Beschäftigungsproblem nicht lösen
Reformbedarf gibt es jedoch beim System der steuerbegünstigten Altersvorsorge. Die Schweizer Haushalte haben 2012 gut 70 Milliarden Franken gespart – netto, also nach den Ausgaben für das Eigenheim. Diese Ersparnisse werden aber gar nicht gebraucht, denn im selben Jahr hatten die Unternehmen und der Staat per Saldo einen kleinen Überschuss erzielt, hatten also keinen Finanzierungsbedarf. Wenn aber diese Ersparnisse nicht mehr durch Exportüberschüsse entsorgt werden können, schaffen sie Arbeitslosigkeit. Das Problem könnte etwa dadurch entschärft werden, dass nur noch Pensionskassenbeiträge im Rahmen des Obligatoriums steuerlich abzugsfähig sind.
Und was ist mit der Exportindustrie? Klar, die muss wettbewerbsfähig bleiben. Das ist nicht trivial, da haben Ermotti und Konsorten recht. Aber sie sollen nicht so tun, als könne der Export unser Beschäftigungsproblem lösen. Kann er nicht. Hier geht es um Rückzugskämpfe, die aber ihre Tücken haben. Wenn jetzt etwa erst nur in der Exportindustrie im grossen Stile Arbeitszeiten verlängert und Löhne gekürzt werden, kann das zu einem Einbruch der Binnennachfrage führen. Spanien, Portugal, Griechenland und Deutschland haben diese Erfahrung schon gemacht.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
keine





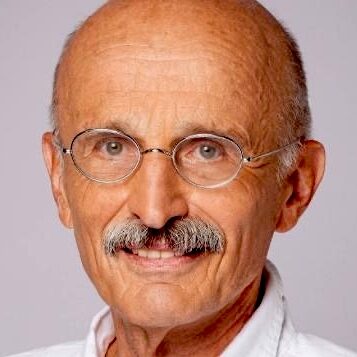




Die neuesten für 2014 eben erst veröffentlichen Zahlen bestätigen das Bild, dass die Exporte die Wirtschaft nicht retten können. Die EU-Ausfuhren in die Schweiz schrumpften um satte 18 Prozent auf 129,9 Mrd. Euro, die Importe aus der Schweiz legten um 3 Prozent auf 90,5 Mrd. zu. Der Schweizer Export stagniert und in der Schweiz machen sich Sättigungstendenzen beim EU-Konsum bemerkbar.
Da liegt Werner Vontobel wohl richtig, In der Zeit1991 bis 2014 ist zwar die Schweizer Bevölkerung um rund 1,4 Millionen gestiegen, es sind aber nur 240’000 zusätzliche (auf Vollzeit umgerechnete) Stellen geschaffen worden.
So kann es wohl nicht weitergehen, die Schweiz kann nur sehr beschränkt die Beschäftigung europäischer Länder sicherstellen!
Fragen dazu:
1) «Doch eine Strategie der Beschäftigung durch chronische Exportüberschüsse ist weder nachhaltig noch fair gegenüber den Handelspartnern.» => Warum unfair – kaufen unsere Handelspartner nicht freiwillig bei uns, weil sie sich einen Nutzen davon versprechen?
2) «Doch statt auf fast 1300 ist unser Nettovermögen (geschätzter Stand Ende Januar) bloss auf gut 400 Milliarden angestiegen. Grund dafür sind laufende Wertverluste auf dem Bestand. » => Die SNB gibt für 2012 ein Nettoauslandsvermögen von 877 Mrd. Franken an, inkl. Währungsreserven von 485 Mrd [1]. Woher kommt die Differenz? Die genannten Wertverluste dürften denn auch primär auf den Wechselkurs zurückzuführen sein, nicht? [2]. Dafür kann aber die Exportindustrie nichts, im Gegenteil. Ohne deren Ueberschüsse wäre das Schweizer Nettovermögen wohl geschrumpft.
3) «nur noch soviel exportieren, wie wir zur Finanzierung unserer Importe brauchen» => Uebertragen auf die Migros würde dies ja bedeuten: Die machen den Laden zu, sobald sie die Kosten des Tages oder Monats gedeckt haben. Hoffentlich nicht!
4) «In der Zeit 1991 bis 2014 ist zwar die Schweizer Bevölkerung um rund 1,4 Millionen gestiegen, es sind aber nur 240’000 zusätzliche (auf Vollzeit umgerechnete) Stellen geschaffen worden.» => Der Vergleich scheint mir nicht ideal. Relevanter wäre doch die Entwicklung der erwerbsfähigen Bevölkerung. Denn der Altersquotient hat seit 1991 von 0.23 auf 0.28 zugenommen, Tendenz steigend. [3]
5) «Damit aber werden rund 300’000 Jobs mittelfristig wegfallen. Weitere rund 30’000 Jobs pro Jahr sind durch die Zunahme der Produktivität (um jährlich rund 1%) gefährdet.» Wie steht es im Katechismus der HSG: Da müssen wir die Flucht nach vorne antreten! Mehr Exporte, mehr Wachstum! Augen zu und durch…
6)"Die Hitparade der Job-Schaffer sieht deshalb so aus: Freizeit, Sozialwesen, Gesundheit, Bildung, öffentliche Verwaltung. » => Dazu muss eigentlich nicht viel gesagt werden. Interessant wäre noch die Aufschlüsselung im Bildungsbereich. Geht das auf die Bevölkerungszunahme zurück, oder werden wir immer wie klüger, oder (meine Befürchtung) braucht es immer mehr Sonderklassen, Hilfspädagogen und Schulpsychologen? Nicht zu vergessen, dass die Schule auch ein netter Wachstumsmarkt für die Pharma ist (Ritalin & Co.)
7) «Wenn aber diese Ersparnisse nicht mehr durch Exportüberschüsse entsorgt werden können, schaffen sie Arbeitslosigkeit.» Naja, wenn die Exportüberschüsse oder allg. die Leistungsbilanz einbrechen sollte, werden die inländischen Nettofinanzierungsüberschüsse und Ersparnisse automatisch tauchen… Die Arbeitslosigkeit gibt’s dann noch obendrauf. Freilich: Manche haben seit über einem Jahrzehnt gewarnt, dass die Personenfreizügigkeit mit Kopplung an die Sozialsysteme ein Schönwetterprogramm ist, das sich im Abschwung bitter rächen könnte.
[1] http://www.snb.ch/ext/stats/iip/pdf/de/1_1_Auslandverm_Uebersicht.pdf
[2] http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/das-andere-frankenproblem-1.11980371
[3] http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/alter/gesamt.html
ist ja schon recht…. ABER – die «Standortattraktivität» ist nicht die Lösung, sonder Teil des Problems.
Unsre «Batze-und-Weggli-Mentalität» ködert die Superreichen und stört sich dann an den Menschen, welche im wirtschaftlichen Schlepptau kommen.
Wir müssen also die Standortattraktivität keineswegs fördern, sondern versuchen, diese zu nivelieren. Wir leben über unsre Verhältnisse teilweise auf Kosten anderer Gesellschaften und insbesondere auf Kosten der Nachkommenden.
Tipps von Bankern sind selten auf das Wohl der Bevölkerung ausgerichtet.
Sie schreiben «Für jede Person, die ein volles Pensum ergattert, muss sich eine andere mit einen halben begnügen. Wenn beim durchschnittlichen Arbeitspensum der Siebzigerjahre die 40-Stundenwoche richtig war, wäre heute eine 33-Stundenwoche angebracht. «
Arbeit ist aber kein begrenztes Gut. Die Menge an potenziell nachgefragter Arbeit ist völlig unbegrenzt. Worauf es ankommt, ist der Preis, also der Lohn. Wenn der Lohn tief genug ist wird jede beliebige Menge an Arbeit nachgefragt. Allerdings wird dann nicht mehr jede beliebige Menge an Arbeit angeboten. Letztlich ist dies ein einfaches Problem von Angebot und Nachfrage. Je höher der Preis (Lohn) umso höher ist das Angebot an Arbeit und umso geringer ist die Nachfrage nach Arbeit.
@Faltin. Beim Faktor Arbeit scheint mir diese Regel des Marktes nicht zu gelten. Wenn für Arbeit weniger bezahlt wird, wird nicht weniger davon angeboten, sondern im Gegenteil mehr. Damit Lohnabhängige ihre Bedürfnisse mit weniger Lohn decken können, müssen sie länger arbeiten, also mehr Arbeit anbieten. Die Working Poor müssen dann einen zusätzlichen Job annehmen oder die erziehende Mutter ihr Pensum erhöhen. Von «Arbeitsmarkt» zu reden und damit zu suggerieren, dieser funktioniere nach den Regeln eines Güter- oder Dienstleisungsmarktes, scheint mir eine gängige Irreführung zu sein.
Hallo Herr Gasche, im Einzelfall könnte Ihre Annahme zutreffen. Gesamtwirtschaftlich gelten aber die normalen Angebots- und Nachfragegesetze auch für den Arbeitsmarkt. Die einzige Ausnahme kennen Sie vermutlich auch, nämlich die sogenannte «backward bending supply curve». D.h. wenn der Preis für Arbeit sehr hoch steigt gibt es einen Punkt an dem das Angebot wieder sinkt, weil dann die Arbeitnehmer der Freizeit einen höheren Stellenwert einräumen als der Arbeit. Aber wie gesagt ansonsten gelten die normalen Angebots- und Nachfragegesetze, dies ist standard Mikroökonomie. Gruss. D. F.