Covid-Impfüberwachung: Deutsche Aufsichtsbehörde enttäuscht
«Hohe Qualität kennzeichnet unsere Arbeitsergebnisse, gepaart mit kurzen Bearbeitungszeiten und Wirtschaftlichkeit.» Das ist eines der Leitprinzipien des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), der deutschen Aufsichtsbehörde für Impfstoffe. Beim Überwachen der Impfstoffsicherheit scheint es jedoch nicht zu gelten.
Im Dezember 2020 hatte das PEI eine Studie angekündigt: Mit Hilfe der «Safe-Vac 2.0-App» wollte es herausfinden, wie verträglich und wie sicher die Covid-Impfstoffe sind, auch langfristig. Die App sei «Teil einer aktiven Überwachung der Impfstoffsicherheit», informierte das Institut damals. Mögliche unerwünschte Wirkungen der Impfstoffe sollten mit Hilfe der App «rasch erkannt, untersucht und minimiert werden», versprach die Behörde, die in Deutschland für die Zulassung und fürs Überwachen von Impfstoffen zuständig ist.
739’515 geimpfte Personen luden sich die App herunter, übermittelten ihre Daten, die Chargennummer des Impfstoffs und ihre Symptome. Mindestens 3506 Verdachtsmeldungen über schwere Nebenwirkungen gingen über diesen Kanal beim PEI ein – eine pro 211 Personen, wie der Virologe Alexander Kekulé im «Focus» vorrechnete.
1,6 Millionen Euro in den Sand gesetzt
Doch was die Studie genau ergab, bleibt das Geheimnis des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). Fast fünf Jahre später weigert sich die Behörde noch immer, die Ergebnisse bekannt zu geben.
Die für rund 1,6 Millionen Euro entwickelte «Safe-Vac 2.0-App» hätte ein schnelleres und genaueres Abbild der Nebenwirkungen liefern können als das bekanntermassen ungenügende, passive Spontanmeldesystem. Beim Spontanmeldesystem melden Ärzte, Gesundheitseinrichtungen oder Betroffene vermutete Nebenwirkungen von sich aus. Ärzte sind gesetzlich dazu verpflichtet, kommen dem aber meistens nicht nach.
Im Mittel werden 94 Prozent der vermuteten Arzneimittelnebenwirkungen nicht gemeldet. Ausserdem würden Verdachtsfallmeldungen von Impfkomplikationen oft zeitverzögert erfolgen, schrieb das PEI. Die App hätte dieses Problem gelöst.
Die mit Hilfe der App bei den Nutzern regelmässig abgefragten Daten wären auch deshalb wichtig gewesen, weil mindestens Pfizer/Biontech den massenhaft verimpften mRNA-Impfstoff anders herstellten als denjenigen, den sie zuvor in den Zulassungsstudien verwendet hatten. Der bei der Massen-Impfkampagne verwendete mRNA-Impfstoff war teilweise mit DNA-Bruchstücken verunreinigt. Ob dies gesundheitliche Folgen hat und welche, ist offen.
Vorwurf: Behörde leiste der Impfskepsis Vorschub
Der deutsche Journalist Bastian Barucker verlangte per Gerichtsverfahren die Herausgabe der «Safe-Vac 2.0-App»-Daten. Doch das PEI windet sich. Zunächst teilte es ihm mit, dass sich «valide Aussagen über die Sicherheit von Impfstoffen nur vom Spontanmeldesystem ableiten lassen», wie Barucker in seinem Blog berichtet. Diese Aussage der Behörde widerspricht ihren eigenen Ankündigungen und Versprechen.
Nun behauptete das PEI gegenüber dem Gericht: «Die Studie hatte nicht das Ziel, konkret neue, unbekannte, sehr seltene, schwerwiegende Nebenwirkungen (neue Risikosignale) zu belegen oder die Häufigkeit von Nebenwirkungen zu überprüfen, die in den klinischen Prüfungen zur Zulassung der Impfstoffe erhoben wurden.»
Mit ihrem Verhalten schüre die Behörde unfreiwillig auch die Impfskepsis, warf der Virologe Alexander Kekulé dem PEI im «Focus» vor.
Barucker zitiert in seinem Blog den früheren PEI-Mitarbeiter Klaus Hartmann, der dort für die Impfstoffsicherheit zuständig war. Mit dem Spontanmeldesystem habe das PEI «seiner Meinung nach […] ‹ein Erfassungssystem, welches eigentlich nicht funktioniert – und lobt sich anschliessend dafür, dass so wenige Nebenwirkungen da sind.›»
In einem Beitrag der «ARD» zur HPV-Impfung sagte Hartmann 2018: «Wenn Sie keine Häufungen bekommen von irgendwas, dann geht man davon aus, dass es keine Zusammenhänge gibt, was ja wiederum die Sicherheit der Impfstoffe belegt. Und so schliesst sich der Kreis.»
Covid-Impfung und die Tücken der Schweizer Meldestelle
Um abzuschätzen, ob ein Impfstoff bestimmte unerwünschte Wirkungen hat, stellen die Behörden Vergleiche an: Wie oft kommt die Erkrankung normalerweise vor und wie oft tritt sie nach der Impfung auf? Eine wichtige Rolle spielen dabei die Spontanmeldungen. Swissmedic kalkuliert ausserdem eine (fiktive) Rate an nicht-berichteten Nebenwirkungen ein.
Ein Arzt berichtete im Sommer 2021, dass er in seiner Praxis praktisch täglich Menschen mit Gürtelrose sehe, nachdem sie gegen Covid geimpft wurden. Damals häuften sich entsprechende Spontanmeldungen auch bei Swissmedic.
Nimmt man an, dass 50 Prozent der Verdachtsfälle der Behörde nicht gemeldet wurden, dann tritt die Gürtelrose nach der Covid-Impfung nicht markant häufiger auf als sonst. Geht man jedoch davon aus, dass Arztpraxen 90 Prozent der Fälle von Gürtelrose, die nach einer solchen Impfung auftraten, Swissmedic nicht meldeten, dann wären die Fälle so häufig, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine Nebenwirkung der Covid-mRNA-Impfung handelt. Deshalb ist die Frage entscheidend: Welcher Anteil der Fälle von Gürtelrose nach Impfung wurde Swissmedic gemeldet?
Im Beipackzettel ist Gürtelrose als mögliche Nebenwirkung der Covid mRNA-Impfstoffe bis heute nicht aufgeführt. Folglich liegt vielen Ärztinnen und Ärzten der Verdacht fern, es könne sich beim Auftreten einer Gürtelrose um eine Impf-Nebenwirkung handeln und sie erstellen keine Meldung.
Beim Verdacht auf eine Nebenwirkung konnten Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz früher ein Formular aus dem Internet herunterladen, ausfüllen und an Swissmedic faxen. Das war in wenigen Minuten erledigt. Mit Beginn der Covid-Impfkampagne, als es darauf ankam, rasch mehr zu den neuen Impfstoffen zu erfahren, verlangte Swissmedic die Meldungen über das elektronische «Elvis»-Meldeportal.
Solche Meldungen werden nicht entschädigt und das Nicht-Melden wird nicht sanktioniert.
Als impfende Ärztin versuchte die Autorin, einen Verdacht auf Nebenwirkung bei einer Patientin zu melden – aber innerhalb von 30 Minuten gelang dies nicht. Denn «Elvis» unterbrach die Eingabe mehrmals. Schliesslich gelang es zu Hause. Alles in allem ein Aufwand von rund einer Stunde für eine Meldung. Als dies bei einem weiteren Meldeversuch erneut passierte und Swissmedic über die Schwierigkeiten informiert wurde, lautete die Antwort: Das Problem sei bekannt, Swismedic sei daran, es zu beheben.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.








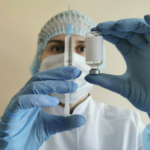


Sie sollten das «Ehrlich» aus dem Namen streichen.
Passt zum fragwürdigen Verhalten vieler Behörden und Institutionen zum Thema Corona. Auch wurden noch immer nicht,obwohl gesetzlich vorgeschrieben, die Daten der Krankenkassen ausgewertet. Demjenigen der hier mal vorpreschte und nur gesagt hatte, hier müsse man dringend genauer hinschauen, weil die Daten seiner KK nicht der behördlichen Erzählung entsprach, wurde sofort gekündigt.
Niemand wird die Kontroverse etc. hinsichtlich Impfpflicht bei Corona vergessen haben. Letztlich hat man von Impfpflicht abgesehen und es der eigenen Entscheidung der Bürger überlassen -eine schwierige Aufgabe, der wir uns nicht entzogen haben,unter Zuhilfenahme des Urteils von Fachleuten wie C.Drosten – und sind denen gefolgt. Leider hat sich dann später herausgestellt, daß deren Urteil nicht ganz so unbefangen war wie man gehofft hatte. Schon das hat jedenfalls meine Skepsist geweckt. Wenn das PEI jetzt die Ergebnisse aus der selbst propgierten APP zurückhält, dann bin ich alarmiert – und meine Impbereitschaft geht gegen Null, weil das Verhalten des PEI nur diesen Schluß zuläßt : Nebenwirkungen und Spätfolgen sind signifikant.
pei de 15.09.2021: «Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ist als Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit..»
Die Zeit 21. 03. 2021, 18.11: «Eine Liste aus dem Ministerium von Jens Spahn zeigt laut einem Bericht, dass der Bund 2020 FFP2-Masken von der Burda GmbH kaufte..»
Deutschlandfunk 08.07.2025: «Der schwierige Weg zur Aufklärung von Spahns Maskendeal.»
Interessante Aussage im Artikel: «Doch was die Studie genau ergab, bleibt das Geheimnis des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). Fast fünf Jahre später weigert sich die Behörde noch immer, die Ergebnisse bekannt zu geben…» Corona war ein Milliardengeschäft. Herr Spahn hatte wohl die Kontrolle über das Paul-Ehrlich-Institut. Und konnte wie Frau von der Leyen mit Milliarden jonglieren. Möglich, dass Kohle irgendwo hängen blieb. Ein Resultat: Covid-Impfüberwachung: Deutsche Aufsichtsbehörde enttäuscht.»
Gunther Kropp, Basel
Ganz klar, das PEI schürt mit seiner Praxis die Impfskepsis. Und es ruiniert auch seinen eigenen Ruf, denn es ist für ein ehemals geachtetes Institut hochgradig peinlich, solchen Unsinn von sich zu geben.
Möglicherweise würde das PEI aber die Impfskepsis noch mehr schüren, wenn es die Daten herausgeben würde, denn möglicherweise sind diese Daten nicht sehr vorteilhaft für die Impfung.
Transparenz wäre in jedem Falle geboten. Dann könnte die Skepsis sich gezielt gegen jene Impfungen richten, bei welchen sie auch angebracht ist. Sonst richtet sie sich diffus gegen alle Impfungen, auch gegen jene, welche nützlich wären.
Die ganze Corona-Geschichte ist mehr als peinlich.
Das Sprichwort lautet: wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht.
Und wie viel wurde insgesamt gelogen, vertuscht, unter den Tisch gekehrt, viel zu viel Geld unnötig heraus geschmissen etc.?
Wann hat das angefangen und wann hört es auf?
Werden die Verantwortlichen mal zur Verantwortung gezogen?
Haben sie wenigstens ein schlechtes Gewissen?