Kommentar
«Sonntags-Zeitung»: Rechnen gut, Denken schwach
Es leuchtet eigentlich ein: Pensionskassen sollten einen möglichst grossen Anteil ihres Vermögens in Aktien investieren. Denn seit der Einführung des Pensionskassenobligatoriums im Jahr 1985 haben Aktien im Schnitt 7,6 Prozent Rendite abgeworfen, Obligationen nur 2,1 Prozent.
Die «Sonntags-Zeitung» bringt das Beispiel des Finanzprofessors Thorsten Hens von der Uni Zürich. Die Uni Zürich hat vor 15 Jahren die Gelegenheit verpasst, zur Sammelstiftung Profond zu wechseln. Diese hat in ihrem Vermögen einen relativ hohen Aktienanteil. Hätte die Uni Zürich damals zur Profond gewechselt, wäre Hens’ Altersguthaben heute um 20 Prozent höher. Und weil die Profond dank der höheren Rendite auch eine höheren Umwandlungssatz hat, fiele die Rente laut Hens und «Sonntags-Zeitung» sogar um 44 Prozent höher aus.

Diese Rechnung dürfte stimmen. Unstimmig wird es allerdings, wenn die «Sonntags-Zeitung» und Hens vom Einzelnen auf das Ganze schliessen und daraus ableiten, dass das gesamtschweizerische Pensionskassen-Vermögen heute um 8,4 Milliarden Franken höher wäre, wenn alle Pensionskassen vor zehn Jahren auch nur einen Prozentpunkt mehr in Aktien statt in Obligationen investiert hätten. Bei zusätzlichen fünf Prozent wären es dann schon 42 Milliarden mehr gewesen.
Ein Trugschluss
Das ist – im Fachjargon der Logiker – ein «Trugschluss der Komposition»: Der Einzelne kann zwar seinen Nutzen mehren, wenn er mehr Aktien kauft, doch das Ganze gehorcht anderen Gesetzen. Darauf verwendet die «Sonntags-Zeitung» in ihrem langen Artikel allerdings keine einzige Zeile. Sie argumentiert bei einem volkswirtschaftlichen Thema durchwegs rein privatwirtschaftlich.
In der ganzheitlichen, sprich volkswirtschaftlichen Logik, entscheidet nicht der Finanzanleger darüber, wohin das Geld fliesst, sondern diejenigen, die das Geld brauchen und real investieren: Die KMU finanzieren sich mit Bankschulden, Obligationen und Eigenkapital und nur ganz selten mit Aktien. Die Käufer von Einfamilienhäusern geben keine Aktien aus, sondern nehmen Hypotheken auf. Der Staat finanziert sich mit Staatsobligationen. Und auch börsenkotierte Grossunternehmen ziehen es im Zweifelsfall vor, festverzinsliche Schulden aufzunehmen, statt ihr Aktienkapital zu erhöhen.
Entsprechend sieht denn auch das Gesamtbild aus: An der Schweizer Börse Six wurde 2025 per saldo Anleihen im Wert von 32 Milliarden neu emittiert. Bei den Aktien war der Saldo in Anbetracht der vielen Kapitalrückzahlungen mit 3,7 Milliarden Franken sogar negativ. Das heisst: Wenn Schweizer Anleger – darunter die Pensionskassen – sagen, sie hätten in Aktien investiert heisst das bloss, dass sie andern Anlegern Aktien abgekauft haben. Neues Geld ist nicht in die Realwirtschaft geflossen.
Die Pensionskassen müssen ihr Geld zwar nicht in der Schweiz investieren; sie können sich auch auf den globalen Märkten bedienen und Aktien kaufen. Doch auch hier sieht das Gesamtbild nicht gut aus. Das Nettoauslandvermögen der Schweiz liegt aktuell bei rund 1000 Milliarden Franken. Doch im Schnitt der letzten fünf Jahre betrug die jährliche Nettorendite nur gerade gut 3 Milliarden. Das sind 3 Promille. Volkswirtschaftlich gesehen sind Auslandinvestitionen kein gutes Geschäft.
Zwei Effekte
Doch wie verträgt sich dieses ernüchternde Gesamtbild mit der Tatsache, dass die Schweizer Pensionskassen im Schnitt doch immerhin gut 30 Prozent in Aktien investiert und dass diese seit 1985 eine Rendite von gut 7 Prozent abgeworfen haben?
Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: den Bitcoin- und den Hebeleffekt.
Wenn mehr gespart wird als real investiert werden kann, dann kaufen sich die Sparer gegenseitig ihre Wertpapiere ab und treiben damit deren Preise hoch – und weisen eine entsprechend hohe Rendite aus. Oder sie erfinden in ihrer Anlagenot neue Wertpapiere wie den Bitcoin und «investieren» ihre Ersparnisse dort.
Hätte die «Sonntags-Zeitung» die Rechnung mit Bitcoins statt mit Schweizer Aktien gemacht, dann wären aus jeder Milliarde, die unsere Pensionskassen vor zehn Jahren investiert haben, rein rechnerisch deren 190 Milliarden geworden. Und alle würden sofort begreifen, dass es sich hier um einen «Trugschluss der Komposition» handeln muss.
Nun zum Hebeleffekt. Wenn eine Investition eine Rendite von 3 Prozent abwirft, Kredite aber nur 2 Prozent Zins kosten, dann steigt die Eigenkapitalrendite mit der Höhe der Schuldenfinanzierung. Um eine Eigenkapitalrendite von 7,6 Prozent (siehe oben) zu erreichen, braucht man gut 80 Prozent Fremdfinanzierung. Das heisst: Für jede Million, die 7,6 statt bloss 3 Prozent einbringen soll, müssen andere Anleger gut 4 Millionen investieren, die nur 2 statt 3 Prozent einbringen. Das ist volkswirtschaftlich gesehen kein Gewinn, sondern reine Umverteilung.
Die «Sonntags-Zeitung» hätte seine Rechnung auch mit Immobilienfonds machen können. Diese haben laut «NZZ» in den vergangenen fünf Jahren «annualisierte Gesamtrenditen von 8 bis über elf Prozent» erzielt. Jeder Prozentpunkt zusätzlicher Investitionen in Immobilien statt in Obligationen hätte dann nicht bloss 8,4, sondern gut 10 Milliarden mehr eingebracht. Doch damit wäre auch klar geworden, wer hier «im Schlaf enteignet» wird. Nämlich nicht – wie die «Sonntags-Zeitung» insinuiert – das Pensionskassen-Mitglied, der um eine höhere Rendite geprellt wird, sondern der Mieter, der dafür bluten muss.
Noch eine andere Geschichte
In der gleichen «Sonntags-Zeitung» steht über ganze zwei Seiten noch eine andere Geschichte, die auf demselben Irrtum beruht. Danach reicht es, zehn bis siebzehn Jahre lang gleichzeitig gut zu verdienen und brutal zu sparen, damit man für den Rest des Lebens von den vier Prozent Rendite auf 2,16 Millionen Franken Erspartem leben kann.
Auch das ist gut gerechnet, aber dumm gedacht. Unser Wohlstand beruht darauf, dass wir etwa 45 Jahre lang arbeiten und mit unserem Konsum die nötigen Jobs schaffen. Wenn nun nur schon alle «Sonntags-Zeitungs»-Leserinnen und -Leser nur noch zehn bis siebzehn Jahre arbeiten und in dieser Zeit nur noch das allernötigste konsumieren würden, dann wäre die Schweiz in Kürze pleite. Es wäre dann auch niemand mehr da, der die vier Prozent Rendite erwirtschaftet oder mit seiner Miete finanzieren würde.
Es ist kaum anzunehmen, dass die Autoren dieser Texte, geschweige denn der «Kronzeuge», Finanzprofessor Thorsten Hens, diese Zusammenhänge nicht kennen. Doch warum vertreten sie dennoch allen Ernstes die These, dass sich die Schweizer Bevölkerung weniger Sorgen um ihre Rente machen müsste, wenn die Pensionskassen bloss «unsere Vorsorgegelder» besser investieren und mehr aus dem «dritten Beitragszahler» herausholen würden?
Liegt es daran, dass es den «Sonntags-Zeitungs»-Blattmachern schwerer fallen würde, knackige Schlagzeilen wie «Man wird im Schlaf enteignet» oder «Unsere Renten schrumpfen, weil die Pensionskassen falsch anlegen» zu formulieren? Oder am ganzseitigen Inserat des Vorsorgeanbieters Axa? Oder spielt es auch eine Rolle, dass Hens’ Lehrstuhl vom Swiss Finance-Institute (SFI) mitfinanziert wird, also von der Finanzindustrie, die davon lebt, dass viel und riskant investiert wird?
Klar: Lobbys kämpfen für ihr Geschäft. Aber müssen sich die Medien und die Universitäten dabei einspannen lassen?
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





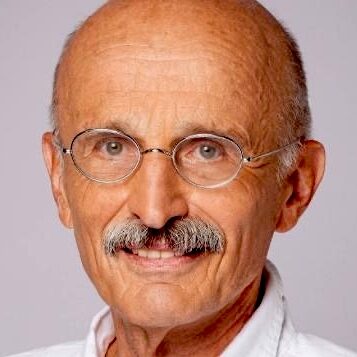





Und wenn es generell um die höhere Rendite geht, könnten auch Investitionen in Immobilien mit ihren astronomischen Wertsteigerungen zitiert werden – die gleichzeitig deutlich machen, wie der Rendite-Quell 2. Säule zur Verarmung beiträgt: Was hat man von der Inflation all der zitierten Vermögenswerte und ihrer Renditen, wenn die Kaufkraft rasant ausgehöhlt wird?
Ausgezeichneter Artikel von Werner Vontobel.
Es fehlt einzig der Hinweis, dass unsere Renten u.a. auch deshalb schrumpfen, weil sich die Finanzindustrie an den hunderten von Milliarden von Vorsorgegeldern ungehindert eine goldene Nase verdient bzw. verdienen kann Dies wiederum ist nur möglich, weil betr. Verwaltungskosten der 2. Säule keinerlei griffige Regulierungen bestehen!
Das Rattenrennen um eine hohe (PK-) Rente treibt die Pensionskassen immer stärker in die Arme der Finanzindustrie. Wie der Autor des Artikels schlüssig aufzeigt, gelingt eine solche Rendite nur solange in einem Umfeld wie: a) Das Klima für Aktien intakt ist und b) eine Mehrzahl auf die gleichen Blue Chips im Markt setzen und so, die Preise und die Aktienrenditen in die Höhe treiben. Kaum abzusehen wie die Renten aussehen, wenn der Markt von Spekulanten aufgeblasen wird und platzt, oder wenn eine hartnäckige Bässe die Papiere erfasst. Dann möchte ich nicht wenige Jahre vor der Pensionierung stehen, weil dann unweigerlich auch die Renten drastisch zusammengestrichen werden müssen. Eigentlich ist es einfach: «There is no free lunch!» Jemand muss arbeiten, damit überhaupt eine Rente ausbezahlt werden kann. Alles andere ist reine Spekulation. Daher finde ich, dass das Umlageverfahren (AHV) dem Kapitaldeckungsverfahren (Pensionskassen) haushoch überlegen ist oder lieber den Spatz in der Hand
Immer wieder erfrischend, solche Beiträge. Die der Infosperber oft nur durch konsequente «Dreisatzrechnung» bewerkstelligt!! OHNE jede Ironie. Bin großer Fan….und Leid geplagt von den etablierten Medien, nicht nur mangels Dreisatz – gerne werden auch die englischen Billions zu EU Billionen, oder Statistiken ohne Achsenbeschriftung usw. Ja genau …bin Ing. 🙂 🙂 !!
Diesen Artikel sollte man in Wirtschaftskunde (oder wie immer der Gegenstand woanders heißt) durcharbeiten.
Sehr geehrter Herr von Tobel
Zur Komposition gehört aber auch noch die Tatsache, dass DIE Schweiz (wer auch immer ?) im Ausland mit derzeit im Wert von knapp 2 Billionen (europ.) CHF verschuldet ist.
[ Fakt ist mit «SNB Schweiz Auslandsverschuldung» abrufbar. ]
Wer kann verschudet sich in weniger solden Fremdwährungen wie USD, EURO, YEN, GBP und zahlt die Schulden im immer weiteren Kursgwinn mit CHF zurück. Die höheren Schuldzinsen in den Fremdwährungen sind gegenüber dem CHF irrelevant, weilja wie oben genannt, die CHF-Investitionen in CHF-Aktien u. -Immobilien im Tauschwert hoch rentierlich sind.
Eine hohe Kreditwürdigkeit lohnt sich jedenfalls viel mehr als eine hohe Lohnarbeits-Leistung.
Norweger haben hohe Renten aus Dividenden, hauptsächlich durch sehr hohe Anlagen in Auslandsaktien. Durch den Verkauf von NOK steigt der NOK- Tauschwert so auch so nicht Inlands-wirtschaftsschädlich für die Masse der Bevölkerung bei Exortüberschuss.
Dies sorgt auch dafür dass
Hä??