Sprachlupe: Lieber alt aussehen als «alt aussehen»
Es war nur eine kurze Bemerkung in den Sportnachrichten am Radio, und doch liess sie mir noch mehr graue Haare wachsen: «YB sah alt aus.» Die Berner Fussballer hatten gegen Lausanne 0:5 verloren. Da war «alt aussehen» gewiss bloss als Redewendung verwendet worden, ohne jeden Gedanken an Menschen, die buchstäblich alt aussehen, weil sie eben alt sind. Wem ebenso buchstäblich graue Haare wachsen, dem sollte ja auch eine dicke Haut gewachsen sein, diesmal sprichwörtlich gemeint: es nicht persönlich nehmen, wenn jemand «alt aussehen» ohne Bezug aufs Lebensalter sagt. Auf den Index verfemter Äusserungen braucht diese Redewendung nicht auch noch zu kommen, aber dass sie das Alter verunglimpft, liegt auf der Hand.
Ebenso gedankenlos wurde kürzlich Thomas Gottschalk nach einem verunglückten TV-Auftritt als «verwirrter Opa» tituliert oder letztes Jahr über einen Internet-Schwindel berichtet: «Das Grosi denkt, es habe ein Schnäppchen gemacht.» Enkel spielen da, ob vorhanden oder nicht, keine Rolle. «Alt aussehen» definiert der Redewendungen-Duden so: «einen schwachen, schlechten Eindruck machen; im Nachteil sein». Diese Bedeutung passt genau zur heutzutage verbreiteten Einstellung gegenüber dem tatsächlichen Alter. Geht es in der Werbung um Lebensphasen, so ist immer die Jugendlichkeit das Ideal. Das gilt sogar und erst recht dann, wenn Leute fortgeschrittenen Alters angesprochen werden sollen, nach dem Muster «… lässt Sie um Jahre jünger aussehen».
Alt fühlt man sich heute erst morgen
Selbst in einer Kontaktanzeige wirbt jemand meines Alters mit «jünger wirkender Ausstrahlung». Zuverlässig wirkt denn auch «du siehst aber jünger aus» als Kompliment. Es wird auch gern geglaubt; nach einer Berner Befragung von 2019* fühlten sich Menschen über 70 im Durchschnitt elf Jahre jünger, als sie waren, und nur gerade 15 Prozent von ihnen bezeichneten sich als alt; den Beginn des Alters setzten sie durchschnittlich auf 80 Jahre an. 1994 hatte eine ähnliche Befragung in Lausanne bei 70-Jährigen die mittlere Meinung ergeben, ab 69 sei man alt. Heute gelten Devisen wie «man ist so jung, wie man sich fühlt» oder «80 ist das neue 60». Dabei sehen solche Sprüche nachgerade alt aus.
Die Redewendung «alt aussehen» ist nicht alteingesessen. Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (dwds.de) beruht auf vielen elektronischen Textsammlungen, die sich auch einzeln abfragen lassen. Eine Stichprobe bei der «Berliner Zeitung» ab 1945 erbringt «alt aussehen» im übertragenen Sinn erstmals 1976 – schon da in einem Fussballbericht, aber noch in Anführungszeichen gesetzt. Erst in den Achtzigerjahren tritt die Redewendung etwas öfter auf; heute ist sie, auch in Schweizer Medien, häufiger gemeint als das tatsächliche Aussehen einer Person. Jemandes Aussehen «alt» zu nennen, könnte ja einfach realistisch sein, würde aber oft als abschätzig (miss)verstanden. So tief hat sich der Jugendkult schon in den Sprachgebrauch eingegraben.
Nicht alt genannt, aber so behandelt
So leichtfertig «jung» positiv und «alt» negativ bewertet wird, so verbreitet ist tatsächliche Altersdiskriminierung – allerdings ist sie auch zunehmend verpönt. In wohl zufälliger Häufung brachte kürzlich «Das Magazin» auf den ersten Seiten eine Klage über den widrigen Arbeitsmarkt für die letzten Berufsjahre, eine Kinderbelehrung über schonendes Reden mit Alten und die Feststellung einer Altersmedizinerin, «verbreiteter als Sexismus und Rassismus» sei Ageism. Sie veranschaulichte diese Kategorisierung so: «Wenn wir ältere Menschen generell als vulnerabel und innovationsfremd einstufen, alle Jüngeren dagegen als leistungsstark und innovativ.» Immerhin erlebe ich da eine positive Kehrseite: Jüngere bieten Älteren oft spontan Hilfe an.
Breiten Protest erntete das Politologie-Duo Vatter/Freiburghaus im Oktober, nachdem Tamedia über ein Interview folgenden Titel gesetzt hatte: «Das Wahlrecht ab einem gewissen Alter zu streichen, würde die Dominanz der Senioren brechen.» Rahel Freiburghaus hatte das zwar tatsächlich gesagt, aber weder empfohlen noch verworfen; sie erhielt in einem weiteren Interview die Gelegenheit zur Relativierung: «Mir ging es einzig darum, einen Ideenkatalog zu präsentieren.» Doch in seiner nächsten eigenen Kolumne, wiederum übers Abstimmungsverhalten, schrieb das Duo von der «Überalterung der Schweiz». Wie bei diesem Schlag-Wort üblich, blieb ungesagt, welches Mass denn da überschritten werde und ob das nicht mehr gesund, gerecht, erträglich oder was auch immer sei. So mass-los wird seit vielen Jahren über Überalterung dahergeredet.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Er hat Jahrgang 1946.
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





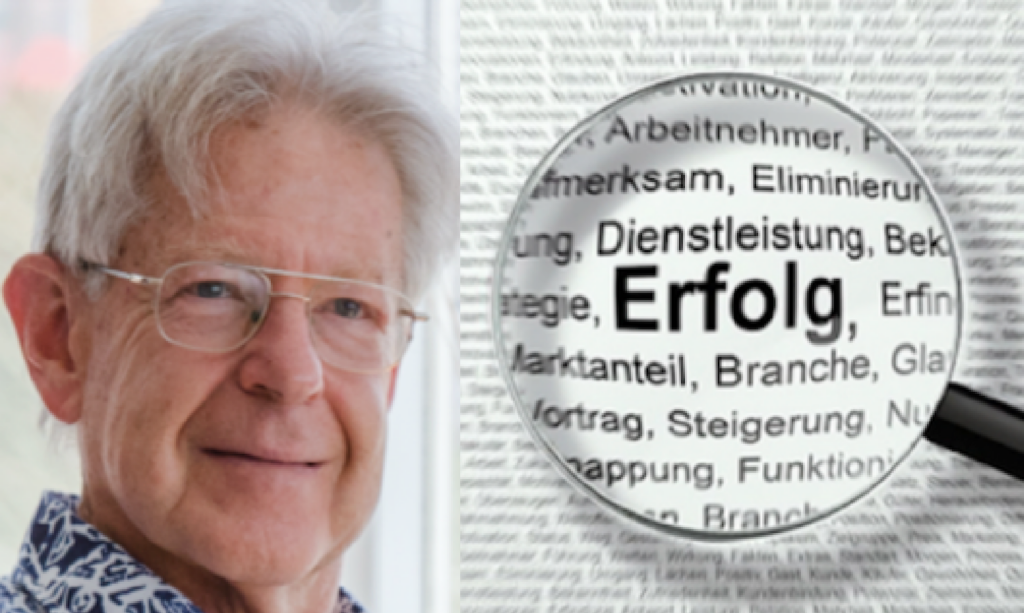




Der Umstand, dass Personen nicht sein wollen wie und was sie sind, schafft eine unlösbare Basis beschuldigt zu werden, jemanden zu beleidigen. Wird z.B. jemand in Bezug auf seine Hautfarbe, Alters- oder Staatszugehörigkeit, etc. genannt, wird es Betroffene geben, welche diese Bezeichnung als diskriminierend oder rassistisch empfinden.
Mit Bezug auf mein Empfinden (alter Greis, 75-Jährig) möchte ich Herrn Keuner (Berthold Brecht) zitieren:
Ein Mann, der Herrn Keuner lange nicht gesehen hatte, begrüsste ihn mit den Worten: «Sie haben sich gar nicht verändert.» «Oh!» sagte Herr Keuner und erbleichte.
Der venezianische Doge Enrico Dandolo führte als blinder 90-jähriger 1202 die Eroberung von Zara an und starb fast hundertjährig 1205. 84-jährig führte der berühmte Andrea Doria noch Flotten gegen nordafrikanische Piraten und starb 94-jährig im Jahre 1560. Von ebenso ungebrochener Lebenskraft war der französische Schauspieler Charles Vanel der 78 Jahre vor der Kamera stand, 96 Jahre alt wurde und bis zu seinem Tod als Schauspieler aktiv war. Gleiches gilt für den DDR-Schauspieler Herbert Köfer der hundertjährig im Jahre 2021 starb und ebenfalls bis zu seinem Tod seinem Beruf treu blieb – sein erstes Engagement war im Jahre 1940! Legendär auch Autor Sergej Michalkow – er schrieb 1942 im Alter von 29 Jahren den Text für die sowjetische Nationalhymne, im Alter von 64 Jahren schrieb er 1977 einen neuen Text (ohne Stalin) und im Jahre 2000 im Alter von 87 Jahren wiederum den heute gültigen Text ohne Lenin und Kommunismus. Er starb 2009 im Alter von 96 Jahren. Soviel zum ALT AUSSEHEN!
Kurz könnte man sagen:
alle wollen älter werden, aber niemand alt.