Sprachlupe: Schulenglisch und -französisch – beides intensiv
Es wäre doch so einfach: Da Englisch für Primarschüler einfacher und anregender zu lernen sei als Französisch, packen wir die Gelegenheit beim Schopf und unterrichten es allein, mit dem vollen für Fremdsprachen vorgesehenen Pensum. Dann ist Schluss, und für die ganze restliche Schulzeit kommt Französisch zum Zug – samt der neuen Erlaubnis, plaît auch ohne Circonflexe zu schreiben. Das Hauptziel des eidgenössischen Sprachenkompromisses wird so wahrscheinlich besser erreicht; opfern muss man nur die sakrosankten Zahlen 3 und 5 für die Schuljahre, in denen der Unterricht in einer anderen Landessprache sowie Englisch beginnt – oder umgekehrt, was derzeit die Absicht durchkreuzt, Schulwechsel innerhalb des Sprachgebiets zu erleichtern.
Pädagogen und Schulpolitiker werden nicht um Einwände verlegen sein, aber wo ein Wille wäre, gäbe es auch einen Weg. Im breiteren Publikum dürfte die Sorge überwiegen, nach einer Sekundarschule ohne Englischunterricht wären die vorher erworbenen Kenntnisse wieder weg. Aber warum denn? Kinder jeglichen Alters sind ja ohnehin in Werbung, Medien und sogar deutschen Texten dem Englischen en masse ausgesetzt, am Stück oder in Brocken. Dank dem einstweilen abgeschlossenen Unterricht werden sie es besser verstehen und einordnen können. Und gerüstet sein, wenn sie für einen Beruf das Fachenglisch lernen müssen, das in der Schule ohnehin nicht drangekommen ist.
Englisch-Fitness dank Starthilfe
In deutsch gemeinten Medientexten begegnen sie nicht nur englischen Wörtern, sondern sogar ganzen Satzfetzen. Sogar französische Ausdrücke – früher einmal geläufig – müssen oft den entsprechenden englischen weichen: Wer einst ein bestimmtes Niveau an Sprachkenntnissen erreichen musste, wird heute auf sein Level geprüft. Wo damals eine Dienstleistung als «Service» in französischer Aussprache angeboten wurde, redet heute ein Chatbot Duden-Hochdeutsch von «Sörviss». Bei der echt menschlichen Stimme, die dieses Wort im Schweizerdeutschen so aussprach, hat seither immerhin der französische Klang seinen Platz zurückerobert. Man geht nicht mehr zum Coiffeur (oder in Deutschland zum Friseur), sondern zum Barber im Barbershop, das kommt sogar in Paris vor; wenigstens führt Google die Damen, die so einen Barbier suchen, zuerst halbwegs deutsch zum «Damen Coiffeur». Hatte ein Kind Frühdeutsch, dann weiss es, dass da ein Bindestrich hineingehört. Im Sportteil ist mir neulich ein Double aufgefallen, das nicht wie bisher französisch ausgesprochen einen doppelten Titelgewinn bedeutete, sondern englisch eine zweistellige Siegesserie.
Selbst in der Spitzengastronomie drängen sich englische Lesarten vor, quelle horreur! So liess ein Korrespondent (oder Korrektorat) den neuen französischen Premierminister ausgerechnet im Elyséepalast häufige «Dinners» mit der Präsidentengattin geniessen. Als das Blatt diese Gewohnheit wenige Tage später erneut erwähnte, fand es indes nicht zum Diner zurück, sondern sprach von der «Abendtafel». So bewies der Journalist, auch ein Sprachkünstler alter Schule zu sein; schliesslich ging es darum, dass Premier Lecornu «oldschool» sei. Aber zu früh gefreut: Im Magazin derselben Publikation stand ein Rezept für «Peach Melba», samt Erwähnung des Erfinders Escoffier, Stammvater der haute cuisine. Immerhin gehörte das Geschirr, das er (und Madame Macron) verwenden, zu einem Service, das uns der Duden französisch aussprechen lässt.
«Aber Französisch können wir!»
Wie wohltuend, vor nicht allzu langer Zeit zu lesen: «In den aussenpolitischen Kreisen Washingtons ist die Gegnerschaft zu Russland und dessen Machthaber Wladimir Putin ‹de rigueur›». Aber eben, tempi passati. Nach der obligatorischen Schulzeit verstehen das hoffentlich alle, auch wenn sie nur eine der gerade verwendeten Landessprachen in der Schule gelernt haben. Sollten sie im Journalismus landen, so blieben uns wohl einige der Fehler erspart, die sich in etliche der rar gewordenen französischen Ausdrücke einschleichen. Bei Englisch hat es bereits gebessert; jedenfalls ist mir schon lange kein «looser» mehr begegnet, mit dem ein Verlierer (mit nur einem o) gemeint war, nicht etwa jemand lockererer (mit zwei o und scharfem s).
Kann eine Landessprache Fremdsprache sein?
Compatriotes klagen zuweilen, es sei unpassend, für andere Landessprachen als die eigene das Wort Fremdsprache zu verwenden. Das kommt wohl davon, dass so eine Sprache in der Übersetzung das Adjektiv «ausländische» bekommt: étrangère/straniera/straniera. Und das ist gleich doppelt falsch: Weder ist jede Sprache, die nicht meine ist, ausländisch, noch weicht jede ausländische Sprache von meiner Muttersprache ab (Romanischbündner beide Male ausgenommen). Logischer wäre daher die Forderung, in den lateinischen Sprachen etwas ohne «ausländisch» zu sagen, wenn andere Landessprachen gemeint sind.
Sollten wegen des Unterbruchs in der Sekundarschule wieder mehr Englischfehler auftauchen, tant pis! Als ich so einen Fehler – sehr lang ist’s her – einer Korrektorin gemeldet hatte, entgegnete sie: «Aber Französisch können wir!» Schön wär’s schon damals gewesen, aber es könnte doch noch wahr werden, wenn es dannzumal noch Korrektorate gibt.
Weiterführende Informationen
- Indexeintrag «Anglizismen» in den «Sprachlupen»-Sammlungen: tiny.cc/lupen1 bzw. /lupen2, /lupen3. In den Bänden 1 und 2 (Nationalbibliothek) funktionieren Stichwortsuche und Links nur im heruntergeladenen PDF.
- Neues Buch von Daniel Elmiger zum Thema, PDF gratis (Open Access)
 Quelldatei für RSS-Gratisabo «Sprachlupe»: sprachlust.ch/rss.xml; Anleitung: sprachlust.ch/RSS.html
Quelldatei für RSS-Gratisabo «Sprachlupe»: sprachlust.ch/rss.xml; Anleitung: sprachlust.ch/RSS.html
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





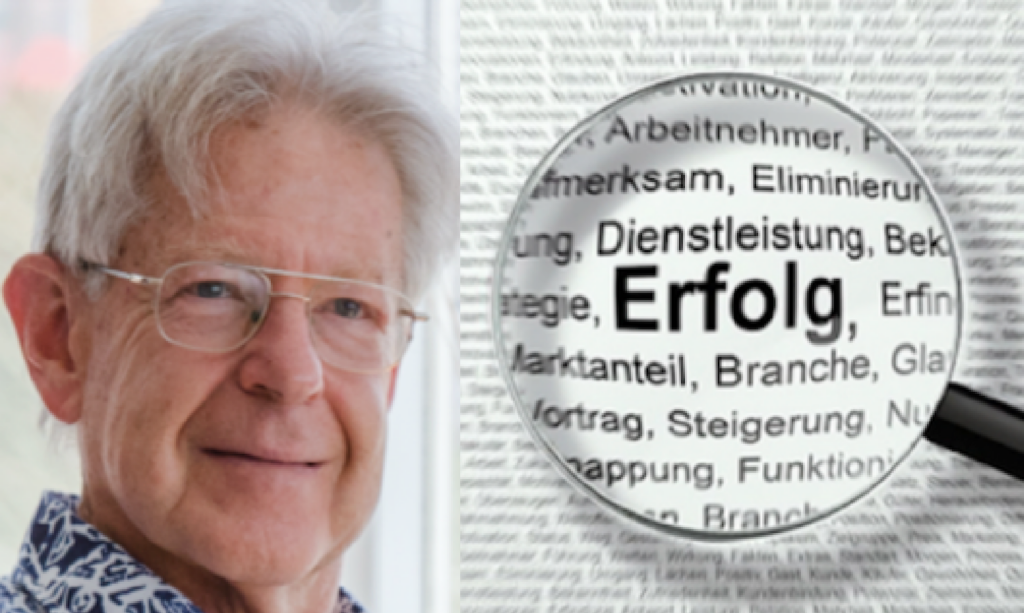




Mehrere Fremdsprachen fließend zu beherrschen, galt früher einmal als Zeichen hoher Intelligenz, Weltgewandtheit und als Voraussetzung für hohe Laufbahnen: Der deutsche Botschafter in Russland, Lambsdorff, in westlichen Machtkreisen sozialisiert, spricht kein Wort Russisch wohingegen der russische Botschafter in Deutschland, Netschajew, gar Germanist ist. Statt sich als Reisender wenigstens auf niedrigem Niveau um die Landessprache zu bemühen, zücken die meisten das Smart Phone und lassen von Google übersetzen. Ganze Kongresse werden mittlerweile von KI-gestützen Programmen übersetzt. Ein weitgefasstes Sprachverständnis, früher überlebensnotwendig, ist heute nicht mehr nötig. In der k.u.k.-Monarchie mit ihren vielen Völkern sprachen einfache Leute teilweise 3, 4 Sprachen flüssig, weil es anders gar nicht ging.
Das deutsche Auswärtige Amt hat am 25.7.2025 ein Interview mit Lambsdorff zu seinen Russischkenntnissen veröffentlicht. Im Internet zu finden, wenn man nach «Interview von Botschafter Graf Lambsdorff mit RTVI» sucht.
Die meisten russischen bzw. sowjetischen Botschafter in D, DDR und A sprachen flüssig Deutsch. Netschajew spricht ebenfalls flüssig und gewandt. Weil das in Russland Voraussetzung für eine derartige Laufbahn ist; russisches Diplomaten-Personal ist traditionell auf hohem Niveau ausgebildet. Lambsdorff besitzt allenfalls rudimentäre Kenntnisse und das ist für solch einen Posten ungenügend. Er ist fest in NATO- und US-Netzwerken sozialisiert und hat keinen Russland-Bezug, siehe Nachdenkseiten «Wie transatlantische Netzwerke die deutsche Politik beeinflussen» vom 19.12.2024 – ganz unten Personenliste, sowie «Anti-Spiegel»: «Wie Russland den deutschen Botschafter in Moskau auflaufen ließ und was das bedeutet» vom 2.5.2025
Festzuhalten ist, dass Otto von Bismarck, preußischer Gesandter in St. Petersburg von 1859 – 1862, in kürzester Zeit das Russische erlernte und Turgenjew im Original lesen konnte.
Eigentlich sollte es an der Primarschule erste Priorität sein, Deutsch zu lernen. Da herrscht zurzeit ein beträchtlicher Nachholbedarf.