Kommentar
Wie die «NZZ» die Ungleichheit verschwinden lässt
Der jüngste dieser Beiträge trägt den Titel «Ungleichheit wird zu einem modernen Fetisch». Ein schwedischer Ökonom namens Daniel Waldenström behauptet, dass diese «falsche Diagnose» einer wachsenden Ungleichheit für Politik und Wirtschaft «verheerende Folgen» habe. Das ist starker Tobak.
Doch warum sollte die Diagnose der Ungleichheit falsch sein?
Und welche konkreten verheerenden Folgen sollte diese Diagnose haben?
Die zweite Frage beantwortet Waldenström so: «Untaugliche Rezepte lassen sich nur verhindern, wenn man von einer verlässlichen Datenlage ausgeht. Anderenfalls droht der Griff in den historischen Giftschrank: Regierungen könnten geneigt sein, wieder Preiskontrollen einzuführen, Vermögen zu beschlagnahmen und den Wirkungskreis des Staates trotz sinkender Einnahmen auf immer mehr Bereiche auszudehnen.»
Richtig daran ist, dass die zunehmende Ungleichheit in der Tat Forderungen nach mehr Sozialleistungen und Mietpreiskontrollen befördert. Warum das für wen giftig sein soll, erläutert Waldenström allerdings nicht. Das weiss «man» einfach.
Nun zur Frage, warum die Diagnose einer zu hohen Ungleichheit falsch sein soll und wie sich die verlässliche Datenlage präsentiert. Zum einen legt Waldenström grossen Wert auf die – unbestrittene – Feststellung, dass die üblicherweise verwendeten Statistiken fehlerhaft seien. So werde etwa ein Student in der Einkommensstatistik als arm registriert, obwohl er auf Kosten seiner Eltern ein luxuriöses Leben führe und schon bald mit einem sechsstelligen Einkommen rechnen könne. Und in der Statistik der Vermögensverteilung würden die Guthaben bei den Pensionskassen nicht ausreichend berücksichtigt. Stimmt beides. Aber es verändert die Datenlage bestenfalls minimal.
Es geht nicht nur ums Geldeinkommen
Ein anderes Argument, das in solchen Texten immer wieder ins Feld geführt wird, ist die Behauptung, wonach die Konzentration der Vermögen und der Einkommen «im letzten Jahrhundert nicht zugenommen, sondern abgenommen» habe. Auch das stimmt, ist aber grob irreführend, weil sich der Vergleich nur auf die reinen Geldeinkommen bezieht. Diese haben noch in den ersten Nachkriegsjahrzehnten eine relativ geringe Rolle gespielt. Der Grossvater des Schreibenden etwa hat in den 1950er Jahren zwar nur wenige Hundert Franken verdient, aber die Familie hatte zwei Ziegen, dreissig Hühner und einen Gemüsegarten. Der Grossvater legte beim Hausbau selber Hand an. Die Grossmutter nähte die Kleider der ganzen Familie. Sie brauchte keinen Pizzakurier und keine Kita. Und – weil die Wege kurz waren – auch kein Auto. Die beiden hatten ein bescheidenes Geldeinkommen. Aber sie konnten damit fünf Kinder grossziehen und allen eine Berufsausbildung ermöglichen.
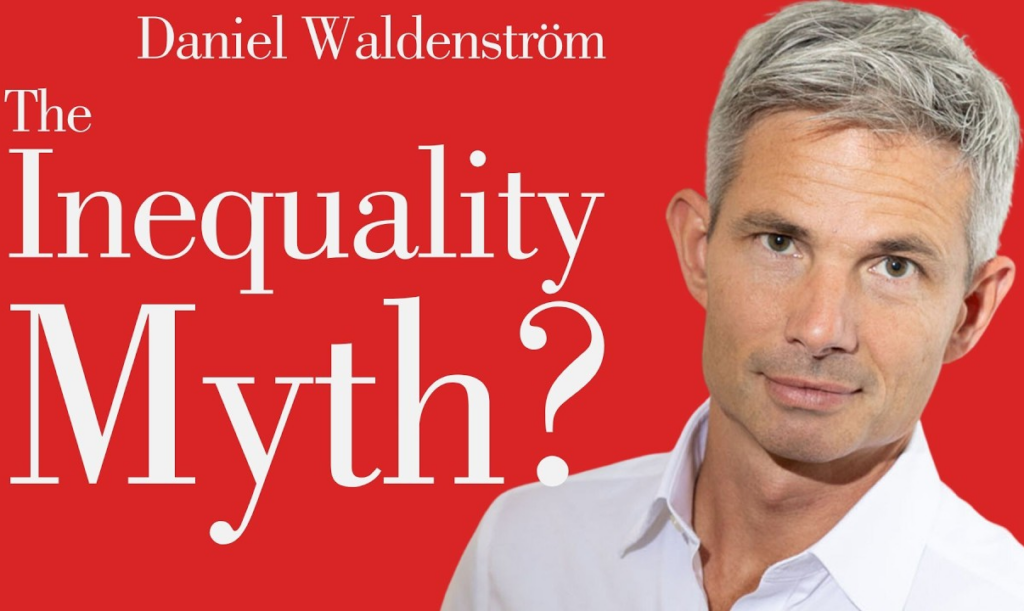
Und noch so ein hinkender Vergleich von Waldenström: «In den Vereinigten Staaten ist der Anteil des obersten Prozents am Einkommen nach Steuern heute nur geringfügig höher als 1960.» Konkrete Zahlen nennt der Ökonom nicht, doch gemäss der Word Inequality Database betrug dieser Anteil 1960 noch 12,7 Prozent aller Einkommen. Heute sind es schon 20,7 Prozent. Auf dem Tiefpunkt 1976 waren es noch 10,4 Prozent. Seither ist der Wert auf ziemlich genau das Doppelte gestiegen.
Laut der amerikanischen Tax-Foundation hat das am besten verdienende Prozent sagenhafte 22,4 Prozent der versteuerten Einkommen kassiert. Das ist fast doppelt so viel die wie ärmsten 50 Prozent zusammen. Diese Zahlen beziehen sich auf die Einkommen vor Steuern. Doch weil der Spitzensteuersatz seit 1960 von 91 auf 37 Prozent gesunken ist, dürfte die von Waldenström angesprochene Ungleichheit nach Steuern noch viel stärker zugenommen haben. Von einer bloss geringfügigen Veränderung kann also keine Rede sein.
Seltsame Schlüsse
Auch punkto Vermögen geizt Waldenström mit konkreten Zahlen und Quellen. Lieber zieht er aus seinen spärlichen Angaben seltsame Schlüsse: «In Europa besitzt das oberste Prozent heute kaum noch einen Drittel des Anteils, den es 1910 hielt. Seit den 1970er Jahren ist dieser Anteil im Wesentlichen unverändert geblieben, obwohl sich das inflationsbereinigte Vermögen verdreifacht hat. Die dominierende quantitative Tatsache beschreibt also eine dramatische Vermögensangleichung.» Wie bitte?
Stellen wir dem einfach mal die offizielle Statistik der Vermögensverteilung in der Schweiz gegenüber. Danach besitzen die reichsten 0,4 Prozent der Steuerzahler 36 Prozent aller Vermögen. Um die Jahrtausendwende waren es «nur» rund 27 Prozent. Zumindest in der Schweiz kann also von einer «dramatischen Vermögensangleichung» keine Rede sein.
Dennoch hat Waldenström recht, wenn er schreibt: «Haushalte aller Einkommensschichten halten heute mehr Kapitalanlagen als je zuvor. Die Beteiligung an den verschiedenen Anlagemärkten ist heute so breit gestreut, dass frühere Generationen nur staunen könnten.» Stimmt. In der Generation der Gross- und Urgrosseltern besassen nur ganz wenige Aktien und Optionen, geschweige denn Bitcoins. Seit der Einführung des BVG-Obligatoriums sind fast alle Leute zumindest indirekt auf allen Anlagemärkten aktiv. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass heute die ärmere Hälfte aller Schweizer Steuerzahler nur gut 1 Prozent aller steuerbaren Vermögen hält. Selbst wenn man die – in den unteren Einkommenskategorien meist sehr bescheidenen – Guthaben aus der 2. Säule dazurechnen würde, besitzt die ärmere Hälfte der Bevölkerung wohl keine 4 Prozent.
Können sie auch besser leben?
Auch der Hinweis, dass die unteren Einkommensschichten heute länger leben und mehr konsumieren können als ihre Vorfahren, ist wohl nicht falsch. Zumindest ein kleiner Teil der riesigen Produktivitätsfortschritte ist auch ganz unten angekommen. Fast alle können heute mehr konsumieren. Doch können sie auch besser leben? Zweifel sind angebracht, wenn man bedenkt, dass man einst mit einem durchschnittlichen Arbeitseinkommen eine Familie mit fünf Kindern über die Runden bringen konnte, während heute schon zwei Kinder selbst für Doppelverdiener ein Armutsrisiko sind.
Waldenström gibt zu: «Wohnraum ist markant teurer, die Vermögen der Superreichen wachsen in den Himmel, Covid hat klaffende Löcher ins Auffangnetz des Sozialstaates gerissen.» Und: «Ja, Superstarunternehmer haben gigantische Vermögen angehäuft.» Doch für Waldenström ist dies «ein Zeichen für Erfolg, nicht für Misserfolg. Diese Leute haben Waren und Dienstleistungen bereitgestellt, die Millionen Menschen freiwillig gekauft haben. Ihre boomenden Unternehmen sorgen auch für Arbeitsplätze, höhere Löhne und erhebliche Steuereinnahmen – direkt durch Gewinne und Löhne und indirekt durch die Verbreiterung der Steuerbasis.»
Waldenström kommt also gar nicht erst auf die Idee, dass man das, was sich oben anhäuft, via höhere Löhne, tiefere Gewinnmargen und günstigere Preise nach unten fliessen lassen könnte. Von höheren Steuern ganz zu schweigen. Stattdessen sieht er die Lösung darin, dass auch die Normalverdiener mehr sparen, Vermögen anhäufen und dieses profitabel anlegen. «Der nachhaltigste Weg zu mehr Gerechtigkeit im Westen besteht daher darin, die Kanäle zu erweitern, über die normale Haushalte Vermögen erwerben können – darunter bezahlbarer Wohnraum, übertragbare Rentenversicherungen und kostengünstige Indexfonds.»
Abgehoben
Dieser Vorschlag zeigt, in welcher abgehobenen Welt der Ökonom Waldenström lebt und denkt und für welche Kundschaft das Finanzblatt «NZZ» schreibt: Klar, wer jeden Monat 1000 oder 2000 Franken steuerfrei in eine Rentenversicherung oder in einen Indexfonds mit 3 Prozent Nettorendite investiert, der hat bei der Pensionierung ein Vermögen von 1,5 beziehungsweise 3 Millionen Franken angehäuft und Anrecht auf eine Rente von 6000 beziehungsweise 12’000 Franken. Wer sich hingegen bei einem Einkommen von 5000 Franken und 2000 Franken Miete bestenfalls 100 Franken vom Mund absparen kann, der bezahlt seine mageren Ersparnisse mit einem stressigen Leben und einer ruinierten Gesundheit.
PS. Im Abspann zu Waldenströms Text steht dieser Satz: «Den Reichtum an sich einzudämmen, ist nicht zielführend. Stattdessen gilt es politische Institutionen zu schützen und einen gerechten Zugang zu öffentlichen Gütern zu gewährleisten.» Das ist ein interessanter Ansatz. Waldenström hat ihn nicht weiter ausgeführt.
Das hat an seiner Stelle der Kollege Michael J. Sandel, Professor für Regierungslehre an der Harvard-University getan. Im Buch «Die Kämpfe der Zukunft» schreibt er: «Die Einkommens- und Vermögensverteilung so lassen, wie sie ist, aber Wirtschaft und Gesellschaft so dekommodifizieren, dass Geld nicht mehr so wichtig ist. Nehmen wir etwa an, menschliche Grundgüter – Bildung, Gesundheitsversorgung, Wohnraum, Teilhabe – liessen sich vom Markt abkoppeln. Der einzige Vorteil des Reichtums läge dann darin, sich Yachten, Kaviar und Schönheitsoperationen leisten zu können.»
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





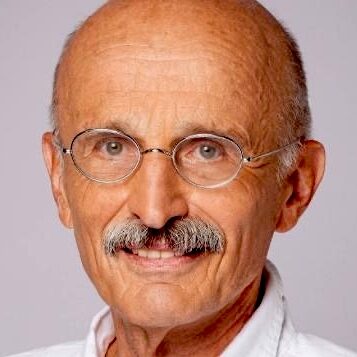





Elon Musk hat sehr schön demonstriert, was Superreiche mit ihrem vielen Geld wollen: Macht.
Für Yachten, Kaviar und Schönheitsoperationen braucht man wohl nach Normalverdienermassstab «viel» Geld. Aber bei weitem keine dreistelligen Milliardenbeträge. Solche Vermögensanhäufungen sind absolut nutzlos, ausser der Besitzer will damit Macht ausüben. Eine demokratische Gesellschaft hat gute Gründe, dies zu verhindern.