Kommentar
Wir sollten mehr auf Historiker als auf Ökonomen hören
Den Beginn der Debatte in der «Neuen Zürcher Zeitung» markierte das Interview von Katharina Fontana mit dem Historiker Oliver Zimmer. Zimmer sagte: «Solange die unteren 50 Prozent der Bevölkerung vom Wachstum nicht profitieren, sondern sich für sie das Wohnen verteuert und es im Land immer enger wird, belastet das den Gesellschaftsvertrag.»
Und: «Ein grosser Teil des Establishments unterstützt die Personenfreizügigkeit, und zwar über das Mass hinaus, wo deren Nachteile für den Durchschnittsbürger offensichtlich werden. Gewisse Politiker vertreten jene 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung, die dank der Zuwanderung von ihrer Land- oder Immobilienrente profitieren und immer wohlhabender werden.»
Inzwischen hat Wirtschaftsredaktor Hansueli Schöchli, ein weiteres Schwergewicht bei der «NZZ», zweimal zurückgeschlagen: «Der mittlere Reallohn (Median) wuchs (vom Beginn der Personenfreizügigkeit 2002 bis 2022, die Red.) um total gut 14 Prozent. (…) Immerhin ist die Produktivität pro Arbeitsstunde in der Schweiz von 2002 bis 2022 laut einer vom Bund bestellten Studie um gut 20 Prozent gewachsen, womit die Schweiz Rang 3 unter 8 europäischen Vergleichsländern belegte. (…) Alles in allem hat die hohe Einwanderung in den letzten zwanzig Jahren zumindest nicht verhindert, dass die Produktivität und der Wohlstand in der Schweiz deutlich gestiegen sind und dass die Löhne oben, unten und in der Mitte zugelegt haben.»
Ungleichheit hat zugenommen
Schöchli räumt zwar ein, dass die Ungleichheit seit 2002 zugenommen hat und dass es die weitaus grössten Lohnanstiege bei den obersten zwei Prozent gegeben habe. Er meint aber, dass dies wenig bis nichts mit der Einwanderung zu tun habe, sondern «eher mit Veränderungen bei der Vergütung von Spitzenmanagern (und) den stärker global ausgerichteten Unternehmen». Stimmt. Aber genau das waren und sind auch die Bereiche, in die die gut bezahlten Arbeitskräfte eingewandert sind.

Inzwischen hat der NZZ-Chefökonom nachgedoppelt und die These zu widerlegen versucht, wonach die «Reichen nur deshalb so reich sind , weil sie den Armen die Butter vom Brot nehmen». Dahinter stecke die «falsche Vorstellung des Wohlstands als Nullsummenspiel». Er illustriert das mit zahlreichen historischen Beispielen, die letztlich aber nur zeigen, dass auch die Armen vom allgemein wachsenden Wohlstand profitiert haben – wenn auch viel weniger.
Die Butter bleibt zwar auf dem Brot der Armen, aber es hätte mehr sein müssen und dieses «Mehr» ist den Reichen zugeflossen. Selbstverständlich ist die Marktwirtschaft ein Nullsummenspiel: Der Mehrwert einer Firma kann immer nur einmal verteilt werden – an die Aktionäre, an das Kader und an das Fussvolk. Wenn die Aktionäre und das Kader Millionen kassieren, bleiben dem Fussvolk nur noch Brosamen.
Was wäre gewesen, wenn? Und was geschieht, wenn wir den Vertrag, das «Paket EU-CH», ablehnen? Wir können es nicht wissen. Unter dem Strich geht es darum, ob es dem Durchschnitts-Schweizer und der Durchschnitts-Stimmbürgerin so schlecht geht, dass wir eine wirtschafts- und gesellschaftspolitische Kursänderung wagen sollten oder nicht.
Es geht ums Gesamtbild
Doch diese Frage kann nicht allein mit dem Hinweis auf ein paar volkswirtschaftliche Daten beantwortet werden. Vielmehr müssen wir das Gesamtbild ins Auge fassen. Es geht um die Alternative zwischen einer national und lokal organisierten Wirtschaftsordnung oder einem weiteren Schritt in Richtung des neoliberalen Globalismus.
Kurze Auslegeordnung: Unsere wirtschaftlichen Tätigkeiten finden in drei Sphären statt – geldlos in der Familie und Nachbarschaft, in der Binnenwirtschaft und im Rahmen des globalen Standortwettbewerbs. Bei Letzterem geht es darum, die fetten Glieder der globalen Wertabschöpfungsketten zu besetzen.
Das heisst: Produziere dort, wo die Löhne niedrig sind; verkaufe dort, wo die Kaufkraft hoch ist. Stilisiertes Beispiel: Rund 80 Prozent der Arbeit, die in einem On-Schuh steckt, werden mit zwei Franken die Stunde bezahlt. Verkauft wird der Schuh in der Schweiz, deren Binnenwirtschaft einen mittleren Stundenlohn von 70 Franken generiert. Das erlaubt es On, für die übrigen 20 Prozent der Arbeit 200 Franken zu kassieren und eine üppige Dividende auszuschütten. Alle drei On-Gründer haben beim Börsengang einen dreistelligen Millionenbetrag kassiert.
Hochverdiener in die Schweiz
Dieser Standortwettbewerb sorgt dafür, dass die zehn reichsten Prozent etwa ein Drittel der Kaufkraft abschöpfen können. Unsere Wirtschaftspolitik zielt darauf ab, mit tiefen Steuern möglichst viele dieser Hoch-Verdiener in die Schweiz zu locken.
Dabei gibt es zwei Probleme: Erstens steigen die Mieten auf ein Niveau, das zwar der Kaufkraft der Hochverdiener entspricht, viele Normalverdiener aus der Binnenwirtschaft aber in Nöte bringt. Zweitens zwingt diese Konzentration der Kaufkraft die globale Unterschicht dazu, ebenfalls mobil zu werden, damit sie von den Brosamen unter den Tischen der Reichen leben kann.
Jeder Superverdiener, der in die Schweiz zieht, beansprucht die Arbeitskraft von mehreren Bauarbeitern, Nannys, Uber-Fahrern et cetera, die ebenfalls in der Schweiz wohnen müssen.
Kleine Ironie am Rande: Die «NZZ»-Redaktion hat den Text von Schöchli mit dem Bild eines Bauarbeiters illustriert. Legende: «Viele Branchen wie der Bausektor sind stark auf Zuwanderer angewiesen.» Dabei gilt eigentlich: Ohne Zuwanderung braucht es nicht halb so viele Bauarbeiter.
Der Globalismus schwächt uns
Und dann ist da noch etwas: Die Flexibilität und die Mobilität, die uns der neoliberale Globalismus abfordert, schwächt die Produktions- und Integrationskraft der Familien und der Nachbarschaften. Mit der Folge, dass die von der Familie isolierten Grosseltern früher ins Altenheim ziehen und dass Kleinkinder heute mit hohem Zeit- und Finanzaufwand in Kitas gehütet werden müssen.
Zudem ist statistisch erwiesen, dass Einsamkeit noch vor Rauchen und Übergewicht der grösste gesundheitliche Risikofaktor ist. Alle diese Kosten sind real, aber weil sie von keiner offiziellen Statistik beziffert werden, hat Schöchli sie ignoriert.
Müssen wir deshalb den Kapitalismus überwinden? Nein, es gibt auch Spielarten des Kapitalismus mit einem starken Staat, der die Macht der Märkte eindämmt und zivilisiert. Auch heute noch werden gut 80 Prozent der bezahlten Arbeit auf dem Binnenmarkt erbracht. Von Einheimischen für Einheimische. Statt vorrangig den Standortwettbewerb gewinnen zu wollen, könnten wir auch die Möglichkeiten des Binnenmarkts besser ausschöpfen.
In den ersten drei Nachkriegsjahrzehnten hat das gut funktioniert. Damals sprach man noch von Volks-Wirtschaft oder National-Ökonomie. Wirtschaftspolitik für das Volk und für die Nation. Heute sind die Namen zwar geblieben, aber aus den Nationen sind Standorte geworden.
Gewiss. Die Rückkehr zu einer mehr lokal und national orientierten Gesellschaftspolitik ist mit Risiken verbunden. Wir müssen uns teilweise aus unseren globalen Verflechtungen lösen und können nicht einfach die Rezepte von früher kopieren. Aber ein nüchterner, nicht von den offiziellen Statistiken verstellter Blick auf die Verfassung unserer Gesellschaft zeigt, dass wir allen Anlass haben, uns dieser Diskussion zu stellen. Und ein Blick in die «NZZ» zeigt, dass wir dabei nicht nur auf Ökonomen, sondern auch auf Historiker, Soziologen und Politologen hören sollten.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





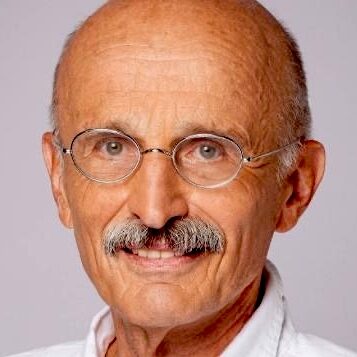




Es geht ja nicht nur um die Schweiz und ihre Schweizer. Auf lange Sicht ist doch unvorstellbar, dass die Schweiz eine Insel inmitten Europa bleibt. Das ist ja nicht einmal Hong-Kong gelungen. Wir sollten in Europa mitwirken für eine bessere Demokratie und bessere Löhne für den Niedriglohnsektor. Da sind wir nicht alleine.
«Reicher Mann und armer Mann
standen da und sah’n sich an.
Und der Arme sagte bleich:
Wär‘ ich nicht arm, wärst Du nicht reich!»
(Bertold Brecht)
Werner Vontobel gilt als wirtschaftskritisch und gesellschaftspolitisch eher links bis linkskritisch. Er kommt damit bezüglich der ganz grossen politischen Fragen von EU-Verträgen und Personenfreizügigkeit zu gleichen oder ähnlichen Schlussfolgerungen wie die eher wirtschaftsfreundliche und gesellschaftspolitisch konservativ orientierte SVP. Das müsste den Parteien links der Mitte zu denken geben.
Es gibt einen einfachen Hebel, um die Zuwanderung zu reduzieren: Steuern für juristische Personen erhöhen, statt laufend zu reduzieren. Die Schweiz ist mit ihren tiefen Steuern zu attraktiv für Firmen. Der Zuzug von Firmen verursacht Zuwanderung von Arbeitskräften. 88 % der Migranten und Migrantinnen kommen in die Schweiz, weil sie hier einen Job gefunden haben.
Wieviele davon sind sogenannte ExPats die von Firmen ins Land geholt werden?
Dies ist eines der Kernübel da dies meist hochbezahlte Arbeitskräfte sind, die die Vermögensstrukturen ganzer Regionen komplett durcheinanderbringen.
Unter anderem weil Investoren dann „grundsanieren“ und die neuen Wohnungen spezifisch als Businesswohnungen für 10k+ pro Monat vermieten (inklusive Wäsche-, Putz- und Einkaufsservice).
Absurde Zahlen die sich die „heimische“ Bevölkerung schlicht nicht mehr leisten kann und dann weggedrängt wird. Nein ich bin nicht fremdenfeindlich. Nicht im geringsten. Aber ich habe einen ziemlich feinen Sinn für Gerechtigkeit.
Caritas Aktuelle Armutszahlen Schweiz (2023):
» − Armut: 708’000 Menschen sind in der Schweiz von Armut betroffen. Das entspricht 8,1% der
Gesamtbevölkerung. …
− Armutsgefährdung: 1.4 Millionen Menschen in der Schweiz sind armutsgefährdet. Das sind
alle Personen, die armutsbetroffen sind plus jene, die nur knapp über der Armutsgrenze leben.
Insgesamt sind 16,1% der Bevölkerung armutsgefährdet.
-Armut trotz Erwerbstätigkeit (“Working Poor”): Arbeit reduziert das Armutsrisiko zwar
deutlich, ist aber längst kein garantierter Schutz. 8,3% aller Erwerbstätigen sind von Armut
betroffen oder bedroht..»
Zur Aussage im Artikel: «Die Butter bleibt zwar auf dem Brot der Armen, aber es hätte mehr sein müssen und dieses «Mehr» ist den Reichen zugeflossen.» Könnte wohl heissen, dass sich die Reichen engagieren sollten Lösungen zu finden, wie Menschen von der Armut befreit werden könnten, um den sozialen Frieden zu sichern.
Gunther Kropp, Basel
Ergänzung zum Text oben:
Zu den Armutbetroffenen oder -gefährdeten gehören viele geschiedene Mütter und auch spät geschiedene Frauen im Alter.
Mangels Kinderhorten – insbesondere auf dem Land – und auch mangels guter Teilzeitstellen konnten viele keiner Arbeit nachgehen, die im Alter eine gute Rente eingebracht hätte. Dazu gehören viele der Boomer-Generation.
Wie auch im Artikel erwähnt ist wohl schwierig eine zukünftige Entwicklung vorherzusagen. Das gilt sicher auch für die diversen Ökonomen. Also werde ich mich an dem orientieren was ich in der vergangenen 20 Jahren sehen konnte: Viel mehr Verkehr auf den Strassen, viel höhere Mieten, überfüllter ÖV u.s.w. Selbst wenn man am Ende mehr in der Tasche hat (wenn es denn so wäre) muss man sich doch fragen ob dies nicht doch mit einer starken Verminderung der Lebensqualität zu tun hat.
Werner Vontobels Analyse gilt wohl für die meisten Länder dieser Erde. Als Schweizer haben wir die Wahl, mit welchem System wir unseren Wohlstand in Zukunft mindern werden. Durch die Annahme der EU-Verträge mit Automatischer Übernahme aller Regeln und Vorschriften, ein Suveränitätsverlust. Oder wir kämpfen uns ohne diese Verträge durch, müssen uns piesacken lassen, haben aber im Detail mehr Gestaltungsspielraum, resp. Suveränität. Die zweite Variante erscheint mir würdevoller und demokratischer – ich höre schon der privilegierten «Elite» Echo!
Wiederum vielen Dank an Werner Vontobel. Ich wünschte, es gäbe mehr Journalisten und Politiker in der Schweiz, die es verstehen, die Dinge in einen grösseren Zusammenhang zu stellen.
Dass – wie auch Kurt Bischof oben erwähnt – die Schweiz endlich ihre Tiefsteuerpolitik zugunsten der Unternehmen und Grossverdiener beenden sollte, läge im Interesse der Bevölkerungsmehrheit.Leider lässt die sich gern von den Vertretern der rechten Parteien (incl. der so genannten Mitte) einlullen… Das absurde Argument «Arbeitsplätze» scheint klares Denken zu behindern.
Nein es ist eine Ausrede. Um weiter die hohle Hand machen zu können.
Genauso wie die „unendliche Wachstumslüge“.