Faschistische Merkmale des Trump-Regimes

Die Debatte ist nun schon bald zehn Jahre alt: Ist Donald Trump ein Faschist? Die Frage ist rund ein Jahr nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten vom 5. November 2024 aktueller denn je. Jüngst hat auch der britische Historiker Richard Evans seine Meinung kundgetan. Nein, «Trump ist kein Faschist», sagt Evans in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Es sei falsch, «Parallelen zum italienischen Faschismus oder gar zum deutschen Nationalsozialismus zu suchen. (…) Der Kern des Faschismus war Militarismus, die Vorbereitung auf einen weiteren Weltkrieg. (…) Das ist nicht, was Trump macht.»
Richard Evans ist nicht irgendwer. Der frühere Cambridge-Professor ist einer der besten Kenner der Geschichte des 20. Jahrhunderts, seine Bücher zum Nationalsozialismus gelten als das umfassendste Werk zu Aufstieg und Fall des Hitlerregimes. Umso eigenartiger wirkt seine knappe und wenig komplexe Faschismus-Definition.
US-Generalstabschef: «Faschist durch und durch»
Vor allem aber äussern sich andere gewichtige Stimmen deutlicher. Der Historiker Jakob Tanner, früherer Geschichtsprofessor an der Universität Zürich, weist in einem Essay auf eine Aussage des ehemaligen US-Generalstabschefs Mike Milley hin. Gemäss Milley ist Trump ein «Faschist durch und durch». Und John F. Kelly, Minister für innere Sicherheit und später Stabschef des Weissen Hauses während der ersten Präsidentschaft Trump, findet, «Trump entspreche exakt der Definition eines Faschisten».
«Frankensteins Monster»
Bemerkenswert ist auch, dass Trump bereits vor den Wahlen von 2016 ins Schussfeld des neokonservativen Robert Kagan geriet, des Vorzeige-Vordenkers der amerikanischen «Neocons». Bereits im März 2016 bezeichnete er Trump als «Frankenstein-Monster der Republikaner» und rief öffentlich dazu auf, die demokratische Kandidatin Hillary Clinton zu wählen (Infosperber, 4. Juni 2016). Kurz danach legte Kagan nach. In einem Essay in der «Washington Post» und im «Spiegel» (22/2016) schrieb er, mit Trump «kommt der Faschismus nach Amerika: Nicht in Marschstiefeln und mit militärischem Gruss, sondern in Gestalt eines TV-Promis, eines verlogenen Milliardärs, eines Egomanen wie aus dem Lehrbuch, der sich gängige Ressentiments und Unsicherheiten zunutze macht».
Kapitol-Sturm als «rote Linie»
Eine der gewichtigsten Stimmen im Reigen der Experten ist wohl jene von Robert O. Paxton. Der amerikanische Historiker und frühere Professor für Geschichte an der Columbia-Universität in New York gilt als Doyen der Faschismus-Forschung, vor allem mit seinem bahnbrechenden Werk «Die Anatomie des Faschismus» von 2004. Paxton wandte sich verschiedentlich gegen einen inflationären Gebrauch des Faschismus-Begriffs.
Doch wenige Tage nach dem Sturm aufs Kapitol schwenkte Paxton um. In einem Beitrag in der Zeitschrift «Newsweek» vom 11. Januar 2021 schrieb Paxton: «Ich zögerte lange Zeit, Trump als Faschisten zu bezeichnen. (…) Es erschien mir besser, eine weitere oberflächliche und polemische Verwendung des Begriffs ‹faschistisch› zu vermeiden und stattdessen einen sachlicheren Begriff wie Oligarchie oder Plutokratie zu verwenden. Trumps Anstiftung zur Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 hebt meine Einwände gegen die Bezeichnung ‹faschistisch› auf. Seine offene Ermutigung zu ziviler Gewalt, um eine Wahl zu kippen, überschreitet eine rote Linie. Die Bezeichnung erscheint nun nicht nur akzeptabel, sondern notwendig.»
Fast fünf Jahre später, im Oktober 2024, fragte das «New York Times Magazine» Paxton, ob er weiterhin zu seiner Einschätzung von 2021 stehe. «Vorsichtig, aber offen», schreibt die Autorin des Artikels, «sagte er mir, dass er nicht glaube, dass die Verwendung dieses Wortes in irgendeiner Weise politisch hilfreich sei, aber er bestätigte die Diagnose.»
Umberto Ecos «ewiger Faschismus»
Doch wie lautet die Diagnose genau? Wann darf man den Begriff Faschismus anwenden, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, bloss mit einem maximal emotionalisierenden Schlagwort um sich zu werfen? Das ist deshalb nicht ganz einfach, weil dem Faschismus keine politisch-philosophische Doktrin zugrunde liegt. Man kann Faschismus nicht von einer programmatisch-ideologischen Grundlage her verstehen. Sehr wohl gibt es aber Strukturmerkmale, die zu allen Zeiten in allen faschistischen Bewegungen zu beobachten sind und geeignet sind, den Begriff Faschismus besser zu fassen.
Wegweisend sind die 14 Merkmale des italienischen Schriftstellers und Philosophen Umberto Eco (1932 bis 2016), die er in seinem 2020 auf Deutsch erschienenen kleinen Buch «Der ewige Faschismus» (Hanser-Verlag) aufführt. Eco betont, dass nicht alle Elemente erfüllt sein müssen, damit eine Bewegung oder eine Regierung als faschistisch bezeichnet werden muss. Bemerkenswert: Donald Trump, sein Regierungshandeln und seine Maga-Bewegung («Make America Great Again») erfüllen in geradezu idealtypischer Weise sämtliche Kriterien.
Von Traditionskult bis Feindbildkult
Hier sind die 14 Merkmale in Kurzform, jeweils mit der aktuellen Ausprägung in den USA unter Trump:
- Kult der Tradition: Rückgriff auf eine idealisierte, mythische Vergangenheit. Die amerikanische Geschichte wird als Heldenepos verstanden. Typisch ist etwa die Idealisierung eines «goldenen» Amerikas der 1950er Jahre – weiss, christlich, konservativ.
- Ablehnung der Moderne: Moderne Ideen, Aufklärung und Rationalität gelten als Irrweg. Zum Ausdruck kommt dies etwa in der Feindseligkeit gegenüber Gendergerechtigkeit, aber auch in der Ablehnung der Klimapolitik.
- Kult der Handlung um der Handlung willen: Tun zählt mehr als Denken; Reflexion gilt als Schwäche. Trump brüstet sich laufend mit seiner «Entscheidungsfreude» und seinem «harten Durchgreifen», etwa auch durch den Einsatz der Nationalgarde im Innern und gegen den Willen der betroffenen Bundesstaaten. Diplomatie und Expertise gelten nichts.
- Widerspruch ist Verrat: Kritik oder abweichende Meinungen werden als illoyal betrachtet. Mitglieder der Republikanischen Partei, die es wagen, Trump zu kritisieren, werden abgestraft, abgesetzt, zurückgesetzt, öffentlich angefeindet. In dieses Kapitel gehören auch die Angriffe Trumps auf Wissenschaft und Universitäten.
- Angst vor Unterschiedlichkeit: Vielfalt wird als Bedrohung empfunden; Betonung nationaler oder kultureller Einheit. Angstkampagnen zur Migration, Verletzung der Integrität und brutale, ausserlegale Abschiebungen von Migrantinnen und Migranten durch die Einwanderungsbehörde ICE, generelle Ablehnung von Minderheitenrechten und Diversität.
- Appell an Frustration der Mittelschicht: Mobilisierung von sozialer Unsicherheit und Abstiegsängsten. Umwerbung der weissen, ländlichen, ökonomisch verunsicherten Bevölkerungsschichten, bei gleichzeitigen Kürzungen von Sozialprogrammen, aber Privilegienwirtschaft zugunsten der Superreichen.
- Fixierung auf Verschwörungen: Die Welt wird so wahrgenommen, als wäre sie von Feinden und dunklen Mächten gelenkt. Typisch sind die Geschichten um den angeblichen «Deep State», die haltlosen Behauptungen Trumps um die «gestohlene Wahl» von 2020, die Kultivierung von Feindbildern, etwa gegen den Milliardär und Investor George Soros, weil dieser sich mit seinen Stiftungen unter anderem für Bürgerrechtsbewegungen und Demokratieprojekte einsetzt.
- Feindbildkult: Das Leben ist ein ständiger Kampf gegen einen klar definierten Gegner. Wer nicht konsequent auf Kurs der Maga-Bewegung ist, wird als «links» ausgegrenzt. Die ständige Mobilisierung gegen «Feinde» trifft nicht nur «Linke», sondern auch «die Medien» oder «illegale Einwanderer». Migrantinnen und Migranten werden als «Invasoren», «Kriminelle» oder «Terroristen» dargestellt. Feindseliges Verhalten gegenüber demokratischen Verfahren und Institutionen sowie gegenüber dem Justizsystem.
- Verachtung der Schwachen: Stärke wird verherrlicht, Schwäche verachtet. In Trumps Universum haben arme Menschen, Behinderte und Geflüchtete keinen Platz, sie werden als Last behandelt.
- Kult des Heldentums und des Todes: Der Tod für die Sache wird idealisiert. Patriotische bis ultra-nationalistische Rhetorik, Waffenverehrung, Märtyrerkult um den Sturm aufs Kapitol vom 6. Januar 2021.
- Machismo: Starkult um «harte Männlichkeit», Betonung traditioneller Geschlechterrollen, sexistische Rhetorik, Herablassung gegenüber Frauen, Intoleranz gegenüber LGBTQ+-Personen.
- Populismus: Das Volk wird als homogene Masse verklärt, die ein Führer direkt verkörpert. Trump versteht sich als «Stimme des Volkes» im Kampf gegen «das korrupte Establishment».
- Newspeak: Verarmung der Sprache, um kritisches Denken zu verhindern. Es wird nicht mehr argumentiert, die Debatte wird mit Schlagworten zugemüllt: «Fake News», «Witch Hunt», America First».
- Synkretismus: Widersprüchliche Ideen werden vermischt, solange sie zur Emotionalisierung und Mobilisierung taugen. Trumps Maga-Welt ist eine wilde Mischung aus Christentum, Nationalismus, Anti-Globalismus und Wirtschaftspopulismus.
Zentrale Rolle der Medien für Faschisten
Ein zentraler Punkt wird bei Umberto Eco etwas unterbewertet: die Rolle der Medien. Der deutsche Kulturwissenschafter Andreas Gehrlach ergänzt die Liste deshalb mit einem «fünfzehnten Element des Faschismus». In einem gleichnamigen Beitrag auf der Plattform Geschichte der Gegenwart betont er, die Bedeutung der Medien sei heute «wichtiger und markanter denn je. Der Faschismus versucht immer, die modernsten und aktuellsten Medien zu nutzen, um seine Botschaften zu verbreiten.»
Gehrlach erinnert an Hitlers Propagandaminister Goebbels, der das noch junge Medium Radio ganz bewusst zum wichtigsten Propagandainstrument einsetzte. «Wir wenden alle Mittel an. Geld haben wir, der Rundfunk gehört uns», schreibt Goebbels in sein Tagebuch. Auch heute ist die Begeisterung für Medienmacht bei rechtsextremen Bewegungen zu spüren – nur sind es eben nicht mehr Presse, Radio und Fernsehen, sondern «Social Media», beispielsweise Tiktok, X, Instagram et cetera.
«Bis zur Übernahme der Medien ist ein scheinbares Eintreten für Meinungsfreiheit das wichtigste Mittel der Faschisten zur Erzwingung, in den Medien aufzutauchen. (…) Sobald dann irgendwelche rechten Milliardäre oder Parteien ein Medium» gekauft oder sonst wie unter Kontrolle gebracht haben, «bricht diese scheinbare Begeisterung für den freien Markt der Meinungen weg», schreibt Gehrlach.
Faschismus-Forscher verlassen die USA
Wie stark dieser freie Markt der Meinungen bereits unter Druck ist, zeigt Trumps Gängelung der Medien sowie generell die Einschränkung der Pressefreiheit mit unterschiedlichsten Methoden. Dazu gehört auch der Druck auf die Wissenschaft. So verliessen mehrere führende Intellektuelle, die sich mit Fragen des Faschismus beschäftigen, die USA. Etwa der Philosoph Jason Stanley, bisher Professor an der Yale-Universität und Autor zweier Bücher zum Faschismus. Zur «Deutschen Welle» sagte er im April 2025: «Das, was die Trump-Regierung gerade macht, ist Faschismus.» Ende März 2025 hat Stanley seine Entscheidung bekanntgegeben, die USA Richtung Kanada zu verlassen, um an der Universität Toronto zu lehren.
Er ist nicht der einzige. Auch der amerikanische Historiker Mark Bray, Antifaschismus-Experte und Professor an der Universität von New Jersey, verliess im Oktober dieses Jahres die USA mit seiner Familie Richtung Spanien. Er geriet ins Visier der rechten Organisation «Turning Point USA», der faktischen Jugendorganisation von Donald Trump. In einem Podcast des spanischen Radiosenders SER warnte Bray: «Trump ist mit einer explizit faschistischen Agenda im Weissen Haus. Und die Liberalen haben zu viel Vertrauen in das System, um Widerstand zu leisten.» Aber dieses System sei nicht so stark.
Widerstandskraft der Demokratie wird überschätzt
Nach Kanada abgesetzt hat sich auch das Ehepaar Timothy Snyder und Merci Shore, beide bisher Professoren für osteuropäische Geschichte an der Yale-Universität. Timothy Snyder ist einem breiteren Publikum durch sein Buch «Über Tyrannei: zwanzig Lektionen für den Widerstand» (C.H. Beck Verlag, 2017) bekannt geworden (siehe Infosperber vom 1. Juli 2017).
Dort warnt er unter anderem vor zu grossem Vertrauen in die Widerstandskraft demokratischer Institutionen. Man glaubt in westlichen Demokratien oft, es werde schon nichts schiefgehen. Manchmal ist dieser Glaube selbst dann noch da, wenn es im Grunde schon zu spät ist. Timothy Snyder erwähnt ein historisches Beispiel: Kurz nach Hitlers Machtantritt Ende Januar 1933 publizierte eine führende Zeitschrift für die deutschen Juden («Der Israelit: Centralorgan für das orthodoxe Judentum») am 2. Februar 1933 einen Leitartikel, in dem es unter anderem heisst:
«Zwar sind wir keineswegs der Meinung, dass Herr Hitler und seine Freunde, einmal in den Besitz der lange erstrebten Macht gelangt, nun etwa (…) kurzer Hand die deutschen Juden ihrer verfassungsmässigen Rechte entkleiden, sie in ein Rassen-Ghetto sperren oder den Raub- und Mord-Instinkten des Pöbels preisgeben werden. Das können sie nicht nur nicht, weil ihre Macht ja durch eine ganze Reihe anderer Machtfaktoren vom Reichspräsidenten bis zu den Nachbarparteien, beschränkt ist, sondern sie wollen es sicherlich auch gar nicht; denn die ganze Atmosphäre auf der Höhe einer europäischen Weltmacht, die ja mitten im Konzert der Kulturvölker stehn und bleiben will, (…) ist der ethischen Besinnung auf das bessere Selbst günstiger als die bisherige Oppositionsstellung.»
Man liest das heute mit Beklemmung. Man sollte aber mittlerweile wissen, dass auch Machthaber, die im Rahmen demokratischer Institutionen ans Ruder gelangen, nicht automatisch Garanten ebendieser Institutionen sind. Sie respektieren demokratische Prozesse und Institutionen nur solange, bis sie an den Schalthebeln der Macht sitzen.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.







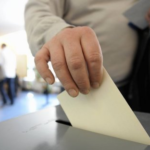


Ja, der Glaube, dass wir es ’schon noch im Griff haben‘ scheint unzerstörbar. In der Politik, wie auch bezüglich Umwelt.
Trump zeigte bereits in der ersten Amtszeit faschistoide Züge, stolperte jedoch unerfahren von einer Blamage in die nächste.
In den Jahren der nachfolgenden Biden-Regierung hatte die rechten Thinktanks genug Zeit aus ihren Fehlern zu lernen.
Was MAGA und Project 2025 konzipiert haben lässt einem keinen anderen Rückschluss zu , als das systematisch die amerikanische Demokratie abgeschafft werden soll. Faschistoid halt.
Mir ist der Artikel zu polemisch. Viele Aussagen Ecos können ebenso auf linke Regierungen angewandt werden. Die Aussagen der zitierten Faschismusexperten zeigen doch vor allem die Tiefe und Breite der politischen Gräben in den USA und sind für mich weniger beweisend für die Falschheit der MAGAs.
Ich beobachte Trump auch kritisch, aber das hier ist mir zu plump und einseitig. Irgendwie andersherum die Sachverhalte vereinfachend. Am Ende Parallelen zum Deutschland der 30er Jahre zu konstruieren ist nicht seriös.
Vier spontane Ergänzungen:
1. Synkretismus: Das «Amalgam» National-Sozialismus» steht als Formel dafür, wie der Faschismus zwischen Kapitalismus und Kommunismus als falscher Versöhner auftritt.
4. Modernität: In Italien geht antiker Heroismus mit Affirmation der Moderne in monumentaler Architektur und futuristischer Kunst einher. In Deutschland «versöhnt» etwa Leni Riefenstahl altbackene Deutschtümelei scheinbar widerspruchsfrei mit ästhetischer Modernität.
2. Verbrüderung mit dem Kapital: Nach dem Kaltstellen der kleinbürgerlichen-proletarischen Komponente (SA) hat sich das Grosskapital in Deutschland mit dem Nationalsozialismus arrangiert. Dirigismus wird profitabel.
3. Militarismus: Paramilitärische Verbände (SA / SS; Schwarzhemden) sind in der Frühphase identitätsstiftende, normierende Mobilisierungs- und Terrororganisation. Nach der Machtergreifung wird die Kriegstreiberei wichtiger Faktor des wirtschaftlichen Erfolgs. Friedensfürst Trumps Kriegsministerium lässt grüssen.
Danke für die klare Diagnose. Der Begriff ist vom italienischen «Fascio» Bündel) abgeleitet. Alle Kräfte sollen gebündelt werden, sämtliche Abweichungen werden nicht geduldet, unterdrückt und wenn möglich eliminiert. Dies ermöglicht die Ausübung einer totalitären Macht, was wir bei Trump spätestens seit dem Antritt seiner zweiten Amtszeit sehen. Die Entschlossenheit, mit der der Umbau des Staates vor sich geht, wird nach wie vor unterschätzt. Auch deshalb kann ich mich nur halbwegs über den Sieg von Mamdani in New York freuen. Wir werden sehen.
„Alle Kräfte sollen gebündelt werden, sämtliche Abweichungen werden nicht geduldet, sondern unterdrückt.“
Willkommen beim Thema Russland/Ukraine oder Covid – bis auf wenige Ausnahmen gilt das auch auf EU- und NATO-Ebene. Denn abgesehen von der physischen Eliminierung des Gegners, mit Ausnahme der Ukraine, läuft es genau so: von massivster Diffamierung, Ausgrenzung, Zensur und Berufsverboten bis hin zur Kontosperrung. Und das alles ganz ohne MAGA, Trump oder eine Rechtsregierung.
Danke, Herr Müller-Muralt, für diesen wichtigen aufklärenden Beitrag! Mich erschreckt, wie sehr das faschistische Denken anscheinend bereits bei einem beträchtlichen Teil der Leser des Infosperber latent Fuss gefasst hat: Dass 41 % ihn für «nicht hilfreich» einstufen – was immer sie damit meinen könnten – lässt bei mir die Alarmglocken läuten. Gestern ist bei «Republik» ein umfangreicher Artikel erschienen (14 Seiten) mit dem Titel «Der autoritäre Pakt», gemeinsam verfasst von sieben Autoren. In 5 Kapiteln wird detailliert beschrieben, wie weit die «MAGA»-Agenda die politischen / demokratischen Institutionen schon umgestaltet hat. Es ist zu befürchten, dass der «Point of no return» schon überschritten ist. Die Erzählungen, Trump sei nur ein unberechenbarer und launischer Egomane (wobei «Egomane» durchaus zutreffen dürfte), sind naive Verharmlosungen, die ihn sträflich verharmlosen. Er ist viel zielstrebiger und durchtriebener als gemeinhin dargestellt. Die Medien haben versagt.
Wer den Artikel negativ bewertet hat, ist noch lange kein Faschist. Mein Grund war T. Snyder, den Deep State als Verschwörung zu verharmlosen und die Heuchelei der Anti-Trump-Fraktion.
Ich stehe beiden Fraktionen ablehnend gegenüber und habe keinerlei Mitleid mit den US-Demokraten, die für mich genauso unwählbar sind wie die Republikaner und Trump – allein schon wegen der parteiübergreifenden Heuchelei, der Feindbilder, des US-Exzeptionalismus, des Populismus, Neoliberalismus, der Einmischung, Drohungen, Sanktionen und Aggressionen gegenüber anderen Ländern. Trump treibt vieles lediglich auf die Spitze und hat keine Scheu, es offen auszusprechen. Ob man das nun Faschismus nennt, ist für mich nebensächlich.
Abgesehen vom umgekehrten Totalitarismus nehmen die totalitären Züge auch bei anderen Parteien und Personen immer mehr zu – insbesondere auch bei jenen, die sich lautstark Antifaschismus, Demokratie und Freiheit auf die Fahnen schreiben, sowohl in den USA als auch in der EU.
Glenn Greenwald auf X:
“Praktisch alles, was Liberale anführen, um Trump als Diktator darzustellen, wurde von Dick Cheney eingeführt und dann von Bush 43 umgesetzt: angefangen bei unbegrenzter Exekutivgewalt.
Das ist nur ein Grund, warum die Allianz der Demokraten mit den Bush-Anhängern so erbärmlich ist.”
Aus meiner Sicht ist Trump nur die Spitze eines völlig kaputten Systems, an dem die Demokraten ebenso viel Schuld tragen wie die Republikaner. In beiden Lagern wimmelt es von Heuchlern und bizarren Figuren. Auch die EU sehe ich auf einem ähnlichen Weg. Interessanterweise sind es nicht ein paar Rechtspopulisten und Rechtsextreme, die die Demokratie schrittweise zerstören, sondern die vermeintliche Mitte. Trump und Konsorten führen lediglich fort, wofür die Liberalen zuvor den Weg bereitet haben. Mir scheint überhaupt, dass die Luft zwischen Liberalismus und verschiedenen Formen von Extremismus und Totalitarismus recht dünn ist.
Sehe ich sehr ähnlich. In Deutschland hat zum Beispiel die Linke Ampelregierung den Strafbestand «Delegitmierung des Staates» geschaffen. Um den eigenen Machterhalt zu sichern, was bekanntlich daneben ging. Wenn in Zukunft möglicherweise eine CDU/AFD Regierung am Werk ist,können Formate wie Böhmermann,Heute Show, die Anstalt etc ganz sicher den Hut nehmen, denn diese würden mit grösster Wahrscheinlichkeit diesen Strafbestand erfüllen. Dann werden wieder viele «Faschismus» schreien, aber kaum jemand wird sich erinnern, dass er von Links eingeführt wurde. Solange es ja die «Richtigen» erwischt, ist offenbar alles in Ordnung. Wir müssen schleunigst weg von diesem Sippendenken kommen
Wikipedia: «Faschismus USA – Laut Sarah Churchwell war der amerikanische Ku-Klux-Klan die weltweit erste faschistische Bewegung…America First America First war zwischen 1915 und 1941 ursprünglich der Slogan von amerikanischen fremdenfeindlichen, nativistischen Bewegungen und Politikern. Huey Long, 1928–1933 Gouverneur von Louisiana, war der amerikanische Spitzenpolitiker, dem man am häufigsten faschistische Tendenzen vorwarf. Er verhängte das Kriegsrecht, zensierte die Zeitungen, verbot öffentliche Versammlungen und besetzte Gerichte und Parlamente mit seinen Kumpanen.»
Könnte wohl die theoretische Möglichkeit bestehen, dass Donald Trump ein Bewunderer des US-Politikers Huey Long sein könnte, der von 1928 – 1933 Gouverneur von Louisiana war, der «verhängte das Kriegsrecht, zensierte die Zeitungen, verbot öffentliche Versammlungen und besetzte Gerichte und Parlamente mit seinen Kumpanen..» entsprechend ist die Umsetzung seiner Macht.
Gunther Kropp, Basel
Heute, 30 Jahre nachdem Eco diese 14 Punkte veröffentlichte, erscheint es reichlich naiv, den Begriff «Deep State» (den Eco nicht verwendete) im Beitrag mit dem Adjektiv «angeblich» zu verbinden. Schliesslich wurde er durch Professor Peter Dale Scott aus guten Gründen popularisiert und dessen Berechtigung gründlich dokumentiert. Dieser Politikwissenschaftler, der n.b. Verschwörungstheorien ablehnt, lässt sich im politischen Spektrum nicht einordnen. Dies alles macht die Verwendung des Begriffs im Kontext von Faschismus fragwürdig.
Jürg Müller-Muralt ist der Meinung Trump und seine MAGA-Bewegung erfüllen sämtliche Kriterien faschistischer Herrschaft. Aber die Waffenexporte der Schweiz nach den USA, gehen weiter. Bern denkt nicht daran die Waffenexporte und die Rüstungszusammenarbeit mit den USA einzustellen. Hohe Offiziere der Schweizer Armee werden weiter Ausbildungskurse in den Staaten absolvieren.
Auch der weltweite Krieg gegen den Terror, der nach den dem 11. September 2001 begann, führte nicht zu einem Stopp der Kriegsmaterialexporte nach den USA und an andere Nato-Staaten die sich an diesen Kriegen beteiligten.
Kriegsmaterialexporte dürften nach dem Bundesgesetz über das Kriegsmaterial der Schweiz nicht in Länder exportiert werden, «die in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind».
Von US-Stützpunkten werden auch Drohnenangriffe gestartet, aussergerichtliche Hinrichtungen. Seit dem Amtsantritt von Trump wurden 529 Luftangriffe geflogen. Viele Zivilisten kamen dabei um.
Was bei dem Narzissten und/oder Faschisten Trump und rechten Parteien häufig übersehen wird, ist, dass sie ein Produkt des Neoliberalismus, Kapitalismus und – in meinen Augen – einer Pseudo-Demokratie sind. Die MAGA-Bewegung und Trump kann man nämlich auch als Symptom einer fehlgeleiteten Politik, Ideologie und eines dysfunktionalen Wirtschaftssystems verstehen.
Ich empfehle hierzu die Lektüre von Branko Milanović und Emmanuel Todd,
zum Beispiel: «As Neoliberalism Crumbles, It Becomes More Destructive»
Es sei erinnert, dass im demokratischen New York während der Corona-Zeit der 1G-Faschismus regierte – mit dem Ergebnis, dass sich dort 90% impfen liessen. Die Entrechtung der Bevölkerung, die Totalüberwachung und das Foltern auf der ganzen Welt, der rechtsfreie Knast Guantanamo begannen nach dem 11.09.2001. Trump ist nur das Sahnehäubchen auf diesem unappetitlichen Gemenge, das von Obama genauso angerührt wurde – es sei auch hier erinnert, für wieviele hunderttausende Abschiebungen und Drohnenmorde dieser Mann verantwortlich ist. Die Ausgrenzung anderer Meinungen, der Versuch die Presseherrschaft zu erlangen, unsaubere Rufmordmethoden sind wahrlich kein Merkmal Trumps allein. Republikaner und Demokraten sind zwei Seiten der gleichen Medaille – im Kongress sitzen fast nur noch Mehrfachmillionäre, die sich alles reichlich vergolden lassen. Die, die jetzt schimpfen, sind nicht die Guten, sondern gerade nicht an den Futtertrögen.