Die Krisenrhethorik führt zum Wunsch nach einem starken Mann
upg. Andreas Brenner, Professor für Philosophie an der Universität und der FHNW in Basel, veröffentlichte das Buch: «Der säkulare Gottesstaat»*. Ein Gastbeitrag.
Staaten orientieren sich wieder stärker an religiösen mittelalterlichen Vorbildern. Indem der heutige Staat stark aufgeladene Metaphern wie «Sünder» oder «Leugner» übernimmt, verabschiedet er sich von der Moderne und wird zum säkularen Gottesstaat.
Ein solcher Befund mag zunächst überraschen, stammt der Begriff doch vom Philosophen und Kirchenlehrer Aurelius Augustinus, der ihn im frühen Mittelalter geprägt hat. In seinem Mammutwerk «Gottesstaat» entwirft er den idealen Staat: Alle Menschen richten sich aus auf das kommende Zeitenende, es einen sie die Hoffnung und der Kampf gegen die Abtrünnigen und Widerspenstigen.
Der König, als Herrscher auf Erden, sieht sich in der Pflicht, sein Volk auf den Weg des Heils zu bringen, und dazu zählt dann auch der Kampf gegen die Irrlehren und die Irrlehrer. Gegen beide muss im Gottesstaat mit aller Härte vorgegangen werden. Wer dabei die Autorität des Königs infrage stellt, versündigt sich nicht allein am König, sondern an dem grossen Werk des Gottesstaates.
Ganz in diesem Sinne gehen immer mehr moderne Staaten dazu über, ihr politisches Leitungspersonal vor herabsetzender Kritik zu schützen. Erinnert sei nur etwa an die absonderliche «Schwachkopf-Affäre» in Deutschland, als es zur Hausdurchsuchung bei einem Rentner wegen Beleidigung eines politischen Amtsträgers (Habeck) kam.
Entwicklungen wie diese sind in vielen Staaten mittlerweile kein Kuriosum mehr, sondern fügen sich in eine Neuausrichtung moderner Demokratien, die Folge einer aktuellen Weltbeschreibung ist: Die Welt ist in eine Dauerkrise geraten und somit zu dem Jammertal geworden, als das sie bereits im Mittelalter begriffen wurde. Und deshalb erscheinen auch die Mittel, die damals ergriffen wurden, als opportun.
Heute muss man die Menschen an den Ernst der Lage erinnern
Anders als im Mittelalter, als den meisten Menschen der Ernst der Lage – eben die Gefährdung des Seelenheils – bewusst war, müssen in der Moderne die Menschen immer wieder neu daran erinnert werden, was auf dem Spiel steht: Die Stichworte sind Pandemie, Klimakrise, aber auch Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Migrationskrise, Sicherheits- oder Währungskrise. Angesichts dieses Krisen-Perpetuum-mobiles verlieren die Menschen den Überblick und sehnen sich danach, dass jemand all das endlich einmal anpackt.
Die Krisenrhetorik der Politik wird zum Selbstläufer. Und da die Politik in der Krisenbewältigung ihren Daseinszweck erkannt hat, muss sie immer neue Krisen entdecken. Die Medien, die dem Grundsatz «bad news are good news» folgen und davon wirtschaftlich profitieren, beteiligen sich willig am Aufspüren neuer Krisen.
Der mittelalterliche Begriff «Sünde» ist wieder populär
Wie stark sich der moderne Staat an dem religiösen mittelalterlichen Vorbild orientiert, erkennt man am Begriff der Sünde, von dem der säkulare Gottesstaat ausgiebig Gebrauch macht. So wird mit jeder Krise auch ein neuer Sünden-Typus geschaffen: Steuersünder, Klimasünder oder – als spezielle Form des Frevels – Klimaleugner und Corona-Leugner.
Die Analogie zum mittelalterlichen Begriff des Gottesleugners ist dabei offensichtlich und beabsichtigt. Und zusätzlich ist die Steigerungsdimension gewollt: Sünder sind wir ja – schlimm genug – alle; aber Leugner, das sind dann die wirklich Bösen, die das Werk des Guten torpedieren wollen.
Indem der säkulare Gottesstaat Positionen mit solch stark aufgeladenen religiösen Metaphern («Sünder», «Leugner») versieht, verabschiedet er sich von der Moderne, die sich ja durch Rede und Widerrede, durch Argument und Gegenargument ausweist – also das, was man als Wissenschaftsgesellschaft bezeichnet.
Wer in Wissensangelegenheiten als Sünder oder Leugner bezeichnet wird, mit dem ist der Diskurs beendet.
Der Begriff «Verschwörungstheorie» erledigt Argumente
Für den mittelalterlichen Staat wie auch den säkularen Gottesstaat gilt: Er weiss um die Wahrheit. Und weil er um die Wahrheit weiss, muss der säkulare Gottesstaat sie auch vehement gegen die Andersdenkenden verteidigen. Als weiterer quasireligiöser Begriff erweist sich dabei der Begriff der Verschwörungstheorie als ausgesprochen effizient, funktioniert er doch wie der mittelalterliche Bannstrahl: Wen der Begriff der Verschwörungstheorie trifft, der ist erledigt, womit sich auch die von ihm vorgebrachten Argumente wie von selbst erledigt haben.
Damit ist die Bahn für die Verteidiger des Gottesstaates frei, und sie können in einer nahezu total säkularisierten Welt Projekte verfolgen, die in ihrem weltfremden Absolutheitsanspruch («Zero-Emission», «Zero-Virus») etwas Religiöses haben.
In dieser konfusen Gemengelage kommt das Herzstück moderner Demokratien unter die Räder: die freie Meinungsäusserung.
____________
Dieser Beitrag erschien am 8. Oktober 2025 in der «NZZ».
_____________
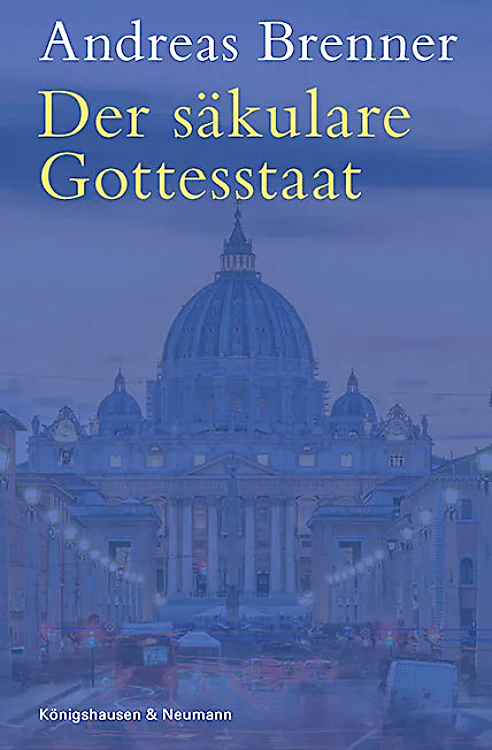
*Andreas Brenner: «Der säkulare Gottesstaat», Verlag Königshausen & Neumann, 2025, 20.30 CHF, 16 Euro.
Aus dem Verlagstext: «In den modernen Staaten sind Veränderungen zu beobachten, die man noch vor Kurzem für schier unmöglich gehalten hätte: Wer sich satirisch über Politiker äussert, muss mit einer Strafverfolgung rechnen; neue Gesetze sollen verhindern, dass die öffentliche Meinung durch Falschinformationen irritiert wird und ein diffuser Begriff von Verschwörungstheorie kann unliebsame Positionen aus der öffentlichen Debatte verbannen und ihre Autoren mit einem indirekten Sprech- oder Schreibverbot belegen … Die modernen Demokratien, die sich als weltanschauungsneutral betrachten, argumentieren zunehmend religiös und entwickeln sich in Richtung säkularer Gottesstaaten.»
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.







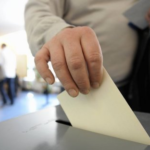


Deutsches Historisches Museum: «Der Einfluss der Kirche im Mittelalter – Die „richtige“ Ausübung der christlichen Religion wurde seit der Mitte des 13. Jahrhunderts durch die Inquisition sichergestellt. Vom Papst direkt beauftragte Inquisitoren reisten an Orte, wo häretische Äußerungen getätigt worden waren….Die römische Kirche ließ keine Abweichungen von der anerkannten Lehre zu. Sie sah es als ihre Aufgabe an, die Seelen der Menschen beim Jüngsten Gericht vor der Hölle zu schützen. Denn nur Menschen, die nach der richtigen Lehre ihr Leben geführt hatten, konnten nach dem Tod auch in den Himmel aufgenommen werden.»
Zur Aussage im Artikel: «Nicht nur die USA, auch westeuropäische Demokratien sind längst dabei, sich in säkuläre Gottesstaaten zu verwandeln.» Mit anderen Worten, die Renaissance des Mittelalters könnte von Potentaten gefördert werden mit der absoluten Macht der Religion. Wer in den Himmel kommen will, der muss bedingungslos gehorchen.
Gunther Kropp, Basel
Starker Text, spricht mir aus der Seele. Ist mir beim Thema Corona zuerst aufgefallen diese Entwicklung, dass es sich wie ein Religionskrieg anfühlte. Da gab es die (falschen) Propheten, Lauterbach,Fauci etc. Es brauchte Sündenböcke wovon die Menschen mit reinem Glauben geschützt werden mussten. Die meisten Medien fungierten als moderne Pranger, wo jeder Abweichler verbal zur Schnecke gemacht wurde, wie das Beispiel Kimmich zeigte.Eine ziemlich archaischen Natur des Menschen kam zum Vorschein und zeigte,dass wir gesellschaftlich nicht weiter sind als vor 2000 Jahren. Sehe es auch so,wie der Autor,dass sich diese Haltung der Denattenkultur fast in jedem anderen Thema (Klima,Krieg,Gender) so weiter geht. Eine beängstigende Entwicklung, die tragischerweise
eigentlich von Oben, also Studierten,Politik und Medien Redaktionen,so geführt wird.
Vielen Dank fürs Veröffentlichen,ein guter Start ins Wochenende.
Könnte nicht ein Grund für den Ruf nach der Autorität die aufräumt sein, dass in unserer, durch die Dominanz des Kapitals eingezäunten Demokratie erfahrungsgemäss keine Veränderungen der Umstände mehr möglich sind? Man denke nur daran, dass die allgemein anerkannten Risiken des Klimawandels, von den dafür verantwortlichen Konzernen schlicht ignoriert werden, Volksentscheide hin oder her.
Die Corona-Krise kann als Wendepunkt der modernen Menschheitsgeschichte betrachtet werden. Die moderne Demokratie und damit die Wissenschaftsgesellschaft ist zunehmend ein Relikt der Vergangenheit geworden. Die Digitalisierung treibt diesen Prozess in einem nie vorher gekannten und die Menschen überfordernden Tempo voran. Ich äussere mich hier als kritischer Mensch vor allem gegenüber den Zeugen Coronas, was bedeutet, dass solche Diskurse beendet werden. Der säkulare moderne Gottesstaat gewinnt immer mehr die Oberhand. Ein wesentlicher Unterschied zum modernen säkularen Gottesstaat besteht darin, dass das Mittelalter keinen vergifteten Globus und keine völlig verschuldeten Staaten hinterlassen hat.
Interessanter Beitrag. Ich würde noch unterscheiden, wie das Vokabular verwendet wird. Journalisten beispielsweise verwenden «Klimasünder», um ihren Text abwechslungsreicher und lesbarer zu machen. Auch die augenzwinkernde Verwendung durch einen Bundesrat wäre wohl unproblematisch. Das geht dann in Richtung von Schokoladegenuss als «Sünde». Wenig problematisch scheint mir auch die Verwendung in der Rhetorik von Umweltlobbyisten, die als solche erkennbar sind. Problematisch ist die ernsthaft gemeinte Verwendung durch offizielle Stellen oder Leitmedien. Da werden die Begriffe gern zum Instrument der Kontrolle und Macht. Bei «Corona-Leugner», «Verschwörungstheoretiker» und auch «Klimaleugner» ist das aus meiner Sicht der Fall. Nochmal ein anderer Fall ist der Begriff «Zero-Emissions». Der Begriff an sich ist sachlich und das (Netto-)Nullziel (ohne Zeithorizont) nicht extrem. Mittelalterlich wird es, wenn Ziele und Wege nicht mehr in Frage gestellt werden dürfen.