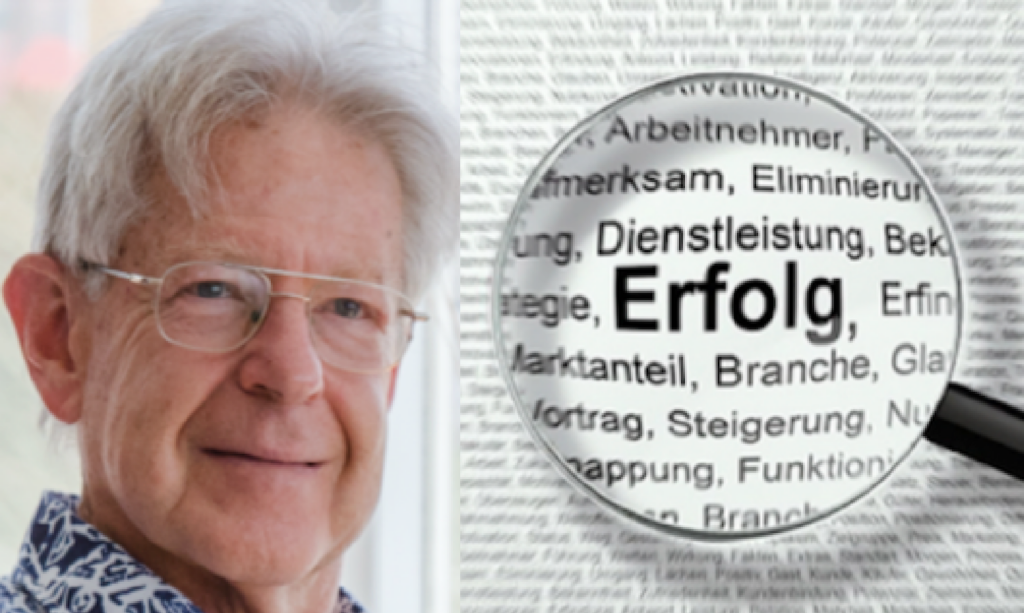Sprachlupe: Wo uns Quaddeln auf der Quabbe erfreuen
Mein Leibblatt widmet sich neuerdings besonders gern auch körperlichen, persönlichen Dingen, als wäre es ein Leib-Blatt. So erfuhr ich (samt Begründung), «dass sich beim Zeckenstich – anders als beim Mückenstich – keine Quaddeln bilden». Und so lernte ich indirekt, dank beiderlei Stich-Erfahrung, was eine Quaddel ist: eine «juckende Anschwellung der Haut», wie es duden.de und dwds.de definieren. Das DWDS zeigt zudem auf einer Landkarte die Verbreitung, bei diesem Wort von Norden nach Süden abnehmend, bis fast zum Verschwinden in der Schweiz, als gäbe es hier keine Quaddeln.
Die gibt es aber, nur vermeintlich kein genau passendes anderes Wort dafür. Die Suche nach Synonymen ergibt Ungefähres wie Schwellung oder Wulst oder aber Fachsprachliches: «Die Quaddel oder Urtica ist eine weisse bis rötliche, ödematöse Verdickung der Haut, die mit Juckreiz verbunden sein kann. Sie gehört zu den Primäreffloreszenzen.» Danke, DocCheck, so weiss ich endlich, wie die verflixte Primäreffloreszenz auf meiner Quabbe heisst. Dem Wort Quabbe für Fettwulst begegnete ich nur dank der Wortergänzung beim Eintippen von Qua… im Online-Duden, es ist dort als «norddeutsch» gekennzeichnet, mit der Herkunft «mittelniederdeutsch quabbe = schwankender Moorboden». Das DWDS verzeichnet Quabbe nur als abweichende Schreibweise für Quappe – eine fettige Art Dorsch, wenn nicht eine Kaulquappe gemeint ist.
Bekneipt, stoffelig und abgeranzt
Zeitungstexte sind oft genug ein Ärgernis, wenn darin deutschländische Wörter prangen, obwohl es hierzulande gängige Pendants gäbe. Mit Quaddel aber hat die Lektüre meinem hochdeutschen Wortschatz eine willkommene Bereicherung verschafft, getreu der Auffassung des Zürcher Gelehrten Johann Jakob Bodmer, treffliche «regional gebräuchliche Wörter und Wendungen [seien] in besonderem Masse geeignet, die gemeinsame Hochsprache zu bereichern» (Emanuel Ruoss im «Sprachspiegel» 2015). Allerdings wehrte sich Bodmer im 18. Jahrhundert vor allem dafür, dass schweizerische Ausdrücke auch im Hochdeutschen verwendet werden dürfen. Seine Sichtweise lädt indes auch dazu ein, Wörter aus Deutschland oder Österreich nicht a priori zu verschmähen.
So haben Sie vielleicht Verwendung für einige meiner Zeitungslesefrüchte aus der letzten Zeit. Nachschlagen musste ich, als ich von «abgeranzten Unterständen auf der ‹falschen Seite› des Dnipro» gelesen hatte, von «Musik, die irgendwo zwischen Austropop und bekneiptem Wiener Chanson liegt» oder «Männern, die Stärke mit Stoffeligkeit verwechseln». Meist erlaubt der Zusammenhang, erfolgreich zu raten, aber wer es genau wissen will, samt geografischer Verbreitung und weiteren Zutaten, ist beim DWDS gut aufgehoben. Dort erfuhr ich auch, dass herzig in der Schweiz besonders häufig vorkommt. Der deutschen Einflusshökerin Jeannie Wagner fiel das Wort bei einem Besuch als «komisch» auf – sie kennt ihren Goethe schlecht: «Es war ein herzigs Veilchen».
Da beisst’s doch auf der «Schwattere»
Bei Quaddel und Quabbe haben mich glückliche Zufälle doch noch zu präziseren Synonymen geführt. DocCheck nennt Papel als weitere Primäreffloreszenz, allerdings knötchenförmig. Als ich beim Lesen eines französischen Buchs enflure nicht verstand, gab mir der probate mehrsprachige Dictionnaire Leo passend Schwülstigkeit an, das vielseitige Wort kann aber auch Quaddel bedeuten (und sogar Volltrottel).
Vom Schweizerischen Idiotikon wollte ich bei anderer Gelegenheit Genaueres zu Schwetti wissen. Nicht nur wurde ich bei diesem noch vielseitigeren Wort reich belohnt, sondern in der Nähe stiess ich auch noch auf Schwattere, mit den Bedeutungen «Ohrfeige» und «weicher, schwappender Teil am Körper eines Beleibten». Ins Schweizer Hochdeutsch hat es das Wort nicht geschafft, nur manche Mundart hat also ein Pendant zur norddeutschen Quabbe. Die hat man, wie auch Quaddeln, doch allemal lieber im Wörterbuch als am eigenen Leibe.
Weiterführende Informationen
- Indexeintrag «Helvetismen/Hochdeutsch» in den «Sprachlupen»-Sammlungen: tiny.cc/lupen1 bzw. /lupen2, /lupen3. In den Bänden 1 und 2 (Nationalbibliothek) funktionieren Stichwortsuche und Links nur im heruntergeladenen PDF.
 Quelldatei für RSS-Gratisabo «Sprachlupe»: sprachlust.ch/rss.xml; Anleitung: sprachlust.ch/RSS.html
Quelldatei für RSS-Gratisabo «Sprachlupe»: sprachlust.ch/rss.xml; Anleitung: sprachlust.ch/RSS.html
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.