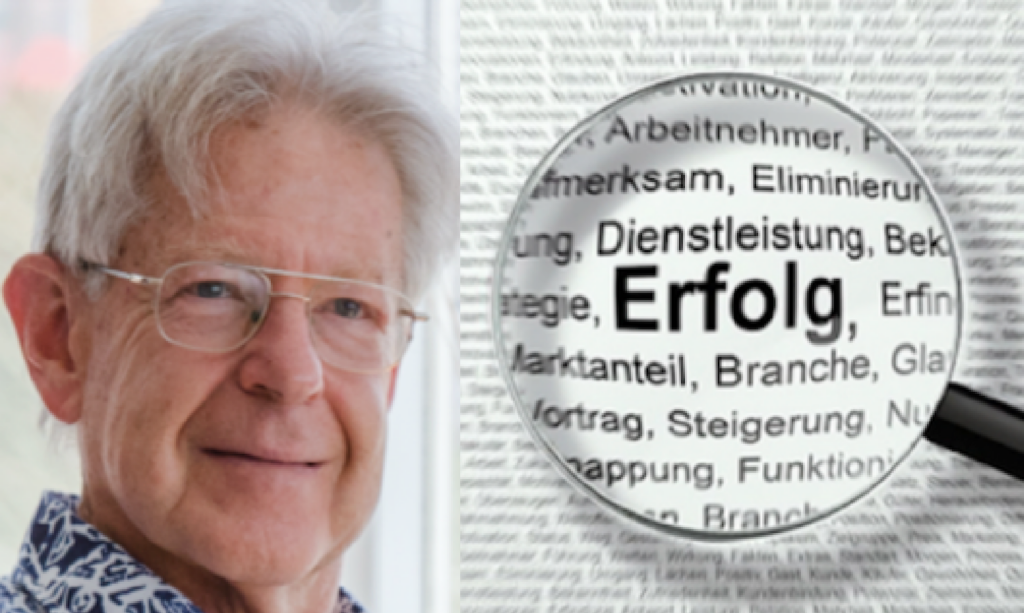Sprachlupe: Haustiere machen den Umfragenkritiker glücklich
«Haustiere als Glücksbringer überschätzt» – eine wissenschaftlich daherkommende Studie unter diesem Titel war in der Vorweihnachtszeit ein gefundenes Medienfressen. In der Schweiz gelangte der Bericht meist unter jener Überschrift in Umlauf, welche die Agentur Keystone-SDA gesetzt hatte: «Einfluss von Haustieren auf Wohlbefinden von Menschen überschätzt». Einzelne Redaktionen griffen Teilergebnisse heraus: «Haustiere machen Familien unglücklicher» oder «Katzen und Hunde machen nicht zufriedener».
Überall sah es so aus, als sei untersucht worden, ob Haustiere Glücksgefühle bringen, machen, beeinflussen. Aber just das war nicht der Fall, wie eine aufmerksame Lektüre der Berichte zeigen konnte. Da war von einer Befragung die Rede, bei der Leute mit und ohne Haustiere ihre «Lebenszufriedenheit» auf einer Skala von 0 bis 10 angeben konnten; die Ergebnisse wurden gesamthaft präsentiert und nach familiärer Situation aufgeschlüsselt, bei Alleinstehenden auch nach Geschlecht: «Bei Single-Männern tragen Hunde … zum Glücksgefühl bei» oder «Single-Frauen mit Katzen oft unzufrieden» (bezogen auf die Lebenszufriedenheit, nicht etwa darauf, die Frauchen hätten an den Miezen etwas auszusetzen).
Momentaufnahme ohne Wirkungsgeschichte
Es war also keine Rede davon, ob sich dieselben Menschen mit oder ohne Haustier glücklicher fühlten; dazu hätte man ja Fallstudien im Zeitverlauf mit und ohne Vierbeiner treiben müssen. Wie heute so oft in der Sozialwissenschaft begnügte man sich mit einer punktuellen Umfrage. Im ursprünglichen SDA-Bericht erfuhr man darüber, es sei eine «Untersuchung für den Glücksatlas in München auf Grundlage von Daten des sozio-ökonomischen Panels» gewesen, geleitet vom «Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg».
Abgesehen von «München» gab es keinen Hinweis, dass hier deutsche Befindlichkeiten betrachtet wurden; eine Uni Freiburg gibt’s ja auch in der Schweiz. Aber der Glücksatlas, im Internet leicht zu finden, hilft weiter: Er wird von der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder herausgegeben; sie ist ebenso in Deutschland zuhause wie die Uni und das «sozio-ökonomische Panel», das einen repräsentativen Querschnitt der deutschen Gesellschaft befragt hat. Neben einer Pressemitteilung ist auch die Haustier-Studie selber abrufbar; beiden gemeinsam ist die hübsche Silbentrennung «Hau-stier».
Die Befragung von 2021 ergab für Menschen mit Tieren eine «durchschnittliche Lebenszufriedenheit» von 7,34; bei solchen ohne war es 7,38. Wie gross der Unterschied sein müsste, um nicht mit Zufall erklärbar zu sein, erfährt man nicht einmal im Studientext. Die Pressemitteilung gibt einen indirekten Hinweis: Bei Paaren ist der Gesamtbefund unentschieden – aber «Ausnahme: Die Phase der Familiengründung, in der ein Hund die Zufriedenheit eines jungen Paares signifikant hebt, … von 7,50 auf 7,77 Punkte.» Auch hier: Es geht nicht etwa ums Hinzukommen eines Hundes, der dann etwas hebt, sondern einfach um junge Eltern mit und ohne Hund.
Zu den Ursachen nur Vermutungen
Dito bei den oben erwähnten Unterschieden zwischen Hund und Katz bei allein lebenden Frauen und Männern. Dennoch geht es im Pressetext zur Studie über Haustiere um die Frage, «machen sie auch glückllich?» (doppeltes l im Original). Der Studientext ist zwar vorsichtiger bei der Zuschreibung von Ursache und Wirkung, behauptet aber doch: «Alleinstehende Männer profitieren von Hunden.» Der vermutete Mechanismus: «So geben vor allem alleinstehende Männer an, sich mit einem Hund weniger isoliert zu fühlen als Männer, die kein oder ein anderes Haustier besitzen. Der Hund sorgt durch regelmässige Gassi-Runden auch für Kontakte mit anderen Menschen.» Nebenbei zeigt sich hier, wie wichtig korrekte Kommasetzung wäre: Da nach «fühlen» keines steht, bedeutet der Satz, die befragten Männer hätten sich beim eigenen Vergleich mit Hundelosen weniger isoliert gefühlt. Gemeint war aber, Befragte ohne Hund hätten selber mehr Isolation angegeben.
Wenn es überhaupt einen ursächlichen Zusammenhang gibt, könnte er auch anders herum gestrickt sein: Leute mit Hang zum Unglücklichsein wollen dem vielleicht mittels Haustier abhelfen. Die Studie deutet in einem Fall in diese Richtung: «Alleinstehende Frauen mit Katze berichten nicht nur häufiger, sich allein und isoliert zu fühlen, sondern machen sich auch überdurchschnittlich viele Sorgen [um andere Themen]. Die Tendenz zum Sorgenmachen könnte erklären, warum Frauen mit Katze insgesamt unzufriedener sind. Inwiefern die Wahl der Katze als Haustier die Unzufriedenheit dieser Frauen tatsächlich beeinflusst, kann nicht beantwortet werden.» So viel Ehrlichkeit hätte der Vermarktung der Studie wohl angestanden, nur wäre das mediale Interesse vermutlich geringer gewesen.
Ursache und Wirkung: «post hoc, ergo propter hoc»?
Wie stark Haustierbesitz und Lebenszufriedenheit gemeinsam auftreten (korrelieren), soll also erklären, ob Haustiere glücklich machen. Das ist ein schönes Beispiel für post hoc ergo propter hoc, von Wikipedia so erklärt: «(lat. danach, also deswegen) bezeichnet einen Fehlschluss, bei dem das (korrelierte) Auftreten zweier Ereignisse ohne genauere Prüfung als Verursachung oder Begründung aufgefasst wird.» Wo Zufriedenheit und Haustiere zugleich gehäuft auftreten, könnte es aber auch deshalb sein, weil Frohnaturen besonders tierlieb sind oder weil ein weiterer Umstand sowohl Tierhaltung als auch Glücksgefühl begünstigt.
Schon Aristoteles hat in seiner «Rhetorik» diese Art Trugschluss erwähnt, in einer ganzen Reihe von Tricks, die es beim Gegner in einer Debatte zu durchschauen gilt: «Ein weiterer ist Nichtursächliches als Ursächliches [zu nehmen], wenn etwas vor oder zugleich mit etwas anderem geschehen ist. Dann führen besonders gern die in der Politik [Tätigen] dieses auf jenes zurück.» (2. Buch, 24. Kapitel, griechisch > S. 106 ab Zeile 24, englische Übersetzung > Absatz 8)
PS. Es muss nicht immer ein Haustier sein, ein Ehegespons ist für frohe Botschaften noch willkommener: «Ehe schützt vor Depression», titelten diese Woche die Tamedia-Zeitungen aufgrund zweier grosser internationaler Studien. Im Artikel stand zwar: «In beiden Studien beschreiben die Forscher Korrelationen, über ursächliche Effekte lässt sich daraus nichts Gesichertes ableiten: Stürzt Partnerlosigkeit in den seelischen Abgrund oder finden schwermütige Menschen nur schwerer einen Partner? Beides ist möglich, beides ist Spekulation.» Aber beim Titelsetzen war offenbar die erstgenannte Spekulation unwiderstehlich, nur ins Positive gewendet, auch im Untertitel: «Feste Beziehungen fördern das seelische Wohlbefinden.»
Weiterführende Informationen
- Sprachlupe: Vom Durchschnittswert zum Gruppenzwang
 Quelldatei für RSS-Feed «Sprachlupe»: sprachlust.ch/rss.xml; Anleitung: sprachlust.ch/RSS.html
Quelldatei für RSS-Feed «Sprachlupe»: sprachlust.ch/rss.xml; Anleitung: sprachlust.ch/RSS.html
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.