Kommentar
Ein Superreicher = 20 Arme + hohe Staatsschulden
Fast alle bisherigen Menschengenrationen haben ohne Geld gelebt und gewirtschaftet. Ihr Sozialprodukt war das, womit sie ihr Leben fristeten und genossen – die Jagdbeute, die gesammelten Beeren, die Muttermilch und der gemeinsame Gesang am Lagerfeuer – der damals noch nicht als Wertschöpfung der Unterhaltungsbrache verbucht wurde. Dieses Sozialprodukt wurde nach Bedarf verteilt, so dass bei der nächsten Jagd alle wieder fit waren und so leistungsgerecht, dass es keinen Anlass zu Neid und Streitereien gab. Die Arbeitsteilung war auf die Aspekte jung und alt sowie Mann und Frau beschränkt.
Mit der Erfindung des Gelds vor rund 10’000 Jahren wurde dieses alte Wirtschaftssystem von einem neuen be- und weitgehend verdrängt. Man arbeitete nun nicht mehr (nur) für den Bedarf der eigenen kleinen Gemeinschaft, sondern produzierte das, was man gut konnte und was man Fremden zu einem hohen Preis verkaufen konnte. Das hatte den grossen Vorteil, dass man sich spezialisieren und insgesamt viel mehr produzieren konnte. Der Nachteil: Das neue System war sehr viel komplexer und erforderte einen hohen Koordinierungsaufwand.
In der Geldwirtschaft wird das gemeinsame Produkt (BIP genannt) zweimal verteilt: Zunächst finanziell mit Geldgutscheinen (Löhne, Dividenden etc.) mit denen man Anspruch auf Teile des BIP erwerben kann. Zweitens durch den effektiven Konsum. Im Idealfall stimmen die beiden Verteilungen genauso überein wie im alten System: Man verdient, was man konsumiert und alle können davon leben. Doch leider neigt die Marktwirtschaft dazu, das BIP finanziell so einseitig zu verteilen, dass es nicht mehr für alle zum Leben reicht.
Das reichste Prozent verdient über eine Million
Konkret sieht das so aus: Gemäss der gesamtschweizerischen Steuerstatistik haben die rund vier Millionen Steuerzahler gut 350 Milliarden oder durchschnittlich 88’000 Franken steuerbares Einkommen deklariert. Das reichste Zehntel kassiert im Schnitt rund 400’000, das reichste Prozent gar über eine Million Franken. Für 400 Schweizer fallen gar 6,4 Millionen oder mehr an (in diesen Zahlen sind die Topsaläre und die Kapitalerträge nicht oder nur teilweise enthalten – die realen Einkommensunterschiede dürften also noch viel grösser sein).
Und weil für jeden Haushalt, der mehr als der Durchschnitt verdient, ein anderer entsprechend weniger kassiert, bleibt für die ärmere Hälfte deutlich weniger übrig. Die Hälfte der Steuerzahler verdient weniger als 60’000 Franken pro Jahr beziehungsweise 5000 Franken pro Monat. Das ärmste Fünftel kassiert von 3000 Franken an abwärts. 10 Prozent liegen unter 2200 Franken. Auf einen Grossverdiener-Haushalt mit 1,2 Millionen Franken Einkommen kommen rein rechnerisch 20 andere Haushalte mit nur 32’000 Franken Einkommen.
Staatliche Zuschüsse und private Schulden
Wäre der physische Konsum genauso einseitig verteilt, wie die finanziellen Einkommen, würden jedes Jahr 10 bis 20 Prozent der Schweizer verhungern. Doch gemäss der Statistik der Haushaltsausgaben konsumiert das ärmste Fünftel der Paarhaushalte unter 65 nur etwa einen Fünftel weniger als der Durchschnitt und immerhin etwa halb so viel wie das reichste Fünftel. Allerdings wird fast die Hälfte des Konsums des ärmsten Fünftels mit staatlichen Zuschüssen und privaten Schulden (oder Zuwendungen) finanziert. Und weil dieses ärmste Fünftel fast nichts in die Altersvorsorge einzahlen kann, ist es nach der Pensionierung erst recht auf staatliche Zuwendungen angewiesen.
Das Leben an der finanziellen Kante ist purer Stress, zumal meist noch schwierige Arbeitsverhältnisse und lange Arbeitswege dazu kommen. Unter diesen Umständen gesund zu leben oder zu bleiben, gelingt nur den wenigsten. Entsprechend steigen die Gesundheitskosten und häufen sich die Verdienstausfälle. Kinder zu haben, wird zumindest für die ärmere Hälfte der Bevölkerung zum Armutsrisiko. Da verwundert es nicht, dass die Geburtenrate inzwischen unter 1,4 Kinder pro Frau gesunken ist.
Auf der anderen Seite kann das reichste Fünftel der Haushalte gemäss Haushaltsstatistik rund 40 Prozent ihres Einkommens auf die hohe Kante legen und dennoch rund 50 Prozent mehr konsumieren als der Durchschnitt. Für die richtig Reichen oberen 5 Prozent gilt erst recht: Luxuskonsum und dennoch hohe Ersparnisse und immer mehr Guthaben. Dessen Gegenstück sind einerseits steigende Staatsschulden und explodierende Immobilienpreise, mit denen letztlich die Mieter der Mittelklasse und der Unterschicht zur Kasse gebeten werden.
Teure Vermögensverwaltung
Das wiederum hat zwei Nachteile. Einerseits müssen die inzwischen rund 6000 Milliarden Franken Vermögen der privaten Haushalte aufbewahrt und verwaltet werden, und es wird mit ihnen spekuliert. Das verschlingt inzwischen über zehn Prozent des BIP und bringt vor allem junge Leute auf die – leider nicht ganz unrealistische Idee –, dass sie mit Finanzspekulationen mehr und leichter Geld verdienen können als mit produktiver Arbeit.
Und dann ist da noch die Sache mit den sozialen Kosten der grossen Einkommensunterschiede. Inzwischen beweisen tausende von Studien, dass Ungleichheit mit fast allen Übeln verknüpft ist – Kriminalität, Selbstmorden, ausserehelichen Geburten, Depressionen, hohen Ausgaben für Polizei und Gefängnisse. Auch das Glück der Oberschicht leidet in Ländern mit hohen Einkommensunterschieden. Und wie soll die Demokratie noch funktionieren, wenn Multimilliardäre die Medien beherrschen und Regierungen kaufen können?
Die Marktwirtschaft verfehlt ihr Ziel
In ihrer aktuellen Verfassung ist die Marktwirtschaft sehr gut darin, möglichst viel zu tiefen Kosten zu produzieren und möglichst teuer zu verkaufen. Das eigentliche Ziel, allen ein gedeihliches Leben zu ermöglichen, verfehlt sie aber bei weitem. Der wohl wichtigste Grund dafür liegt im Verlust einer Fähigkeit, die für den evolutionären Erfolg der Menschheit entscheidend war – Trittbrettfahrer zu bestrafen, etwa mit sozialer Ächtung. Zu diesem Zweck hat uns die Evolution unter anderem den Neid geschenkt. Für Neider ist er zwar eine Belastung, aber für die Gemeinschaft letztlich sehr nützlich.
Die Globalisierung hat uns diesen Trumpf aus der Hand geschlagen. Wer etwa in Norwegen reich geworden ist, kann sich den hohen Steuern seines Heimatlands durch den Umzug in die Schweiz entziehen und wird hier gar geschätzt. Die neue «Heimat» ist ihm dankbar, weil er hier nicht nur mehr Steuern zahlt, als er den Staat kostet, sondern auch weil er mit seinem Luxuskonsum auch noch Arbeitsplätze schafft. In unserer Diskussion um die zunehmende Ungleichheit dominieren denn auch diese zwei Argumente: Die Superreichen zahlen hier Steuern, und sie beschäftigen hier Menschen, die sonst arbeitslos würden. Mag sein, dass das stimmt. Aber es zeigt auch, dass das System nicht fähig ist, echte Bedürfnisse statt Luxuskonsum zu finanzieren.
Natürlich: Der Standortwettbewerb ist nun mal eine Tatsache, die wir nicht ignorieren sollten. Doch Tatsache ist auch, dass die Siegerländer in diesem Wettkampf jetzt schon von der Evolution bestraft werden mit hohen Mieten, niedrigen Geburtenraten und Dichtestress. Deshalb geht es darum, den intellektuellen Horizont zu erweitern und darüber zu diskutieren, wie wir die Geld- und Marktwirtschaft wieder evolutionstauglich organisieren könnten.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





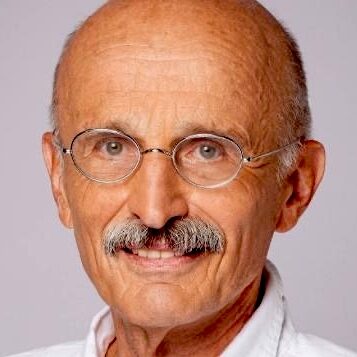




Guter Artikel, dieser Satz ist zu optimistisch:
Und wie soll die Demokratie noch funktionieren, wenn Multimilliardäre die Medien beherrschen und Regierungen kaufen können?
realistischer:
Und wie soll die Demokratie noch funktionieren, wenn Multimilliardäre die Medien beherrschen und Regierungen kaufen?
—
Mathematisch resp. gesetzlich lässt sich das Problem relativ einfach lösen, politisch ist die Menschheit weit davon entfernt, weil sie glaubt: Auch ich kann reich werden und von dieser Ungerechtigkeit profitieren: Ja, jeder kann reich werden! Aber nicht Alle (gleichzeitig)!
ARDtagesschau 05.12.2024 10:46: «Die Zahl der Superreichen und ihr Vermögen ist innerhalb von zehn Jahren rasant gestiegen: Im April 2024 gab es laut einer Studie der Schweizer Bank UBS 2.682 Milliardäre. Das waren gut 50 Prozent mehr als im März 2015..»
NZZ Heribert Dieter 06.02.2025, 05.30: » Der gefährliche Anstieg der Staatsschulden – erzwingen die Finanzmärkte eine Korrektur?»
ARDtagesschau Böckler-Studie 01.07.2024 12:54: «Reallöhne in der EU trotz Tarifplus gesunken»
Interessante Aussage im Artikel: «Die Häufung von Milliardenvermögen ist eine fatale Fehlentwicklung.» Die «Fehlentwicklung» könnte dadurch entstanden sein: der Einfluss und die Macht der Milliardärs-Kaste nimmt kontinuierlich zu, wohl auch auf die Parlamente. Vereinfacht ausgedrückt es könnte ein neues Feudal-System entstehen: eine kleine Schicht nimmt sich alles, und die Mehrheit muss dafür sorgen, dass es den Herrschaften gutgeht und die Demokratie hat sich verabschiedet.
Gunther Kropp, Basel
Danke, verehrter Herr Vontobel
Es ist immer eine Freude und sehr anregend, Ihre Texte zu lesen. Diesem luziden Artikel würde ich (leider wohl vergeblich) eine sehr weite Verbreitung wünschen. (Schul-Pflichtstoff bis hin zur HSG…)
Es wäre dringend geboten, einmal ganz grundsätzlich über die Verhältnisse nachzusinnen. Zumal es inzwischen alle für normal halten, dass die Menschen für die «Wirtschaft» (gemeint sind die Kapitaleigner, aber das wird natürlich nicht gesagt) da zu sein haben, anstatt umgekehrt. Inzwischen sind wir so lange (ca. 35 Jahre) gegeneinander ausgespielt und in sämtlichen Lebensbereichen auf «Wettbewerb» getrimmt worden, dass uns gar nicht mehr auffällt, wie sehr wir uns damit schaden.
Kurzfristig sind Gesellschaften, die auf Konkurrenz statt Kooperation bauen, erfolgreich. Langfristig sind sie alle untergegangen.
Und als wäre es nicht schon genug schlimm, von Armut betroffen zu sein, wird diesen Menschen vielerorts auch noch die volle Verantwortung dafür aufgedrückt. ATD Vierte Welt hat eine sehr aufschlussreiche Studie veröffentlicht, wie sich dies äusserst negativ auf die Gesundheit von Armutsbetroffenen auswirkt und somit noch mehr Kosten generiert.
Meiner Meinung nach liegt der Wurm im Zinssystem: Geld wurde erfunden, um Arbeitsteilung zu ermöglichen. Wer etwas tut, bekommt etwas. Dass man nun etwas bekommt, weil man bereits etwas hat, ist nicht nachvollziehbar.
Herr Vontobel wertet Vermögenskonzentration als Beleg für das Scheitern des Marktes und sieht die Lösung in einem wie auch immer gearteten Sozialismus.
Entscheidend ist nicht die Höhe, sondern die Entstehung von Einkommen. Wer durch freiwilligen Tausch, Sparen und Unternehmertum Wohlstand schafft, nimmt niemandem etwas weg; der Markt ist kein Nullsummenspiel.
Die grössten Ungleichheiten rühren zumeist von politisch gesetzten Privilegien: lockere Geldpolitik bläht Vermögenspreise auf, Regulierungen und Lizenzpflichten verbauen Geringqualifizierten den Einstieg, Subventionen begünstigen gut vernetzte Branchen. Statt Reichtum nachträglich zu konfiszieren, sollten wir diese staatlichen Verzerrungen abbauen.
Armut entsteht dort, wo der Staat mehr verspricht, als produktive Leistung hergibt. Wer fairere Chancen anstrebt, sichert Eigentumsrechte und beschränkt politische Begünstigungen – das wirkt nachhaltiger als jede Zwangsumverteilung.
Gemäss Ihren Theorien gab es also in der Frühzeit der Industrialisierung noch keine Armut, denn da war ja kein Staat, der mehr versprach, als produktive Leistung hergab.
Wenn die Theorien nicht mit der Realität übereinstimmen, sollte man eigentlich die Theorien verwerfen. Es ist allerdings unter marktgläubigen Ökonomen durchaus gebräuchlich, an den Theorien festzuhalten und die Realität zu ignorieren.
Werner Vontobel offeriert in seinem Artikel keine sozialistischen Lösungen. Aber er macht sehr treffend auf Mängel unseres heutigen Systems aufmerksam.
Armut «entsteht» nicht dort, wo der Staat mehr verspricht, als produktive Leistung hergibt. Armut gibt es, wenn die Produktionsleistung eines Kollektivs nicht ausreicht, grundlegende Bedürfnisse seiner Mitglieder zu decken. Wenn man zB zu wenig Fische fängt oder zu wenig Korn wächst. Und die Frage, die sich dann stellt, ist die: Wer soll die Folgen dieses Defizits tragen? Oder abstrakter: Ist «Armut» ein Problem der Konzentration, die auf zu wenig durchdachter oder/und damit «ungerechter» Verteilung resultiert, oder ist es ein grundlegendes Problem zwischen Natur und den Konsumenten (also den Menschen, die ihre Reproduktion gesellschaftlich stemmen müssen)? Dass heute «Armut» vorwiegend in Geldäquivalenten gemessen wird, macht die Sache noch intransparenter.
Herr Lehmann: Herr Heierli trifft bezüglich ökonomischer Theoretiker den Nagel auf den Kopf.
«Freiwilliger Tausch, Sparen und Unternehmertum»?
Wie werten sie die Pharma-Unternehmen, deren völlig überteuerte Produkte (oft basierend auf staatlich subventionierter Forschung) wir via Krankenkasse auch dann bezahlen müssen, wenn wir sie gar nicht selber kaufen? Wie werten Sie die Mono-(bestenfalls Oligo-)polisten der Informatik-Branche?
Wer mit seinem Unternehmen unfassbar reicht wird, verlangt zu hohe Preise und/oder bezahlt den Mitarbeitern keinen fairen Lohn.
Daneben basieren die grössten Ungleichheiten auf schwach besteuertem Erbe.
Vielleicht recherchieren Sie mal zum Monopoly-Experiment des Sozialpsycholo-gen Paul Piff. Sehr erhellend.
In dieses Kapitel gehört auch die leidige Diskussion, wer wie viel in die Sozialwerke «einzahlen» müsse. Sie verschleiert eben den Umstand, dass man bei der Verteilung des Sozialprodukts ansetzen müsste. Wie viel soll in die Löhne gehen, wie viel an die Alten (Renten), wie viel an die Bedürftigen, wie viel an die Kapitaleigner, wie viel an die Chefs und Manager etc.? Stattdessen vertrauen wir für die Verteilung vor allem auf die «Gerechtigkeit» eines Arbeitsmarktes, der es schon in wünschenswerter Weise richten soll. Und was ist mit den externen Kosten der Produktion, die idR niemand «bezahlt»? Der globale Wettbewerb mag seine Vorteile haben (es wird mehr produziert, vielleicht auch effizienter), aber er verzerrt die lokalen Verhältnisse.