Jüdische Kinder: die vergessenen Opfer des Holocaust
Ein Viertel der im Holocaust von den Nazis getöteten Jüdinnen und Juden waren Babys, Kinder und Jugendliche. «Sie alle standen auf den Vernichtungslisten an oberster Stelle und hatten als schwächste unter den Opfern die geringste Chance, den nationalsozialistischen Terror zu überstehen», schreibt Eve Stockhammer in ihrem Buch «Jiskor: Für jedes Kind eine Perle. Zum Kindermord während der Schoa»*.
Wenig beachtete Kindermorde
Trotz einer schier unüberblickbaren Fülle an historischen Analysen und Zeitzeugenberichten zur Verfolgung und Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden und weiterer Minderheiten durch die Nazis fand die Opfergruppe der Kinder bisher erstaunlich wenig Beachtung. Es ist das Verdienst der Berner Künstlerin, Autorin und Psychiaterin Eve Stockhammer, dieses bedrückende Thema endlich ins Licht zu rücken.
Dreiteiliges Gedenkprojekt
Das Buch ist Teil eines grösseren Gedenkprojekts. Es besteht aus einer Kunstinstallation, einer filmischen Begleitdokumentation und eben diesem Buch. Am Anfang stand eine rund einjährige Kollektivarbeit, die zu einem raumfüllenden Gedenkvorhang mit 1,5 Millionen farbigen Glasperlen führte – für jedes ermordete Kind eine Perle. Auf Initiative von Eve Stockhammer hat eine interreligiöse Gruppe von 25 Personen mit einem nahen Bezug zu Judentum und Schoa dieses eindrückliche Werk geschaffen. Es wurde 2024 zuerst in der Berner Oberländer Gemeinde Unterseen gezeigt, 2025 dann in der Berner Synagoge und ebenfalls in Bern im Haus der Religionen. Im Herbst 2025 war der Gedenkvorhang zu Gast in Eisenach im deutschen Bundesland Thüringen, und zwar im Rahmen der Achava-Festspiele; diese widmen sich der interkulturellen und interreligiösen Verständigung mit einem jüdischen Schwerpunkt.
Emotional schwieriges Unterfangen
Während der Gedenkvorhang die unvorstellbare Zahl der getöteten Kinder sichtbar macht, geht das Buch den umgekehrten Weg: Es stellt einige Einzelschicksale ins Zentrum. Das unermessliche Leid, das sich hinter den historischen Begriffen Holocaust oder Schoa verbirgt, wird mit konkreten Geschichten fassbarer. Vertreterinnen und Vertreter der nachfolgenden Generation, die in der eigenen Verwandtschaft Opfer im Kindesalter zu beklagen hatten, setzten sich einem emotional schwierigen und deprimierenden Unterfangen aus: Sie versuchten das Wenige zusammenzutragen, das von diesen Opfern noch in Erfahrung zu bringen war. Mit Hilfe von Erinnerungen, Briefen, Erzählungen, Archivrecherchen und Fotografien schrieben sie Berichte über ihre im Kindesalter ermordeten Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen. Die Texte sind mit Bildcollagen der Kinder sowie weiteren Werken von Eve Stockhammer illustriert, die sich mit dem Kindermord und allgemein mit der Judenvernichtung auseinandersetzen.
Geboren 1939 – ermordet 1942
Es sind starke, beklemmende Texte, keine wissenschaftlich nüchternen, und auch keine literarisch ausgefeilten. Gerade deshalb sind sie so authentisch, man spürt beim Lesen die Betroffenheit der Autorinnen und Autoren. Sie rufen das grauenhafte Geschehen mit grosser Eindringlichkeit in Erinnerung. Was geht in einem Kind vor, das in der Hölle von Auschwitz nach seinen Eltern und seiner Schwester fragt? Und das mit Verweis auf die sichtbaren Kamine der Verbrennungsöfen als Antwort erhält, ihre Angehörigen seien wahrscheinlich dort?
Was geht in jüdischen Eltern vor, die 1939 ein Kind bekommen, mitten in einer extremen Belastungssituation? Wie versuchen sie, ihrem Nachwuchs eine lebenswerte Zeit als Kleinkind zu verschaffen? Fotos zeigen eine scheinbar glückliche Familie, die schon längst die drohende Zukunft ahnte. Die Eltern und der kleine Uri Löwenthal haben nicht überlebt. Der ältere Bruder Peter konnte sich noch rechtzeitig in den USA in Sicherheit bringen, die Eltern und Uri verpassten den richtigen Moment und wurden ermordet. «Es muss das Jahr 1942 gewesen sein. Mehr wissen wir nicht. Uri ist der jüngste Einwohner Straubings, der in der Schoa ums Leben gekommen ist», heisst es im Bericht lakonisch. Dank der Briefe, welche die Mutter bis fast zuletzt ihrem Sohn Peter in die USA geschickt hatte, konnte das Leben des kleinen Uri bis in die letzten Wochen vor seiner Ermordung rekonstruiert werden.
Zwei Schauplätze des Schreckens
Die Kinderbiografien werden durch zwei hervorragende Beiträge ergänzt, die das Geschehen aus einer nochmals anderen Perspektive untersuchen. Statt Einzelschicksale werden zwei historische Schauplätze beleuchtet. Der Historiker und Journalist Daniel Goldstein gibt Einblick in den prekären Kinderalltag im Getto Lodz, die Historikerin Barbara Schwindt schildert als Expertin für das Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek die systematische Ermordung von Kindern.
Kinder wie Gegenstände behandelt
Daniel Goldstein zeigt, gestützt auf die «Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt», wie Kinder auch in diesem mörderischen Umfeld versuchten, ihr Kindsein bei Spiel und Musik auszuleben – so gut es eben ging. Er schildert aber auch, mit welch hemmungsloser Brutalität die Nazi-Schergen bei Razzien wüteten. So berichtet etwa ein Augenzeuge von einer Hausdurchsuchung, «bei der Säuglinge aus dem Fenster geworfen und Kleinkinder mit dem Bajonett aufgespiesst wurden».
Im Artikel von Barbara Schwindt stehen die Misshandlungen im Zentrum, die meist den systematischen Ermordungen vorausgingen. Mütter, die sich wehrten, als man ihnen die Kinder wegnahm, wurden blutig geschlagen. Viele Frauen rannten aus Verzweiflung in die elektrisch geladenen Stacheldrahtzäune. Kinder, die die Gewaltexzesse überlebten, tötete man nach wenigen Wochen in den Gaskammern. Bei diesen so genannten «Kinderaktionen» fuhren Lastwagen vor die Baracken, um die Kinder abzuholen. Die Leitung der Aktionen lag in den Händen des SS-Lagerarztes Dr. Blancke. Besondere Brutalität legten zwei SS-Aufseherinnen an den Tag: Sie «packten die Kleinkinder an den Füssen und warfen sie wie Gegenstände auf die Ladefläche», wie es im Bericht heisst.
«Auschwitz setzt alle lineare Zeit aus»
Was man in diesem Buch liest, kann niemanden unberührt lassen. Man wird es kaum in einem Zug lesen. Man muss es immer wieder weglegen, weil es nicht einfach ist, das Gelesene auszuhalten: «… und es gehört doch ausgehalten. Es ist unerträglich, und es muss angenommen werden als Aufgabe. Wir müssen es als unerträglich erkennen und es zu ertragen versuchen. Es ist geschehen und dauert an. Auschwitz setzt alle lineare Zeit aus.»
Dies schreibt Carolin Emcke in ihrem Nachwort zu einem der ersten Augenzeugenberichte. Dieser wurde kurz nach der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee im Januar 1945 verfasst und ist 1950 auf Ungarisch und erst 2024 auf Deutsch erschienen (Jozsef Debreczeni: «Kaltes Krematorium: Bericht aus dem Land namens Auschwitz», Fischer 2025).
Die Aussage von Carolin Emcke gilt in gleichem Masse für das vorliegende Werk. Nicht allein das Buch, das gesamte Erinnerungsprojekt von Eve Stockhammer zu diesem Jahrtausendverbrechen ist aus einem weiteren Grund von eminenter Bedeutung: «Wer sich verschwört, die Erinnerung an die Opfer auszulöschen, der tötet sie ein zweites Mal.» Diesem Diktum des Holocaust-Überlebenden und Friedensnobelpreisträgers Elie Wiesel ist nichts beizufügen.
___________________
Dieser Beitrag erschien zuerst auf «Journal21»
___________________
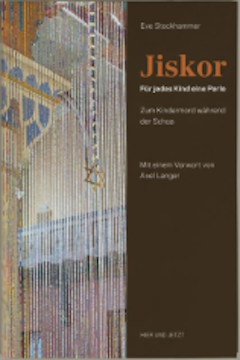
Eve Stockhammer: «Jiskor: Für jedes Kind eine Perle. Zum Kindermord während der Schoa». Verlag Hier und Jetzt, Zürich 2025, 184 S., CHF 39 CHF
Eve Stockhammer ist freiberufliche Künstlerin, Autorin und Psychiaterin. Sie beschäftigt sich mit psychologischen und gesellschaftshistorischen Fragen zum Judentum und zur Schoa, zu sexueller Gewalt sowie administrativer Versorgung. Von ihr sind schon mehrere Publikationen erschienen, u. a. «Geigen im Schnee» (2019) und «Kaddisch zum Gedenken» (2023).
Urs Hafner in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»: «Eigentlich weiss man es ja. Die Nationalsozialisten machten bei ihrer Verfolgung und Ermordung von Juden nicht vor Kindern und Babys halt. Man weiss es, und doch lässt einen dieses Gedenkbuch erschüttert zurück.»
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.










ARD Tagesschau 27.01.2023 06:01 Susanne Petersohn: «Mehr als 1,5 Millionen ukrainische Juden ermordet..»
L.IS.A. PD Dr. Grzegorz Rossoliński-Liebe | 19.02.2022: «..wurde die Westukraine gewaltsam zu einem ethnisch homogenen Raum umgestaltet. Die OUN und die im Winter 1942 von ihr aufgestellte Ukrainische Aufständische Armee (UPA) trugen dazu maßgeblich bei. OUN-Mitglieder schlossen sich der ukrainischen Polizei im Westen des Landes an und halfen den deutschen Besatzern bei der Ermordung von etwa 800.000 Juden.»
Bedingt durch den Ukraine-Krieg wird auch der Holocaust in der Ukraine beleuchtet. Und statistische Zahlen veröffentlicht wieviel Juden ermordet wurden. Keine Silbe über die jüdischen Kinder, die den Nazi-Schergen zum Opfer fielen, die unter dem Sammelbegriff ermordete Juden zugeordnet werden. Es ist an der Zeit, dass die Gruft der Vergessenheit geöffnet wird, dass gezielt und bewusst jüdische Kinder ermordet wurden.
Gunther Kropp, Basel
In diesem Kontext empfiehlt es sich, das Buch von Norman Ohler mit dem Titel «Der totale Rausch» zu lesen. Darin wird aufgezeigt, wie ungeheuerlich stark der Drogenkonsum während dieser Zeit von den Akteuren im Dritten Reich war.
Und es zeigt, was Drogenkonsum anrichtet: Menschen werden zu Monstern. Nur solche können die im Buch von Eve Stockhammer beschriebenen, schrecklichen Taten ausführen.