Kommentar
KI in der Schule: Es droht die soziale Isolation
Die «NZZ am Sonntag» hat es kürzlich so formuliert: die Kinder swipen anstatt zu fragen. Sie eignen sich ihr Wissen auf digitalem Weg selbst an. Wozu braucht es also die Schule noch? Auch wenn man die Schulen nicht ganz abschaffen möchte, ist eines klar: Sie stehen durch KI unter grossem Druck.
Zuerst waren es vor allem Aufsätze und andere Hausaufgaben, die an Chatbots wie Chat-GPT delegiert wurden. «Faule» Schülerinnen und Schüler erreichten damit gute Noten, ohne dass Lehrpersonen es bemerkten. Mittlerweile hat sich das allerdings herumgesprochen. Lehrerinnen und Lehrer müssen versuchen, Aufgaben so zu formulieren, dass sie nicht einfach mit einer KI-Anfrage erledigt werden können.
Aber auch wenn man den Unterricht versäumt oder etwas nicht verstanden hat, kann man das durch Erklärvideos oder Anfragen an die KI ausgleichen. Die «NZZ» berichtet von einem Schüler, der im Unterricht zum Konzept der Achsenspiegelungen geträumt hatte. KI erschien da als Nothelfer: «Willst du zuerst das Prinzip verstehen oder gleich Aufgaben lösen?»
So sieht der Artikel in der «NZZ» die Schule in einigen Jahren: Die Schülerinnen und Schüler lernen zunehmend neben der Schule mit Lernvideos, Apps, Plattformen und künstlicher Intelligenz. Was früher als Ergänzung zur Schule diente, droht für viele Kinder und Jugendlichen zur eigentlichen Quelle des Wissens zu werden.
Der unklare KI-Begriff
Allerdings bleibt diffus, was unter Künstlicher Intelligenz verstanden wird. Was im Mittelpunkt steht, sind die generativen Sprachmodelle (LLMs) der grossen Tech-Konzerne. Sie wurden mit riesigen Datenmengen trainiert und simulieren Denken und Problemlösen, indem sie Texte zusammenfassen, Bilder erkennen oder Fragen beantworten.
In der Diskussion um KI in Schulen wird allerdings fast jede digitale Lernhilfe genannt, die mit Lernen zu tun hat. Selbst Erklärvideos oder Tiktok-Clips werden als Teil des neuen Lernens mit KI vermarktet. Es ist oft nicht einmal klar, ob bereits eine einfache Google-Suche unter KI fällt oder erst die komplexen Suchalgorithmen von generativen Sprachmodellen. Inflationär gebraucht wird das Label «KI-gestützt»: Sind etwa Lernkärtchen automatisch schon Teil des «intelligenten Lernens»? Solche Kärtchen gab es schon lange vor der Entwicklung der künstlichen Intelligenz.
Das Beispiel des adaptiven Lernens
Besonders deutlich zeigt sich die Unschärfe bei der Diskussion zu adaptiven Lernplattformen. Ein Beispiel ist «Bettermarks» für den Mathematikunterricht der Klassen 4 bis 13. Angepasst auf die einzelnen Lernenden umfasst das Lernsystem mehr als 200’000 Übungen und Aufgaben. Lernpfade verknüpfen Inhalte und begleiten alle Phasen des Unterrichts – vom Vorwissen bis hin zu Tests und kompetenzbasierter Auswertung. Dies soll helfen, das Lernen stärker auf den individuellen Lernstand der Schülerinnen und Schüler abzustimmen.
Allerdings stehen dahinter behavioristische Verhaltensmodelle, die schon im 20. Jahrhundert entwickelt wurden. Neu ist vor allem die gigantische Datenbasis. Damit wird aber nicht mehr Kreativität und Problemlösen in die Schule gebracht, sondern eine Effizienzsteigerung in der Anpassung an vorgegebene Leistungsprofile.
Die Grenzen der KI in der Schule
Die Gefahr besteht, dass der Hype um KI schnell als grundlegende Bildungsreform der Schulen des 21. Jahrhunderts gesehen wird. Die KI soll das Lernen übernehmen und den Unterricht automatisch an die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler anpassen.
Doch es wäre ein verheerender Ansatz, wenn zentrale Vermittlungsrollen von Maschinen übernommen würden. Es ist zu befürchten, dass ein oberflächliches Lernen erzeugt würde, das sich weitgehend auf eine Kultur des Auswendiglernens konzentriert. Tragende Lernerfahrungen entstehen jedoch erst im persönlichen Austausch, im Dialog und in der kritischen Reflexion zwischen Lehrpersonen und Lernenden.
Gerade bei kleinen Kindern ist das soziale Lernen und der damit verbundene Kontakt zu realen Lehrkräften unverzichtbar. Ein unbedachter Einsatz von KI in Kindergarten und Primarschule könnte sich ähnlich isolierend erweisen wie das Fernlernen in Corona-Zeiten. KI an der Stelle von Präsenzunterricht könnte eine Generation zurücklassen, der die sozialen Kontakte fehlen.
Es ist allerdings sinnvoll, KI bei älteren Schülerinnen und Schülern schrittweise in den Unterricht zu integrieren. Ziel ist es, diese zu befähigen, KI kritisch und kreativ zu nutzen: nicht bloss Antworten abzurufen, sondern Fragen zu stellen, Ergebnisse zu prüfen und die Systeme als Unterstützung bei komplexen Problemlösungen einzusetzen. Es geht also nicht darum, Antworten der KI unhinterfragt zu übernehmen, sondern zu lernen, wie man diese Werkzeuge als Ausgangspunkt für eigenes, kritisches Denken nutzt. Beat Schwendimann, Leiter Pädagogik des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) ist davon überzeugt, dass KI-gestütztes Lernen im Vergleich zu traditionellen Lernmethoden durchaus einen geringen bis moderat positiven Effekt auf den Lernerfolg haben könne.
Gleichzeitig müssen Schülerinnen und Schüler aber auch lernen, mit den Schwächen von KI umzugehen: mit Halluzinationen, oberflächlichem Halbwissen, ideologischen Färbungen. Dazu ein Beispiel von Chat-GPT: Auf eine Frage nach der neuen amerikanischen Botschafterin Callista Gingrich in der Schweiz gab der Chatbot erst einen wenig sagenden Lebenslauf zum Besten. Dann nannte er Standardantworten zur Arbeit einer Botschafterin wie «Förderung der Religionsfreiheit», «Bekämpfung des Menschenhandels», «Bereitstellung humanitärer Hilfe». Erst nach mehrfachem Nachfragen gab Chat-GPT zu, die Botschafterin sei die Frau des Sprechers des Repräsentantenhauses, der als zentrale Figur der konservativen Bewegung in den USA gelte. Und es wird ihre politische Nähe zu Donald Trump und zum republikanischen Establishment erwähnt. Kritisches Nachfragen und Reflektieren ist also notwendig, wenn man nicht mit oberflächlichem Faktenwissen abgespeist werden will.
Soziale Risiken und Machtkonzentration
Die Digitalisierung droht auch, die soziale Ungleichheit zu verstärken. Denn Jugendliche aus bildungsfernen oder einkommensschwachen Haushalten sind häufig weniger technikaffin und brauchen die Unterstützung der Schule. Wer frühzeitig KI-Kompetenzen erwirbt, sichert sich den Zugang zu attraktiven Berufsfeldern. Denn gleichzeitig verschwinden einfache und handwerkliche Berufe, die abgebaut oder automatisiert werden.
Gleichzeitig droht eine Machtkonzentration: Politik, Wirtschaft und Tech-Eliten arbeiten immer enger zusammen. Beim jüngsten royalen Staatsbankett in Windsor Castle etwa waren neben Monarchen und Politikern auch Sam Altman und Tim Cook zu Gast – Symbol der Allianz von Technologie und Macht. Damit stellt sich die Frage, ob KI eines Tages auch zur gesellschaftlichen Kontrolle von Schule und Bildung missbraucht wird. Umso wichtiger sind klare Datenschutzregeln, die den Interessen der grossen Konzerne Grenzen setzen – auch wenn sie den Technologie-Baronen um Trump zutiefst missfallen.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Heinz Moser war bis 2013 Professor für Medienpädagogik an Pädagogischen Hochschule Zürich.
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





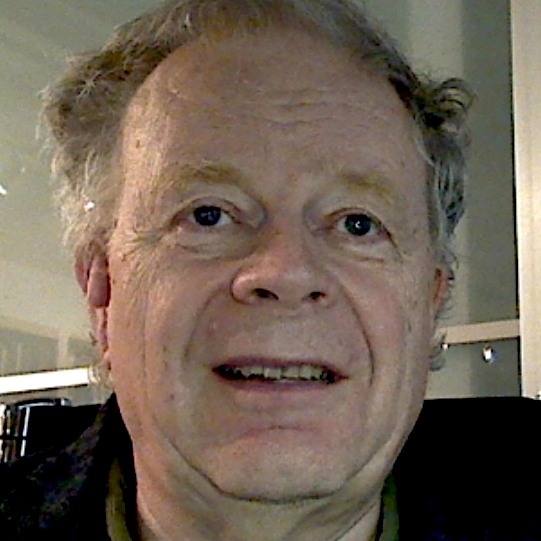


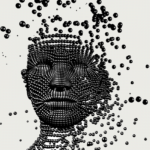


Ich gehe einig damit, dass KI grosse Gefahren beinhaltet, die wir beachten müssen. Jedoch sehe ich dem Ganzen relativ gelassen entgegen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns als Menschheit mittel- und langfristig dieses enorme Mengen an Energie fressende, externe Hirn leisten können und wollen.