Gesucht: Finanzprofessoren, die von Banken unabhängig sind
Ehemalige Aktionäre der Credit Suisse halten den Kaufpreis von drei Milliarden Franken, den die UBS für die Credit Suisse zahlte, für viel zu tief. Sie klagten vor dem Handelsgericht Zürich. Dieses beauftragte Roger Neininger und Professor Peter Leibfried als Gutachter. Sie sollen den umstrittenen Wert der CS-Aktien zum Zeitpunkt der Fusion ermitteln.
Die Universität St. Gallen als Arbeitgeberin von Professor Peter Leibfried lässt sich von der UBS mehrere andere Professuren zahlen. Der Lehrstuhl für Auditing und Accounting von Leibfried am gleichnamigen Institut der Universität St. Gallen wird vom Buchprüfungskonzern KPMG bezahlt. KPMG war von 1989 bis 2021 Hauptrevisorin der Credit Suisse. In dieser Funktion hatte die KPMG den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der CS an den Aktionärsversammlungen 2013 und 2014 trotz schwerer Vorwürfe der Aufsichtsbehörde Finma vollumfänglich entlastet.
Co-Gutachter Roger Neininger war CEO und Verwaltungsratspräsident der KPMG.
Doch eine Befangenheitsklage gegen die zwei Gutachter hat das Zürcher Handelsgericht abgewiesen.
Das ist nur das jüngste Beispiel möglicher Interessenkonflikte.
Einseitig ausgerichtete Forschung
Die meisten Finanzprofessoren an Universitäten betreiben vor allem Forschung, die den Akteuren auf dem Finanzplatz und den Grossbanken dient. Wenn es jedoch um das Debakel der Credit Suisse geht oder darum, wie man das Klumpenrisiko der UBS in den Griff bekommt, glänzte die grosse Mehrheit der vielen Schweizer Finanzprofessoren durch Schweigen. Es meldeten sich vor allem Wirtschaftsprofessoren und Wirtschaftshistoriker.
Das hat einen einfachen Grund: Universitäre Finanzinstitute und Finanzprofessoren erhalten ziemlich viel Geld von den Grossbanken. Diese Sponsoren hüten sich zwar, auf eine wissenschaftliche Arbeit oder eine wissenschaftliche Zeitschrift direkten Einfluss zu nehmen. Die Geldempfänger ihrerseits beteuern, dass die Sponsoren nicht dreinreden würden und sie sich unabhängig fühlten.
Das Problem: Die Forschenden machen meistens einen Bogen um Fragestellungen, die bei den Grossbanken nicht gut ankommen würden. Für viele Fragestellungen, die für Bürgerinnen und Steuerzahlende wichtig sind, seien die meisten Finanzprofessoren «einfach blind», erklärte der emeritierte Finanzprofessor Marc Chesney im April 2024 auf Infosperber und zählte eine ganze Reihe von Tabus auf. Chesney galt unter den Finanzprofessoren als Aussenseiter und Nestbeschmutzer. Von den Banken unabhängig, berechnet Chesney gegenwärtig, ob die Aktien der CS beim Kauf durch die UBS mehr wert waren als die drei Milliarden Franken, welche die UBS dafür bezahlen musste. Als Gutachter wurde er nicht beauftragt.
Ein weiterer Aussenseiter ist der emeritierte Finanzprofessor Heinz Zimmermann, der in Basel lehrte und in Bern noch einen Lehrauftrag hat. Für die Tatsache, dass viele Forscher praxisnahe Fragestellungen meiden, sieht er noch einen weiteren Grund: Solche Arbeiten würden die Karriere junger Forscher nicht unbedingt fördern, weil sie in akademischen Journals weniger publizierbar und an Tagungen weniger gefragt seien. Zudem sei es schwieriger, dafür kompetitive Drittmittel wie etwa Fördermittel des Nationalfonds zu erhalten.
In der «Sonntagszeitung» sprach Zimmermann ein strukturelles Problem an: «Es gibt nicht mehr viele wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten in der Schweiz, die nicht von Swiss Finance Institute (SFI) gesponsert werden und damit als unabhängig zu betrachten sind». Das SFI ist eine private Stiftung mit Geschäftsstellen in Zürich und Genf und wird von der Bankiervereinigung finanziert. Den grössten Beitrag zahlt die UBS.
Wie wichtig es sei, dass Forscher unabhängig bleiben, zeige das Paper der Wirtschaftsprofessoren Dirk Niepelt und Cyril Monnet sowie Remo Taudien von der Universität Bern vom Mai 2025, das den Grossbanken wohl nicht gefalle: Staatliche Liquiditätshilfen seien als Subventionierung der Grossbanken zu betrachten.
Professor Zimmermann, der heute emeritiert ist, rechnete in einem Gutachten für Bundesrätin Karin Keller-Sutter zum Leidwesen der UBS aus, dass die Vorschläge der Bundesrätin die UBS längst nicht so viel kosten würden wie von Sergio Ermotti behauptet.
Besonders bei Gutachten sei die Unabhängigkeit der Autoren kritisch zu prüfen, sagt Zimmermann.
Interessenkonflikte sind eklatant
Insgesamt rund 25 Finanzprofessoren in der Schweiz, darunter mindestens fünf an der Universität Zürich, kassieren vom SFI jedes Jahr je mindestens 50’000 Franken zusätzlich zu ihrem regulären Lohn. Wer diese Zuschüsse will, muss «Exzellenzkriterien» des SFI erfüllen. Darüber entscheidet ein Beirat des SFI. Der SFI evaluiert dann alle fünf Jahre, ob die Lehrstuhlinhaber die ‹wissenschaftliche Exzellenz› weiterhin erfüllen und entscheidet, ob sie weiterhin ihren Bonus erhalten. «Das Lamm» und die «Republik» hatten im September 2024 einen Mustervertrag veröffentlicht.
Ausserdem finanziert die UBS der Universität Zürich seit 2012 das «UBS Center for Economics in Society» mit 100 Millionen Franken. 2020 hat die UBS ihr Engagement mit einer weiteren Spende von 25 Millionen Franken verlängert. Der Stiftungsrat des Centers ist teils mit Vertretern der UBS sowie Hochschulprofessoren besetzt.
Die Universität St. Gallen ist seit Frühjahr 2022 offizielle Partnerin des SFI. Das Ostschweizer Wirtschaftsportal «Leader» meldete erfreut:
«Die Fakultät des Swiss Finance Institute mit Sitz in Genf und Zürich gehört zu den weltweit führenden Denkfabriken in der Finanzforschung. Das Institut – getragen von den Banken in der Schweiz – hat massgeblichen Anteil daran, die wissenschaftlich abgestützte Kompetenz des Schweizer Finanzplatzes sicherzustellen. An der SFI-Fakultät beschäftigen sich renommierte Professoren der Universitäten Genf, Lausanne, Lugano und Zürich sowie der ETH Zürich und der EPFL mit finanzwissenschaftlichen Fragestellungen. Neu zählt auch die Universität St.Gallen (HSG) zu diesem illustren Kreis.»
Ausserdem hat die Universität St. Gallen eine Partnerschaft mit der CS und heute UBS: Die Grossbank zahlt innerhalb von zehn Jahren 20 Millionen Franken für Lehrstühle, Institute und Forschungszentren wie das «Center for Financial Services Innovation».
«Kritisches Denken wird schwierig»
Der emeritierte Finanzprofessor Marc Chesney gibt folgendes zu bedenken:
«Selbst beschränkte private Zuschüsse lenken die Ausrichtung von Bildung und Forschung potentiell in eine Richtung, die privaten Interessen dient. Die Universität hat finanzielle Anreize, sich nach den Vertretern der Finanzwelt zu richten und ihre Forschungen deren Agenda anzupassen. Kritisches Denken wird schwierig; es wird verdrängt von der Fähigkeit, technische Kompetenzen zu reproduzieren. Die ständigen Instabilitäten des Finanzsystems und dessen soziale Auswirkungen bleiben vernachlässigt.»
Weitere «uneigennützige» Finanzierungen von Sponsoren
Der Autokonzern Emil Frey Holding AG zahlt der Wirtschaftswirtschaftlichen Fakultät der Universität Zürich 12,7 Millionen Franken, damit diese ein Forschungszentrum «UZH Center for the Future of Personal Mobility» realisieren kann. Das Zentrum soll «die unterschiedlichen individuellen Mobilitäts-Bedürfnisse der Menschen» untersuchen, erklärte Walter Frey, Verwaltungsratspräsident der Emil-Frey-Gruppe.
Auto-Schweiz, der Verband der Schweizer Auto-Importeure, bezahlt fast drei Millionen Franken während acht Jahren für einen Lehrstuhl ausgerechnet am Institut für Mobilität an der Hochschule St. Gallen (HSG).
Der Zigarettenkonzern Philip Morris zahlte über 100’000 Franken für eine Studie der Universität Zürich. Sie kam zum Schluss, dass neutrale Zigaretten-Verpackungen ohne Markenwerbung den Konsum von Zigaretten nicht bremsen.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.








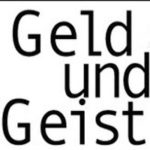

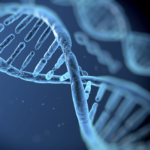


Le Monde diplomatique Wolfgang Wodarg 08.06.2012: «Käufliche Wissenschaft erzeugt hingegen Misstrauen und Ratlosigkeit. Medien wie Geld, Macht oder Wissen sind nur von Nutzen, wenn die Menschen spüren, dass sie ihnen eine bestimmte Funktion zu Recht anvertraut haben…Die zunehmende Instrumentalisierung der Wissenschaft, die von Sponsoreninteressen geleitete Auswahl von Publikationen oder Unterdrückung von Forschungsergebnissen, .und gekaufte Unbedenklichkeitsgutachten,…Das Bonmot „Ich glaube nur noch den Studien, die ich selbst gefälscht habe“ gibt es treffend wieder
Sehr beachtenswerte Aussage im Artikel: «Die meisten Finanzprofessoren an Universitäten betreiben vor allem Forschung, die den Akteuren auf dem Finanzplatz und den Grossbanken dient..»
Die Grossmanager und Herren des Geldes könnten wohl erkannt haben mit Kohle gedeiht die Manipulation, wenn willige Akteure gute Arbeit leisten, die sich gut bezahlen lassen und so ist alles möglich.
Gunther Kropp, Basel