Wenn das Tempo der Entwicklung ethische Werte erodiert

Red. Thomas Kesselrings neues Buch «Ethik im Bildungswesen» ist für uns Anlass, mit ihm über den «Notstand im Bildungswesen» und die «Veränderungen unseres ethischen Selbstverständnisses» zu reden. Thomas Kesselring war bis 2013 Professor an der Pädagogischen Hochschule Bern und bis 2015 Dozent an der Pädagogischen Universität von Mosambik. Er war zehn Jahre lang Vorstandsmitglied des Jungendprojekts LIFT, das Jugendliche schweizweit bei der Lehrstellensuche unterstützt. Thomas Kesselring informiert auf Infosperber bereits seit 2016 über den Kreditskandal in Mosambik und die Rolle der Credit Suisse.
Unsere Schule ist ein gesellschaftlicher Hotspot: Zu grosse Klassen, Lehrermangel, Burnout, Helikopter-Eltern, eine Reform jagt die nächste, kurz: Die Schule ist in der Krise. Und jetzt kommen Sie mit der Ethik!
Thomas Kesselring: Die Krise hat viele Ursachen. Eine davon ist, dass wir Ethik ungenügend verinnerlicht haben. Das scheint mir ein dringendes Problem zu sein, das für die Bildung insgesamt gilt. Ich denke nicht nur an die Schule, sondern auch an die Ausbildung von Lehrkräften, an die Ausbildung von Berufsleuten überhaupt und damit auch an die Hochschulen.
Was bedeutet Ethik im Bildungswesen?
Ethik ist eine Reflexion auf Moral, wobei Moral oft mit erhobenem Zeigefinger daherkommt und sagt, was man sagen darf, was nicht, was man tun darf, was nicht. Im Gegensatz dazu ist Ethik nicht ein Sammelsurium von Normen oder gar Befehlen. Sie ist eine Reflexion darauf und Diskussion darüber, welche Normen, also welche Regeln wir voneinander erwarten wollen, aber auch, welche Freiheiten, welche Rechte wir uns gegenseitig zugestehen wollen.
Was ist so eine Norm, so eine Regel, mit der sich Ethik zentral beschäftigt?
Während meiner Gastprofessur in Brasilien haben mich die Wohlstandsunterschiede sowohl innerhalb des Landes wie auf internationaler Ebene schockiert. Ich habe dann angefangen über das Verhältnis der Schweiz zur sogenannten Dritten Welt, wie man damals noch gesagt hat, Überlegungen anzustellen. Also habe ich mit Ethik in erster Linie mal das Thema Gerechtigkeit verbunden – Gerechtigkeit zunächst einmal im Sinn von Verteilungsgerechtigkeit. Man weiss inzwischen, dass das Glücksgefühl der Menschen – auch der wohlhabenden – umso tiefer sinkt, je steiler das Wohlstands- und Chancengefälle in einer Gesellschaft ist.
Die Ethik beschränkt sich aber nicht auf Gerechtigkeit: Ethik hat beispielsweise sehr viel mit Einfühlung, mit Empathie zu anderen Personen und anderen lebenden Wesen überhaupt zu tun. Es gibt auch so etwas wie eine Ethik gegenüber der eigenen Person, in dem Sinn, dass man auch an sich selbst Ansprüche stellt und dass man den Ansprüchen, die man an andere stellt, auch selbst nachkommt. Das sind so einige Hotspots in der Ethik.
Bleiben wir bei der Bildung. Eine wichtige Schnittstelle zwischen Ethik und Bildung ist die Machtfrage.
Macht, finde ich, ist ein Begriff, der häufig einseitig verstanden wird. So ist beispielsweise die Auffassung, Macht sei etwas Schlechtes oder Böses, recht verbreitet. Ich denke, hier wird Machtausübung mit Machtmissbrauch verwechselt. Es gibt auch eine ganz andere Auffassung, nämlich dass Macht eine notwendige Begleiterscheinung sozialer Organisationen generell ist. In jeder Gesellschaft bestehen Machtstrukturen. Macht wird verteilt. Und wer über Macht verfügt, trägt entsprechend auch Verantwortung – das kann man kaum genug betonen.
Jetzt gibt es aber noch eine ganz andere Komponente von Macht, die oft völlig ausgeklammert wird. Das französische Wort für Macht ist «le pouvoir». «Pouvoir» ist aber auch ein Verb und heisst «können». Das ist im Spanischen genau gleich: «Poder» bedeutet ebenso Können wie Macht. Das sind praktisch Synonyme. Das Gegenteil, Ohnmacht, steht für die Unfähigkeit, etwas zu können. Im Englischen existiert das Wort «empowerment». Was von Pädagogen manchmal übersehen wird, ist, dass die Lehrkraft aufgrund ihrer Stellung in der Klasse zwar eine Art Machtposition einnimmt, dass diese Machtposition aber mit dem Auftrag verbunden ist, die Schüler zu empowern. Macht ist also nichts Schlechtes – sie ist im Grunde genommen etwas Neutrales.
Ethisch zentral ist die Frage, wie Macht eingesetzt wird. Macht kann missbraucht werden. Was den Machtmissbrauch von der verantwortungsvollen Machtausübung unterscheidet, ist letztlich eine ethische Frage.
Eine andere Schnittstelle zwischen Schule und Ethik ist der Dauerbrenner Chancengleichheit.
Ja, das Stichwort «Dauerbrenner» ist leider keine Übertreibung. Echte Chancengleichheit ist wahrscheinlich gar nicht erreichbar.
Wie meinen Sie das?
Wichtig ist der Begriff aber als anzustrebendes Ziel, an dem man sich jederzeit orientieren kann. Auch wer nicht an den Nordpol reisen will, ist manchmal froh, wenn er weiss, in welcher Richtung er liegt. Man kann das Leben, und insbesondere die Phase des Einstiegs ins Berufsleben – von dem dann grossenteils auch die Stellung abhängt, die man in der Gesellschaft einnimmt –, als einen Wettbewerb auffassen. Nicht alle gewinnen, was sie sich wünschen. Das Ergebnis des Wettbewerbs ist Ungleichheit – das liegt in der Natur der Sache. Schön wäre es, wenn wenigstens der Ausgangspunkt für den Wettbewerb für alle in etwa gleich wäre. Das ist das, was ich unter Chancengleichheit verstehe.
In Ihrer Arbeit verbinden Sie Bildung mit der Demokratie. Aktuell läuft der Trend gegen die Demokratie. Warum?
Zwischen Bildung, Ethik und Demokratie sehe ich eine enge Verbindung. Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Bürgerinnen und Bürger mündig, also autonom sind. Autonom auch im ethischen Sinne, nämlich so, dass sie nicht nur für sich selbst autonom entscheiden können, sondern gleichzeitig auch die autonomen Entscheide der anderen respektieren. Was wir als «diskriminieren» bezeichnen, ist nichts anderes als die Verweigerung dieses Respekts. Dabei sollten wir immer auch mit im Blick haben, welches die Regeln sind, die wir gemeinsam einzuhalten bereit wären.
Welche Rechte und Freiheiten wünschen wir uns, und welche Pflichten sind wir bereit, auf uns zu nehmen, damit wir uns gegenseitig diese Rechte und Freiheiten garantieren können? Das ist, meines Erachtens, eine der wichtigsten Grundlagen der Demokratie. Wenn die Menschen ihre Mündigkeit, ihre Autonomie, verlieren, bricht die Demokratie zusammen. Ebenso, wenn sie die Mündigkeit der anderen nicht anzuerkennen bereit sind. Ich sehe eine grosse Gefahr, dass so etwas jetzt passieren könnte. Der Begriff der autonomen Person zerbröselt. Die klassische Theorie zum Thema stammt von Immanuel Kant. Er hat in seiner Ethik diese Zusammenhänge durchdacht. Daraus ist dann auch die Idee der Menschenrechte hervorgegangen.
Auch die Menschenrechte sind unter Beschuss!
Ja, und das humanitäre Völkerrecht ist im Begriff, aufgegeben zu werden. Meines Erachtens befinden wir uns in einer gefährlichen Schieflage.
Gegen die Menschenrechte hört man vor allem zwei Argumente: Die Menschenrechte seien ein Konstrukt des Westens, und genau dieser Westen beachte sie nur, wenn es ihm gerade passt – eine Politik der double standards.
Das scheint mir beides richtig. An der Ausarbeitung der Erklärung der Menschenrechte haben allerdings auch Personen aus China, der Sowjetunion, dem Libanon und Chile teilgenommen. Trotzdem ist der Tenor der europäischen Aufklärung unverkennbar. Dennoch spricht dieses Uno-Dokument gemeinsame kulturübergreifende Vorstellungen an, die einer universalen Geltung der Menschenrechte nahekommen.
Das grössere Problem, das Sie ansprechen, sind die Doppelstandards des Westens. Sie sind ganz und gar offensichtlich! Die Afrikaner, Asiatinnen und Lateinamerikaner erkennen sie anscheinend viel deutlicher als wir selbst, weil wir in diesem Punkt befangen sind.
Wie kann Bildung der Erosion der Demokratie und der Menschenrechte entgegenwirken?
Das ist eine schwierige Frage. Mein kleines Buch ist ja als Versuch gedacht, an ein paar Dinge zu erinnern, die mir wesentlich erscheinen. Aber ich würde lügen, wenn ich behauptete, den Ausgang aus dem Tunnel im Visier zu haben. Ich bin im letzten Jahrtausend geboren worden und fühle mich dort auch geistig beheimatet. Was ich bisher gesagt habe, entspricht eigentlich dem Wissensstand der 80er-Jahre.
Die Erosionsprozesse haben in den 90er-Jahren begonnen, die politisch stark vom Neoliberalismus und akademisch – an den Universitäten – von einem Relativismus geprägt waren: Alle Wahrheit sei historisch und von Machtstellungen abhängig, wurde damals gemunkelt (wobei mir immer unklar war, welchen Wahrheitsgrad denn solche Sätze haben konnten). Theorien wurden zu Narrativen umdefiniert. Auch die Erzählung vom Rotkäppchen ist ein Narrativ. Eine wissenschaftliche Theorie, wie Einsteins Relativitätstheorie, wird damit auf eine Stufe mit dem Rotkäppchen gestellt.
Donald Trump setzt jetzt noch eins obendrauf. Er sagt, schon der Unterschied zwischen wahr und falsch sei überflüssig. Der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt nennt, was jemand mit dieser Einstellung sagt, schlicht «Bullshit». Offenbar ist heute in gewissen Ländern der Bullshit mehrheitsfähig geworden. Auf dieser Basis ist inzwischen schon so viel erodiert, dass ich nicht weiss, was man jetzt auf welche Weise wieder aufbauen kann.
Was hat die Erosion der ethischen und humanitären Werte verursacht?
Erstens die Ökonomisierung der Gesellschaft, einschliesslich der Bildung: Ökonomische Werte werden über die ethischen gestellt. Zweitens hat die Fixierung auf Wettbewerb die Wertschätzung der Kooperation zurückgedrängt, und Ethik hat viel mit Kooperation zu tun. Und drittens die Digitalisierung, die zunehmende Verdrängung seriöser Berichterstattung durch den «Bullshit» der sozialen Medien.
Ich möchte aber noch eine ganz andere, grundsätzliche Überlegung erwähnen, nämlich die zunehmende Geschwindigkeit des Wandels. Die Geschichte schreitet immer schneller voran. Wir sind heute alle Getriebene. Es gibt immer mehr Erfindungen, immer mehr Innovationen. Wir müssen uns immer schneller umgewöhnen. Damit lassen wir natürlich auch, wie soll man sagen, manche Werte aus der Vergangenheit hinter uns zurück. Jede Generation lebt heute in ihrer eigenen Welt und stellt entsprechend auch eigene Forderungen. Die älteren Semester kommen den davonjagenden Innovationen nicht mehr hinterher. Und diese zunehmende Geschwindigkeit, flankiert von einer Ungleichzeitigkeit der Mentalitäten, schafft Verwirrung. Die Orientierung wird immer schwieriger.
Woher kommt diese Geschwindigkeit?
Da gibt es zwei ganz simple Gründe, die voneinander unabhängig sind. Der erste ist die Demografie. Heute leben acht Milliarden Menschen auf der Erde. Vor 100 Jahren waren es anderthalb bis zwei Milliarden. Die Bevölkerung hat sich also mindestens vervierfacht. Vor 100 Jahren konnten etwa 20 Prozent der Menschen lesen und schreiben, heute sind es 80 Prozent. Wieder eine Vervierfachung. Wir sind mit einer enormen Vermehrung der Tüftler und Erfinder konfrontiert. Wir sollten uns also nicht wundern, dass es heute pro Jahr viel, viel mehr Erfindungen gibt als vor 100 Jahren.
Und der zweite Grund?
Das zweite Argument ist mathematischer Natur – es geht um Kombinatorik. Wenn die Zahl der Erfindungen linear steigt, dann steigt die Zahl der möglichen Kombinationen von Erfindungen exponentiell. Beispiel: die Drohne. Das ist eine neue Erfindung. Man kann sie mit früheren Erfindungen kombinieren, zum Beispiel mit einer Kamera ausrüsten, mit dem GPS oder einer Rakete. Eigentlich müssten wir die Geschwindigkeit der Entwicklung bremsen, damit sie uns nicht überrollt.
Deshalb haben selbst die KI-Forscher ein Time-out vorgeschlagen.
Das wäre eigentlich richtig, hat aber nicht funktioniert, weil man Angst hatte, die Chinesen würden uns überholen. Hier kommt der Imperativ durch den Wettbewerb hinzu, der uns vorschreibt: Macht noch schneller und noch mehr!
Auch die Ethik ist keine konstante Grösse. Sie entwickelt sich dynamisch. Sie arbeiten mit dem interessanten Begriff «Dezentrierung». Was bedeutet er?
Ich übernehme diesen Begriff von Jean Piaget. Er bedeutet die Überwindung von Zentrierungen. Wörter wie Egozentrismus, Eurozentrismus, Anthropozentrismus sind ja bekannt. Es geht um deren Überwindung. Diese Dezentrierung ist vielleicht in erster Linie eine intellektuelle, eine kognitive Aufgabe. Doch sind dabei auch unsere Emotionen gefordert.
Selbstdistanz!?
Genau, Selbstdistanz – als Gegensteuer zum Egozentrismus. Beim Eurozentrismus geht es um den Versuch und die Übung, Europa nicht als Nabel der Welt, sondern als einen Teil des Globus neben anderen, ähnlich bedeutsamen Teilen zu sehen. Zur Dezentrierung gehört immer als zweiter Schritt die Koordination mit anderen Standpunkten, die in etwa auf gleichem Level stehen. Ethik, meine ich, hat mit Dezentrierungsprozessen ganz direkt zu tun.
Thomas Kesselring, Sie haben über diese Themen und Fragen das Buch «Ethik im Bildungswesen» geschrieben. Wer soll es lesen?
Alle, die sich für solche Fragen interessieren. Beim Schreiben habe ich besonders an die Lehrerbildung, die Pädagogik und die Philosophie gedacht. Und an Lehrkräfte. Ich schliesse nicht aus, dass auch Theologen und Psychologen da und dort «andocken» könnten.
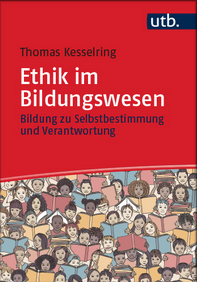
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.










Ich weiss die Begriffe bedeuten nicht genau das gleiche, das Zitat von Brecht erscheint mir aber trotzdem passend.
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral!