Die Schweiz, das Psycho-Paradies
Red. Dies ist ein Gastbeitrag von Dietmar Luchmann. Luchmann ist Psychotherapeut mit jahrzehntelanger Erfahrung.
_____________________
Am Samstag demonstrierten in Bern Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Der Grund: zu niedrige Tarife, zu wenig Therapieplätze, zu viel Bürokratie. Die mediale Deutung liegt bereit: ein Versorgungssystem in der Krise.
Doch wer sich die Forderungen unter dem Veranstaltungstitel «Psychische Gesundheit für alle – Versorgungskrise stoppen» genauer anschaut, entdeckt weniger ein Gesundheitsproblem als eine Anhäufung berufsständischer Denkfehler: Psychotherapeuten, die sich weigern, selber zu denken.
Psychische Gesundheit als Grundrecht? Eine Bankrotterklärung
«Psychische Gesundheit ist ein Grundrecht – kein Luxus.» So formuliert ein Psychologe seinen Aufruf zur Demonstration. Dieser Satz klingt mitfühlend, modern, menschenfreundlich. Aber – sachlich betrachtet – ist er Unsinn.
Gesundheit ist nie ein einklagbares Gut, weder körperlich noch psychisch. Kein Gesetz, keine Institution, keine Krankenversicherung kann garantieren, dass es jemandem gut geht.
Psychische Gesundheit ist kein Lieferprodukt. Sie ist das Resultat – nicht das Recht – einer aktiven Auseinandersetzung mit sich selbst, mit selbstschädigenden Denkmustern, blinden Flecken emotionaler Verletzungen, Verzerrungen gegenüber der Wirklichkeit.
Wer psychische Gesundheit als «Recht» formuliert, verkehrt das Verhältnis von Ursache und Wirkung. Er entzieht dem Individuum die Verantwortung – und verschiebt sie auf das System. Dabei ist genau diese Entlastungsfantasie das erste Hindernis jeder erfolgreichen Psychotherapie: der Mangel an Selbstverantwortung und Eigenständigkeit.
Was Psychotherapie wirklich ist
Wer sich auf eine Psychotherapie einlässt, sollte wissen: Ein Psychotherapeut kann keine Probleme lösen; er kann sie nur sichtbar machen und Lösungswege aufzeigen.
Wirksame Psychotherapie, die kognitive Verfahren beinhaltet, ist ein Anleitungssystem zur Selbsthilfe, kein Reparaturbetrieb. Sie funktioniert nur dann, wenn der Patient nicht zum Konsumenten wird, sondern zum Mitarbeitenden.
Das Ziel ist Selbstverantwortung, nicht Versorgung. Die besten Psychotherapeuten helfen nicht beim Wohlfühlen, sondern lehren gesundes Denken.
Wer das verstanden hat, erkennt: Der entscheidende Schritt zur psychischen Gesundheit ist nicht die «Versorgung durch andere», sondern die geistige Eigenleistung beim Überwinden krankmachender Denkfehler. Das gewünschte Gefühl des Wohlbefindens ist nur erreichbar durch das kognitive Umlernen leiderzeugender Denk- und Verhaltensmuster.
Das Qualitätsproblem
Die Realität sieht anders aus. Ein grosser Teil der sogenannten Psychotherapie besteht heute aus strukturlosen Gesprächen: empathisch, freundlich, therapeutisch dekoriert. Aber inhaltlich substanzlos.
Es wird geredet, getröstet, gebauchpinselt, aber nicht am realitätswidrigen Denken gearbeitet, das den Nährboden für Angststörungen, Panikattacken, Depressionen bildet.
Seit Jahrzehnten zeigt die Psychotherapie-Forschung: Mit kognitiven Psychotherapie-Verfahren sind die meisten dieser Störungen in durchschnittlich zehn Stunden zu beseitigen. Sogar, wenn sie zuvor Jahrzehnte durch untaugliche Behandlungen chronifiziert wurden.
Doch viele Patienten erleben jahrelange Sitzungen, ohne dass sich Grundüberzeugungen, Verhalten oder Lebensführung verändern. Das liegt nicht nur an ihnen. Sie sind in dem verbreiteten Denkfehler gefangen, es sei die Aufgabe von Psychotherapeuten, dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen.
Psychotherapeuten verstärken diesen für sie bequemen Denkfehler, gefühlige Plaudereien überbezahlt als Psychotherapie zu verkaufen. Sie scheuen die Anstrengung, selber zu denken und eigenes Denken einzufordern, weil die Erkenntnis der Denkfehler weh tut.
Solche «Plauderstunden» wären nicht weiter problematisch – wenn sie nicht von der Allgemeinheit finanziert würden. Sie werden aber bezahlt wie medizinische Behandlungen. Und genau hier beginnt der Skandal.
Therapie ohne Kontrolle – ein absurdes Privileg
Die medizinische Grundversorgung ist streng reguliert. Chirurgen, Internisten, Radiologen müssen ihre Methoden rechtfertigen, Wirkungen nachweisen, sich evaluieren lassen. In der Psychotherapie hingegen genügt oft ein Gespräch pro Woche und das richtige Formular, damit die Krankenversicherung zahlt. Über Jahre hinweg. Ohne Wirksamkeitsprüfung, ohne Nachweis des Therapieerfolges.
Dass die SVP-Nationalrätin Martina Bircher kürzlich forderte, dass Psychotherapien wegen «Alltagsproblemen» nicht über die Grundversicherung abgerechnet werden dürfen, wurde von Berufsverbänden als Angriff auf die psychische Gesundheit gewertet. Dabei ist es schlicht ein Appell an ökonomische Vernunft – und an therapeutische Ehrlichkeit.
Selbstbeteiligung als wirksamster Therapieansatz
Eine Erfahrung eint alle guten Psychotherapeuten: Die wirksamsten Therapien beginnen dort, wo die Patienten selbst in sich investieren. Auch finanziell. Wer für die eigene Entwicklung bezahlt, beteiligt sich. Wer sich beteiligt, verändert sich.
Die vollständige Kostenübernahme durch Krankenversicherungen mag sozialpolitisch gut gemeint sein – psychologisch ist sie oft kontraproduktiv. Die Ideologie dahinter ist ein klassisches Beispiel, Ordnung auf Kosten des Weiterdenkens zu propagieren. Denn sie schafft die Illusion, man könne mentale Veränderung konsumieren.
Es bedarf keiner Psychotherapeuten, sondern gesunden Menschenverstandes, um zu verstehen: Veränderung beginnt mit Eigenverantwortung. Und Verantwortung zeigt sich zuerst im eigenen Handeln.
Ein Berufsstand in der Vermeidungshaltung
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten fordern immerfort mehr Ressourcen. Aber sie liefern keine Qualitätssicherung. Sie klagen über zu wenig Plätze, aber verteidigen endlose Psychotherapien ohne Ziel. Sie beanspruchen die Deutungshoheit über die seelische Gesundheit, argumentieren jedoch wie Lobbyisten auf Eigenbedarf.
Die Schweiz hat laut der OECD-Statistik von 2014 im internationalen Vergleich mit auffällig deutlichem Abstand die meisten Psychiater pro Kopf der Bevölkerung – doppelt so viele wie Island, das Platz zwei innehat.
Die OECD-Befragung der Schweizer Psychiaterinnen und Psychiater ergab, dass deren Behandlungsdauer rund 60 Monate beträgt. Das ist jenseits aller Standards wirksamer Psychotherapie.
Als Antwort auf die von der SVP-Nationalrätin Sylvia Flückiger-Bäni am 11. Dezember 2014 eingereichte Interpellation 14.4178 zur «Psychiater-Schwemme in der Schweiz» bestätigte der Bundesrat die OECD-Statistik in einer Stellungnahme vom 06. März 2015: «Die Schweiz weist die deutlich höchste Psychiaterdichte auf», steht dort.
Seither sind gut zehn Jahre vergangen. In der Schweiz gibt es mittlerweile mehr Psychiater und Psychotherapeuten in privater Praxis als Allgemeinmediziner und Kinderärzte. Wer sich auf das Wagnis einlässt, ein wenig selber zu denken, erkennt: Es gibt nicht zu wenig Fachpersonen, sondern zu viele ineffiziente Therapien.
Die zentrale Frage lautet: Warum scheut ein Berufsstand, dessen wichtigstes Arbeitsinstrument das vernünftige Denken ist, die Analyse des eigenen Denkens so konsequent? Die Antwort ist unbequem: Weil es einfacher ist, sich versorgen zu lassen, als sich in Frage zu stellen.
Was in der Patiententherapie als Vermeidung bezeichnet wird, nennt man in der Berufspolitik «Systemkritik». Nur dass das System hier nicht das Problem ist – sondern das Selbstbild einer Profession, die sich weigert, ihre eigenen Methoden kritisch zu hinterfragen.
Fazit
Die Krise der psychotherapeutischen Versorgung ist real. Aber sie ist nicht nur eine Frage von Tarifen, sondern eine Frage der intellektuellen Redlichkeit. Wer wirklich psychische Gesundheit fördern will, muss zuerst den Mut haben, sich von der Illusion zu verabschieden, sie sei ein Rechtsanspruch. Psychische Gesundheit ist keine Leistung des Gesundheitssystems – sie ist die Leistung des selber denkenden Menschen an sich selbst.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Dietmar Luchmann ist Psychotherapeut mit jahrzehntelanger Erfahrung in der gesetzlichen Krankenversicherung und Inhaber der Angstambulanz am Zürichsee. Der Beitrag wurde zuerst am 14. August 2025 auf der Website des Autors veröffentlicht.
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.







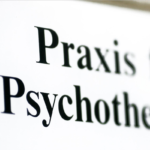


Sehr interessanter fundierter Artikel – danke für den Denkanstoss!
Kümmerte sich jeder mehr um sich selbst, statt um andere, ginge es allen besser – so sehe ich diesen Beitrag. Aus eigener Erfahrung kann ich Herrn Luchmann nur zustimmen. Jeder, sofern er kann, ist verpflichtet, seiner Gesundung mit allen Kräften nachzuhelfen. Auch die Physiotherapie – deren Erfolge sich besser nachweisen lassen – hilft nur, wenn die Patienten die Übungen beharrlich und selbstständig durchführen. Viele fallen in alte Verhaltensmuster zurück; die Behandlung war umsonst.
Dietmar Luchmann stört sich daran, dass gewisse Therapien zu lange dauern. Kann sein. Oder auch nicht. Gerade eine Psychoanalyse dauert eben. Und vielleicht verfällt er ja auch dem neoliberalen Effizienzdenken, dass der Output bitte subito. Und die Aussage «Psychische Gesundheit ist ein Grundrecht» verstehe ich eher so, dass damit gemeint sei, das Grundrecht gelte für die Therapie, also einen Platz dafür zu bekommen. Glaube kaum, dass die Autoren des Satzes meinen, dass die Psychotherapie per Recht alles heilen kann.
Danke für diese Einsicht eines Insiders.
Als ausgebildeter Sport Mentalcoach bin ich dankbar, dass meine Kunden ihre mentale Gesundheit selber in die Hand nehmen. Mentale Entwicklung, welche man selber in die Hand nimmt, ist der erste entscheidende Schritt zum Erfolg. Dafür selber zu bezahlen hat zwei gewinnbringende Punkte
1. Der Klient verpflichtet sich selbst das investierte Geld gut zu nutzen.
2. Ich als Coach sehe nicht die Milchkuh sonder den Menschen der von mir gefördert und gefordert wird.
Ich arbeite im Sport und Buissnes als Coach mit gesunden Menschen, ich möchte mir nicht anmassen psychiche Krankheiten zu heilen, aber zumindest würde dieser Ansatz vielen weiterhelfen, denn Heilung beginnt von innen.