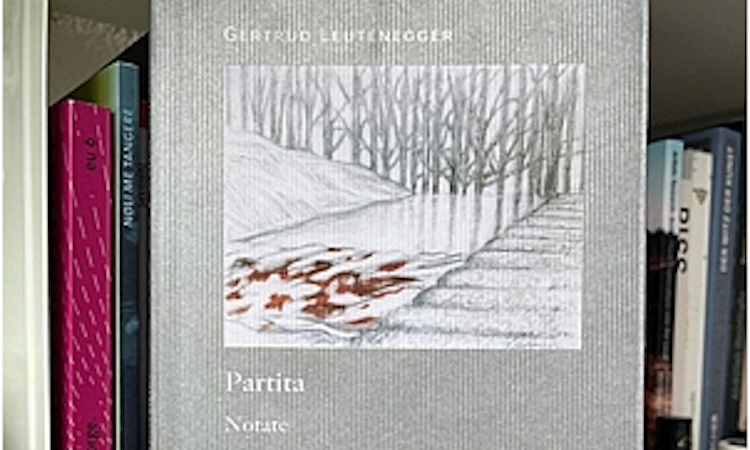kontertext: Der unverbrüchliche Halt des Schweigens
Wenn dieser Text sich dem «Verstummen» von Gertrud Leutenegger widmet, dann nicht, um einen Kontrast zu markieren: Sie war keine Literatin, die immer und überall ihre Stimme erhob, sich einmischte oder auf sich aufmerksam machte. Sie war leise und als leise wird auch ihr Schreiben jetzt in einigen Nachrufen gewürdigt. Ich schreibe hier von ihrem Verstummen, um den Schock des unerwarteten Todes, dessen genaue Umstände nicht bekannt gegeben wurden, zu benennen. Die Verschwiegenheit und das Schweigen wiederum hat viel mit dem Werk und der Poesie von Gertrud Leutenegger zu tun.
Den Schattierungen des Schweigens auf der Spur
Im Roman «Späte Gäste» von 2020 kehrt die Ich-Erzählerin in das Tessiner Bergdorf zurück, in dem sie einst lebte, um Totenwache zu halten für einen Mann, zu dem sie eine Beziehung hat, die unaussprechlich bleibt. Die ganze Nacht vor der Totenmesse verbringt sie an der Seite des verstorbenen Orion in der Kapelle, versunken in einen Reigen an Stille und innerer Zwiesprachen. Die Stille und das Schweigen werden zu den Protagonisten dieser Nacht. «Daß man an so viel Stille erwachen kann, ich wußte es nicht.» Und später am Morgen begegnet ihr im Blick des Wirts, «das versammelte Schweigen der vergangenen Jahre, der unverbrüchliche Halt, der Glaube, mit dem er ihr ganzes Wesen erwärmt hat». – Dabei bleibt ungewiss, ob diese Figur Vision, Erinnerung oder Traumgestalt ist. Dass er das Schweigen wahrt über die lange Zeit, seit die Ich-Erzählerin bei ihm Zuflucht suchte mit ihrer Tochter vor dem jetzt verstorbenen Orion ist hier Pietät, Rücksicht, Schutzmantel für die Trauer: ein Schweigen, das Halt gibt.
Wir sind in unseren «Kontertexten» in diesem Sommer den Schattierungen des Schweigens auf der Spur, um seine unterschiedlichen Valenzen zu finden. In einer Zeit von feigem Totschweigen in der Politik auf der einen Seite, dem Getöse der Ankündigungen und Schwachsinn der Verlautbarungen auf der anderen Seite kann der eigentliche Sinn des Schweigens nur gewürdigt werden, wenn wir genau hinhören, warum geschwiegen wird. Hätten wir die literarische Sprache, die Kunst und die Musik nicht, wir wüssten nicht, wo und wie ihn finden. Eine Fermate in der Musik, die unheimliche Leere in den Bildern von Hopper, die überraschende Auslassung in einem Text, das beredte Schweigen im Close-Up von Filmstars oder die längere Pause in einem Drama, in welchem die Worte plötzlich fehlen – das sind Gelegenheiten, mit dem Sinn des Schweigens in Kontakt zu kommen.
Das Schweigen ist mehr als eine Kunstform: es eröffnet grundsätzlich einen Zwischenraum, der uns stutzig macht. Wie das trotzige Verweigern der Nationalhymne auf dem Rasen, in welchem Michel Mettler das Gras wachsen hört. Schweigen kann, so Mettler, «die Tiefe der Oberfläche, der Abgrund des Gewöhnlichen» spürbar machen.
Dem Äussersten entlangschreiben
Um zu würdigen, was das Schweigen als Thema, Grund und Schatz der Literatur vermag, muss es immer wieder kontextualisiert werden. Es lässt sich nicht hypostasieren, ohne in die Nähe von Pathos, Irre und Metaphysik zu geraten. Das wusste auch Gertrud Leutenegger. Eines der letzten Notate in ihrem letzten Buch «Partita», erschienen 2022 im Nimbus-Verlag, lautet wie eine Warnung vor dieser Gefahr:
«Dem Äussersten entlangschreiben, doch seiltänzerisch sicher vor allem Verschrobenen, Verstiegenen, Wahnsinnigen».
Es ist einer der Sätze in diesen Notaten, die je auf einer ganzen Seite allein stehen – umgeben vom Schweigen des weissen Blattes. Die Sätze stammen aus vielen Jahrzehnten ihres Schreibens und sind nun testamentarisch. Die in diesem Satz enthaltene Selbsteinschätzung trifft ihre Poetik sehr präzis. Nicht wenige von Leuteneggers Figuren leben verschroben in den Gefilden halb-mythologischer Ordnungen, ohne den Halt eines Lebensentwurfs oder einer festen Meinung, nicht selten im Schweigen und nahe dem Wahnsinn. Und oft ist das Äusserste dessen, was ihnen widerfährt, die Liebe. «Der Feuerschein der Liebe, welcher die träumende Materie durchstrahlt: Alles wird Hinweis, Gären, Aufflackern, eine einzige Obsession». Keiner von Gertrud Leuteneggers Romanen kommt ohne dieses Feuer aus, immer gibt es einen Mann, um welchen herum die Obsessionen und Phantasien der Ich-Erzählerin gelagert sind.
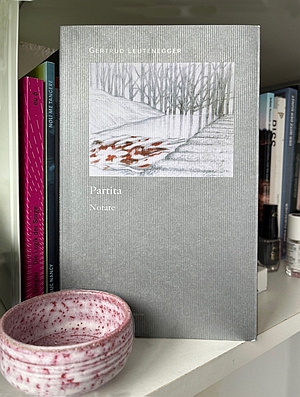
Vielleicht ist es die Tragik eines Schriftsteller- und Schriftstellerinnenlebens, dass es seine Glut und Obsession im Schreiben finden muss, wo die Kontrolle über den Text immer «seiltänzerisch» die Oberhand behält. Vielleicht ist Getrud Leutenegger an einem gebrochenen Herzen gestorben, sie war eine Romantikerin und konnte sich zuletzt nicht mehr selber zum Leben und damit auch zur Literatur verführen. Ihr für die Aussenwelt jäher Tod erzeugt – wie jeder andere Tod – einen Nachhall zu ihrem Werk. «Nicht das vordergründige Geschehen, sondern der Hallraum ist das Entscheidende». Ein Hallraum ist zunächst kein Text, kein Getöse, kein Rumoren. Er ist Weite und Klang. Und eigentlich Schweigen.
Zur Erinnerung
Vor zwei Jahren erhielt Getrud Leutenegger den grossen Solothurner Literaturpreis, vor einem Jahr den grossen Kulturpreis der Stadt Zürich. In Solothurn verlasen zwei Schauspielerinnen die Laudationen von Eva Seck und Ruth Schweikert. Auch die Sätze von Ruth Schweikert sind bald testamentarisch geworden: sie erlag wenig später ihrem Krebsleiden. Sie hat Gertrud Leutenegger früh als Wesensverwandte gesehen mit der bleibenden Beobachtung, dass die Erzählerinnen bei Gertrud Leutenegger, wohin sie auch gehen, in die Fremde gehen. – Auch der Tod ist und bleibt fremd als letzte Destination, er lässt sich literarisch nicht beruhigen, wenn er eintrifft. Aber es sei auch erinnert an die Worte von Eva Seck damals: Man möchte Gertrud Leutenegger immer zur Verfügung haben, um mit ihr das Aussergewöhnliche der Welt zu erkunden. Ihre Texte stehen dafür zur Verfügung – ihre Stimme jedoch ist verstummt. In ihrem Heimatort Schwyz wird die Dichterin ihre letzte Ruhe finden.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Silvia Henke ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Publizistin. Sie unterrichtet an der Hochschule Luzern Design & Kunst u.a. Kunst und Politik und visuelle Kultur. Forschungsschwerpunkte sind Kunst und Religion, künstlerisches Denken, transkulturelle Kunstpädagogik. Sie interessiert sich grundsätzlich für die Widersprüche der Gegenwart, wie sie auch in der Medienlandschaft auftauchen, und veröffentlicht regelmässig Texte und Kolumnen in Magazinen und Anthologien.
Unter «kontertext» schreibt eine externe Gruppe von Autorinnen und Autoren. Sie greift Beiträge aus Medien auf, widerspricht aus journalistischen oder sprachlichen Gründen und reflektiert Diskurse der Politik und der Kultur. Zurzeit schreiben regelmässig Silvia Henke, Mathias Knauer, Michel Mettler, Felix Schneider und Beat Sterchi.
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.