Tschüss Abgas – grünes Methanol für Handelsschiffe
Der Löwenanteil des Welthandels passiert auf dem Wasser, grösstenteils mit fossilen Rohstoffen. Die Schifffahrt verursacht drei Prozent der Treibhausgase weltweit. Tanker, Containerschiffe und Frachter verschmutzen die Luft dazu mit Russ, Stick- und Schwefeloxiden, auch in der Nähe von Binnengewässern wie dem Rhein.
Grünes Methanol könne das ändern, sagt Greenpeace. Grüner, das heisst mit Hilfe von grüner Energie aus nachhaltigen «Rohstoffen» wie Wasser und Luft erzeugter Methylalkohol (CH3OH) habe viele günstige Eigenschaften. Methanol sei flüssig, leicht zu handhaben und als Schiffstreibstoff gut geeignet, fasst eine Studie des DLR-Instituts für maritime Energiesysteme im Auftrag von Greenpeace zusammen.
Erschienen ist die Studie kurz vor einer Tagung der International Maritime Organisation (IMO) in London im April. Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation arbeitet seit Jahren daran, Schweröl durch den weniger umweltschädlichen Marinediesel zu ersetzen. Der Schwefelausstoss der Handelsschifffahrt ist dadurch gesunken, der Treibstoff aber noch immer fossil. Auch Antriebe mit dem Flüssiggas LNG sind kein echter Fortschritt für das Klima.
IMO plant CO2-Steuer und Abgas-Sanktionen
Jetzt plant die IMO den nächsten Schritt. Die Mitgliedsstaaten der UN-Organisation einigten sich im April, die klimaneutrale Schifffahrt durch CO2-Steuern anzukurbeln. Und die IMO setzte Emissionsziele für die Jahre bis 2035 fest. Bis 2030 soll beispielsweise der Treibhausgasausstoss der Schifffahrt um 20 Prozent geringer sein als 2008. Mitgliedsländer, die die Klimaziele nicht erreichen, werden sanktioniert. Dazu soll es ein Credit-System geben und einen Klima-Fonds. Bis 2050 soll die globale Schifffahrt klimaneutral sein.
Mit welchem Treibstoff das geschehen soll, legt die IMO nicht fest. Grünes Methanol könnte dabei aber eine wichtige Rolle spielen.
Zunächst ist aber jede Menge zu tun. Die Schiffe, die in zehn Jahren auf den Weltmeeren fahren, werden jetzt gebaut oder umgerüstet. Über ein klimafreundliches Antriebssystem wird also heute entschieden. Dazu braucht es Infrastruktur wie Lager und Tankstellen in möglichst allen wichtigen Häfen und natürlich genügend Treibstoff.
Welches Antriebssystem darfs denn sein?
Welcher Treibstoff ist am besten? Wasserstoff? Oder doch grünes Methanol? In der Diskussion sind auch Ammoniak und Biogas sowie Agrartreibstoffe wie Sojaöl, die die meisten Umweltorganisationen ablehnen. Und dann gäbe es noch E-Motoren, die durch Batterien angetrieben werden. Ein Überblick:
1) Emissionsfreies E-Ship mit Elektromotor und Batterie
Akkus für Schiffe, die mit grünem Strom betrieben werden, sind relativ gross und schwer. Bisher eignen sie sich nur für kleine Schiffe und kurze Strecken. Das resümiert zumindest das DLR-Institut, das sich im Folgenden nicht weiter damit beschäftigt.
Die «Klimareporter» halten batteriebetriebene Schiffe bis 1000 Kilometer Strecke für konkurrenzfähig. Lange Ladezeiten stellen kein wirkliches Problem dar, weil Schiffe oft lange in Häfen liegen, argumentieren sie. Und die Binnenschifffahrt könnte durch Austauschbatterien flexibler und klimaneutraler werden. Die Infrastruktur dafür gibt es zwar noch nicht, Strom allerdings in jedem Hafen. Auch Hybridantriebe sind möglich.
2) Die Wasserstoff-Lösung fürs Container-Terminal
Sogenannte Dual-Fuel-Lösungen aus 15 Prozent Diesel und 85 Prozent Wasserstoff gibt es auch für Wasserstoffantriebe. Alternativ kann Wasserstoff direkt und ohne Vorbehandlung in eine Brennstoffzelle eingespeist werden – ein klarer Vorteil. Verbrennungsantriebe lassen sich für die Wasserstoffnutzung umbauen. Die ersten Wasserstoff-Schiffe fahren bereits.
Allerdings ist noch unklar, woher genügend grüner Wasserstoff kommen soll. Die Lagerung und der Transport von Wasserstoff in Tanks erfordert tiefe Temperaturen oder hohen Druck und ist entsprechend aufwendig. Für grössere Schiffe gibt es noch kaum Infrastruktur.
3) Ammoniak für Frachtgut & Co.
Das sieht bei Ammoniak deutlich besser aus. Herstellung, Transport und Lagerung sind etabliert und weit weniger aufwendig als bei Wasserstoff. Auch Ammoniak-Schiffe gibt es bereits (Infosperber berichtete). Man kann Wasserstoff in Ammoniak (NH3) umwandeln, um einen leichter transportierbaren Treibstoff zu bekommen.
Vor der Nutzung wird Ammoniak dann wieder zurückgewandelt. Er kann aber auch direkt in einem angepassten Dieselmotor verbrannt werden. Bei der Verbrennung von Ammoniak entstehen Stickoxide, die Abgase müssen dann gereinigt werden. Die Nachfrage nach grünem Ammoniak sei derzeit drei- bis viermal höher als die Produktionskapazitäten, schreibt das DLR-Institut in seiner Studie für Greenpeace. Und: Ammoniak ist giftig.
4) Methanol aus Luft und grünem Wasserstoff
Zurück zum Methanol – das so gut wie gar nicht giftig ist. Der Industriealkohol ist flüssig, biologisch abbaubar und einfach zu handhaben. Er kann gelagert und transportiert werden wie Diesel. Dazu kommt eine höhere Energiedichte als bei Ammoniak und Wasserstoff.
Auch das grüne Methanol hat Nachteile: Es kann zwar in umgebauten Dieselmotoren verbrannt werden, ist aber korrosiv, was Dichtungen und Düsen beschädigen kann. Als Zugabe in herkömmlichen Treibstoffen ist Methanol aber schon lange erprobt.
In der deutschen Binnen- und Seeschifffahrt könne grünes Methanol 96 Prozent der CO2-Emissionen einsparen, hat die DLR-Studie errechnet.
Nach der Definition von Greenpeace darf grünes Methanol ausschliesslich aus grünem Wasserstoff produziert werden. Dazu kommt CO2 aus der Luft, das mit Hilfe von Direct Air Capture (DAC) gewonnen wird. Auch CO2 aus Meerwasser wäre eine Option. Biomethanol aus Reststoffen oder Abfällen ist laut Greenpeace keine nachhaltige Lösung. Es gibt bisher kaum Produzenten.
Im Vergleich braucht es etwa doppelt so viel Methanol, um ein Schiff vorwärtszubringen, als Diesel. Und grünes Methanol ist teuer. Für Reeder bedeutet das: höhere Kosten, grössere Tanks, weniger Platz für Ladung und dadurch weniger Gewinn.
Gesucht: Eine gewichtige Entscheidung
Ist das nun besser oder schlechter als Wasserstofftanks? Diese Frage kann kein Unternehmen allein beantworten, das wird aus dieser Aufstellung deutlich. Nötig sind nicht nur umgerüstete und neue Schiffe, Tanks, Pipelines, Hafenanlagen und Hersteller, sondern auch Gesetze und Sicherheitsvorschriften für die neuen Treibstoffe.
Die Reeder haben vor allem einen Wunsch: Eine Entscheidung für eine dieser Optionen. Das betrifft auch die Schweiz, obwohl sie keine Seehäfen hat. Gegen 22 Prozent der weltweiten Handelsschiffe gehören zu Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Das berichtete «Echo der Zeit» anlässlich der IMO-Konferenz.
Es gehe um sehr viel Geld und einen grossen Umbruch, vergleichbar mit der historischen Umstellung von Segel- auf Motorschiffe. Die falsche Entscheidung könne alle Beteiligten viel Geld kosten, sagt Florence Schürch, Generalsekretärin des Verbands der Schweizer Rohstoffhandels- und Schifftransportunternehmen (Suissenégoce).
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.







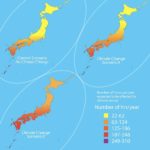


Die im Artikel aufgestellte Behauptung, dass Methanol «so gut wie gar nicht giftig» sei darf nicht unwidersprochen bleiben. Methanol (auch als Methylalkohol oder Holzgeist genannt) ist hochgiftig; kann auch über die Haut oder durch Einatmen seiner Dämpfe vom Körper aufgenommen und so zu schwersten, allenfalls bis zur Erblindung oder irreparablen zum Tode führenden Organschäden führen.
Methanol führt zu schweren Vergiftungen, wenn es anstatt Ethanol, dem «normalen» Alkohol, getrunken wird. Es gilt aber für fast alle Treibstoffe, dass sie nicht getrunken werden sollten. Wenn man das beachtet, kann man Methanol durchaus als relativ problemlos bezeichnen.
Methanol wird heute in sehr grossen Mengen von über 100 Mio Tonnen als Chemierohstoff umgesetzt, allerdings aus Produktion mit fossilen Rohstoffen. Methanol hat viel weniger Umweltrisiken als Erdöl, da es wasserlöslich ist und rasch abgebaut wird. Tankerkatastrophen mit monate- bis jahrelangen grossräumigen Verschmutzungen kommen nicht vor.
Mit grünem Methanol aus H2 und CO2 sind wir viel weniger von den Erdölländern abhängig, weil die erneuerbare Produktion überall möglich ist, dank Sonne und Wind. Wird fossile Energie mit grünem Methanol ersetzt, sinken die weltweiten Öltransporte, die 40% der Transporte auf dem Meer ausmachen.
Man sollte die Schwierigkeiten nicht unterschätzen. CO2 aus «direct air capture» ist sehr teuer, da das Verfahren sehr aufwendig ist. Es führt kein Weg daran vorbei, den Verbrauch deutlich zu senken. Im Falle der Schifffahrt müsste das heissen, dass der Handel mehr lokal und weniger global werden müsste.
Wahrscheinlich alles besser als Schweröl! Aber: der Teufel liegt im kleingedruckten. Es soll über weitere CO2-Steuern und Sanktionen Druck ausgeübt werden, auf weniger schädliche Betriebsstoffe umzusteigen. Wer zahlt aber diese Steuern und Strafgebühren? Richtig! Die Konsumenten! Die schon jetzt in der EU durch krass überteuerte Energie- und Lebensmittelpreise abgezockt werden. Auch die Umstellung werden wohl kaum die Reedereien und Investoren bezahlen und damit auf Gewinn verzichten. Wir werden sie zahlen, mit neuen Abgaben und Steuern, die zu Subventionen werden. Produkte und Vorprodukte werden teurer, damit auch die Produktion und der Konsum in unseren Ländern. Kapitalistische Logik im Umweltschutz führt oft leider nur zu einer höheren finanziellen Belastung der Konsumenten, während sich aufstrebende Staaten mit billiger Energie die Hände reiben. Das wird so nichts.