Business-Propaganda mit einer Schweizer Kindergeschichte
In der Schweiz beschwören Wirtschaftsverbände und Unternehmer regelmässig die magische Kraft der unregulierten Marktwirtschaft. Besonders prominent taten dies vor wenigen Monaten etwa «Gastrosuisse», die «Swiss Retail Federation» oder der «Gewerbeverband» mit einer gemeinsamen Kampagne gegen herbeifantasierte Verbote von beliebten Produkten.
Nirgendwo dürfte die idealisierte Vorstellung des «freien» Marktes weiter verbreitet und tiefer verwurzelt sein als in den USA. In vielen Köpfen gilt ein unregulierter Markt da immer noch als einzigartig, handlungsmächtig und weise.
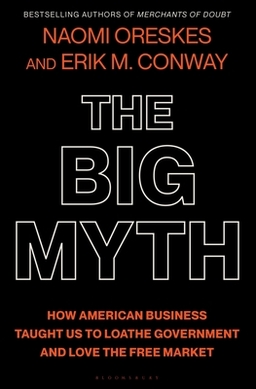
In einem umfangreichen Buch zeigen die Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes und ihr Kollege Erik Conway nun erstmals, dass dieses Denken das Resultat einer immensen Beeinflussungskampagne ist. Sie verfolgen die Spuren von TV-Serien, Cartoons und einflussreichen Wirtschaftsbüchern zurück zu von Unternehmern üppig ausgestatteten Think-Tanks. Und erzählen so in «The Big Myth: How American Business Taught Us to Loathe Government and Love the Free Market» die «wahre Geschichte einer falschen Idee».
«Marktfundamentalismus» statt «Neoliberalismus»
Diese Idee nennen Oreskes und Conway «Marktfundamentalismus». Die beiden wurden von ihrer bisher bekanntesten Recherche über das systematische Säen von Zweifeln an den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel auf die Spur der Think-Tanks geführt.
Im Buch «Merchants of Doubt» (deutsche Fassung: «Die Macchiavellis der Wissenschaft») zeigten Oreskes und Conway, wie rechtskonservative Denkfabriken und pensionierte Physiker koordiniert wissenschaftliche Erkenntnisse angriffen, indem sie etwa Meinungsartikel in Magazinen publizierten oder Forschende zu Streitgesprächen einluden – um damit den Eindruck einer umstrittenen Debatte zu vermitteln.
Danach, so Oreskes, hätten sie verstanden, dass dahinter ein umfangreicheres ideologisches Projekt stehe. Wir könnten die gegenwärtige Wissenschaftsfeindlichkeit in den USA nicht verstehen, ohne die politische Ideologie zu verstehen, welche sie antreibe, sagte sie vor wenigen Monaten in einem Vortrag. «Sehr vieles von dem, was derzeit abläuft ist nicht von Ignoranz getrieben, sondern von aktiver, politisch motivierter Bosheit.»
Oreskes und Conway betrieben intensive Archivrecherchen. Sie verorten den Beginn der Kampagne in den 1930er-Jahren. Mehrere Autoren, unter anderem der gerade abgewählte Präsident Herbert Hoover, vertraten in neuen Büchern ungefähr folgende These: Die Freiheit der Wirtschaft sei nicht von politischer Freiheit und der Demokratie zu trennen. Folglich bedeute jede Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit automatisch ein Beschneiden individueller Freiheit.
Mit diesem Argument wehrten sich Wirtschaftsverbände wie die grosse «National Association of Manufacturers» (NAM) gegen Massnahmen von Präsident Roosevelts New Deal wie die Einschränkung von Kinderarbeit. Damit waren sie aber noch nicht erfolgreich. Die US-Öffentlichkeit verstehe die Industrie schlicht nicht, beklagte der damalige Präsident des Industrieverbands.
Grosse Kampagne mit Edward Bernays
So heuerte die NAM den damaligen Tabak-Propagandisten Edward Bernays an und rief eine grosse Überzeugungskampagne ins Leben.
Deren Botschaft lautete nun: Der Wohlstand der USA beruhte nicht nur auf den Handlungen des Staats, sondern besonders auch auf jenen der Wirtschaft. So stützten sich die erfolgreichen USA auf drei Pfeiler: repräsentative Demokratie, politische Freiheit und Wirtschaftsfreiheit. Dies sei «the American way» – obschon die Verfassung die Wirtschaftsfreiheit nirgendwo erwähnte.
Die Kampagne zielte so nicht bloss darauf, die Verdienste eines einzelnen Wirtschaftszweigs oder einer Branche hervorzuheben. Bernays‘ Auftraggeber wollten vielmehr verändern, wie die US-Öffentlichkeit über Wirtschaft dachte. Sie tat dies, so Oreskes und Conway, «mit Informationen, die oft parteiisch und häufig irreführend waren».
Geschichte des Berner Stadtpfarrers als Vorbild
Und diese schickte die NAM direkt in die Haushalte. Die teuerste Kommunikationsmassnahme war das Hörspiel «The American Family Robinson». Es wurde von über 300 Radiostationen – dem Medium der 1930er – verbreitet und erreichte mit seinen wöchentlichen Folgen Millionen. Es war nach dem Vorbild des Buchs «Der Schweizerische Robinson» verfasst.
Geschrieben vom damaligen Berner Stadtpfarrer Johann David Wyss Ende des 18. Jahrhunderts, war es in den USA zu einem Kinderbuchklassiker geworden. Wie sein Vorbild erzählte das Hörspiel die Geschichte einer Familie, die dank Eigeninitiative Erfolg hat. Allerdings propagierte es nicht Wyss’ Version einer protestantischen Arbeitsethik, sondern eine eigene, patriotistische Vision einer fundamentalistisch unregulierten Marktwirtschaft. Dass das Hörspiel direkt aus dem PR-Büro der Grossunternehmer kam, wurde bei den Ausstrahlungen nicht deklariert.
Eine massentaugliche Hollywoodproduktion
Die PR-Profis arbeiteten auch mit Hollywood-Studios und liessen Filme produzieren. Besonders eindrücklich ist der Kurzfilm «Your Town: A Story of America» aus dem Jahr 1940, welcher vor langen Spielfilmen in Kinos gezeigt wurde und über sechs Millionen Kinobesuchende erreicht haben soll. Zudem wurde er gratis an Schulen und Bibliotheken verteilt. Dabei wurde er als bildend und unterhaltsam präsentiert. Der Film propagierte einen heroischen Individualismus und romantisierte die Industrialisierung Amerikas. «Wie jede gute Propaganda», schreiben Oreskes und Conway, «war er nicht vollkommen falsch». Aber er habe auch vieles ausgelassen.
Irreführende Zusammenfassungen von Hayek und Adam Smith
Zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung gehörte aber nicht nur die massenmediale Verbreitung. Der Mythos der magischen Kraft des freien Marktes sollte auch intellektuell zementiert werden. In den 1950er-Jahren holte eine Gruppe Unternehmer mit Verbindungen zu NAM die beiden Ökonomen Friedrich von Hayek und Ludwig von Mises in die USA, indem sie ihnen Lehrstühle in Chicago und New York finanzierten.
So richteten zwei Unternehmer an der Uni Chicago das sogenannte «Free Market Project» ein, welches explizit darauf aus war, die Vorzüge der freien Marktwirtschaft zu beweisen. Zudem bemühten sich die Unternehmer, die Ideen der beiden neoliberalen Denker zu verbreiten.
Im Fall von Hayeks geschah dies mittels irreführender Zusammenfassungen seines bekannten Buchs «Weg in die Knechtschaft». Darin, so Oreskes und Conway, bezeichnete er gewisse Eingriffe in die Marktwirtschaft, etwa bei Umweltverschmutzung, als gerechtfertigt. Zudem sprach er sich für eine Art Sozialversicherung aus.
In einer Kurzversion des Buchs im auflagenstarken «Reader’s Digest» sowie in einer Comic-Version in einem populären Magazin fehlten jedoch derartige Nuancen und Relativierungen. Mit solchen Versionen für die Masse erreichte die Gruppe aber mehr als zehn Prozent der damaligen US-Bevölkerung, schätzen Oreskes und Conway.
Ähnlich irreführend marktfundamentalistisch erschien 1957 eine überarbeite Version von Adam Smiths Ökonomie-Klassiker «Wohlstand der Nationen» aus dem 18. Jahrhundert. Im Original sprach sich Smith etwa für Bankenregulierung aus, aber auch für Steuern, um öffentliche Güter und Infrastruktur zu finanzieren. Er befürwortete Mindestlöhne oder das Recht von Angestellten, Gewerkschaften bilden zu dürfen. Die entsprechenden Passagen, welche Unternehmerinteressen tangierten, fehlten jedoch in der populären Neuauflage.
Milton Friedman komplettierte die Bibel des Marktfundamentalismus …
Trotz dieser Erfolge auf intellektueller Ebene fehlte der marktfundamentalistischen Bewegung zu diesem Zeitpunkt jedoch eine komplette, überzeugende Eigenproduktion – eine Art Bibel. Diese, so Oreskes und Conway, komplettierte der US-Ökonom Milton Friedman in den 1960er-Jahren. Friedman war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon länger an der Uni Chicago tätig. Bis dahin, heisst es im Buch, hatten die Marktfundamentalisten mit Hayeks «Wohlstand der Nationen» bloss ein Altes Testament. Friedman lieferte ihnen mit «Kapitalismus und Freiheit» 1962 auch noch das Neue Testament.
Das Buch ist viel zugänglicher als von Hayeks, besonders für Studierende. Friedman vertritt darin die mittlerweile immer wieder verbreitete Hauptthese, dass Kapitalismus und Freiheit unzertrennlich seien. Eine These, die Oreskes und Conway als «erwiesenermassen falsch» bezeichnen, die aber effektiv das Denken über Märkte und die Wirtschaft veränderte.
… und verbreitete seine Ideen über zwei Jahrzehnte mit Hilfe der Bewegung
Die ersten Kritiken des Buches fielen denn auch teilweise vernichtend aus. Doch 1980, fast zwei Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung, stürmte eine überarbeitete Version des Buchs die Bestsellerlisten und wurde zum Sachbuch des Jahres in den USA. Friedman und seine Unterstützer hatten das Buch mit Gratisausgaben und Zusatzmaterial für Schulen stark promotet.
Friedman schrieb hunderte Zeitungskolumnen. Zudem erreichte eine Dokuserie mit dem Titel «Free to Choose» auf dem öffentlichen Sender PBS Millionen. Gemäss Oreskes und Conway wurde aber auch hier nirgendwo deklariert, wer für die Produktionskosten von 2.5 Millionen Dollar aufgekommen war – nämlich grösstenteils Unternehmen und rechtskonservative Stiftungen.
Der überwältigende Erfolg des US-Marktfundamentalismus, so Oreskes und Conway, sei letztendlich ein PR-Erfolg. Gemäss ihnen schafften es die potenten Unternehmer nämlich, eine selbstbezogene, dubiose Falschinterpretation der Geschichte in einen scheinbar intellektuell robusten Ideenkomplex zu verwandeln.
Besseres Verständnis von Märkten und effektiver Regulierung
Dass diese Ideen konkret Schaden anrichten, zeigt für Oreskes und Conway der Klimawandel. So sei der Klimawandel definitiv ein Beispiel für Marktversagen. Der Preis, den wir für fossile Brennstoffe bezahlen, reflektiere schlicht nicht die Kosten, die sie verursachten.
Sie fragen daher rhetorisch: Wenn dies nicht der Fehler des Marktes bei der Festlegung des Preises sein soll, wessen Fehler ist es dann? Oreskes und Conway fordern deshalb: «Wir brauchen realistischere Ansichten davon, worin Märkte gut sind und worin nicht, worin sie reüssieren und woran sie scheitern. Wir brauchen auch eine historisch informierte Auffassung davon, wie Staaten Märkte schaffen und verwalten, sie vor ausbeuterischen Praktiken schützen, öffentliche Güter bereitstellen und soziale Kosten der Wirtschaft angehen. Dafür müssen wir verstehen, wie und weshalb wir überhaupt so viel Vertrauen in Märkte setzen.»
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.









Die Welt mit ihren Menschen ist zu komplex eben für diese Menschen. So kann der Politiker, der Unternehmer, der Diktator einen Teilaspekt der gesamten Komplexität herausnehmen wie z.B. «Der freie Markt regelt alles» oder «In der Ukraine herrscht der Faschismus», diesen propagieren, die Menschen damit manipulieren und einzelne verschaffen sich damit Reichtum und Einfluss. Und immer wieder fällt ein Teil der Betroffenen darauf rein. Siehe auch Trump&Co. Oder Klimawandelverweigerer.
«Freie» Marktwirtschaft nach US-Lesart bedeutet letztlich immer Monopol, Manipulation und manchmal faschistische Diktatur. Regulierte Systeme erzeugen andererseits ebenfalls Profiteure, blähen den Staatsapparat auf und verzerren die Wettbewerbsfähigkeit. Die US-Amerikaner haben übrigens nie wirklich freie Marktwirtschaft betrieben, sondern mittels Putschen, politischer Einflussnahme, Wirtschaftsknebel und der Möglichkeit zur unbegrenzten Verschuldung ihre Gewinne auf Kosten anderer optimiert. Das Etikett Klimawandel dient sowohl professionellen Gegnern als auch politischen Befürwortern wechselseitig zum Absahnen: die einen wollen unbegrenzt wertvolle Ressourcen verblasen, ohne dass ihnen einer dreinredet, die anderen über Abgaben und Steuern sich selbst und verbandelten Profiteuren das Säckel füllen. Eine ernsthafte Diskussion über Umweltschutz und Klimawandel wird schon lange nicht mehr geführt.
Die Ausführungen von Herrn Sigg sind richtig und wichtig. Aber :
Der engl. Untertitel heisst «…. loathe government ‚and‘ love the free market » . Also:
Verabscheuungswürdiger Staat ‚und‘ liebe den freien Markt.
(Nicht – «Marktfundamentalismus» ’statt» Neoliberalismus»)
Ich lese gerade das Buch «Konsequenzen des Kapitalismus» von «Noam Chomsky» und «Marv Waterstone». Ab ca. S.115 wird darin auf den Zweck der US-Verfassung und der demokratischen Institutionen verwiesen.
Der einfussreichste Verfassungsvater «James Madison» erklärte der Verfassungsversammlung 1787 die Regierung muss «die Minderheit der Begüterten vor der Mehrheit beschützen».
Die Gründungsväter der USA waren grösstenteils hochbegüterte Landbesitzer und Skalvenhalter.
Weierhin wird auf schriftlich überlierte Quellen in diesem Sinne verwiesen.
In Demokratien werden Gefühle besser instrumentlisiert, auch die Konsumlust, die sich die Minderbegüterten selbst erarbeiten müssen. So ist Demokratie nur das kleinere Übel.
«Wohlstand der Nationen» ist von Adam Smith und nicht von Hayek. Oder ist «Road to Serfdom» gemeint? Das wäre von Hayek, aber ist mE eines der meistüberschätzten Bücher, die je geschrieben wurden. Man muss einfach wissen: Es gibt keine total freien Märkte, das wäre Anarchie. «Der Markt» ist eine Organisationsform, die – wie jede andere auch – spezifische Einschränkungen für die Teilnehmer bereit hält. Zu diesem Thema wichtig: «The Great Transformation» von Karl Polanyi.