„Man schwankt zwischen Kleinmut und Grössenwahn“
Der Beitritt der Schweiz zur EU, bis vor wenigen Jahren noch ein vieldiskutiertes Thema, ist aus der öffentlichen Debatte verschwunden. Selbst ehemalige klare Befürworter reden kaum mehr darüber. Nicht zuletzt die Politiker selber scheuen das Thema; sie fürchten – nach der Wahl ist vor der Wahl! – um ihre Popularität bei den Wählern. Einer aber, der reden kann und zu reden bereit ist, ist Michael Fust, seit 2009 und noch bis Ende Juni 2013 Generalsekretär der Neuen Europäischen Gesellschaft (Nebs). Wir haben ihn gefragt, warum er denn seinen Posten verlässt und was er zur gegenwärtigen Situation der Schweiz ausserhalb der EU zu sagen hat: Wäre es auch aus heutiger Sicht richtig, der EU beizutreten?
An der GV der Nebs wurde bekannt gegeben, dass Sie die Position des Generalsekretärs der Nebs Ende Juni abgeben. Aus Frust darüber, dass ein Beitritt der Schweiz zur EU heute unwahrscheinlicher ist denn je?
Michael Fust: Nein, überhaupt nicht. Ich gehe aus persönlichen und familiären Gründen. In meinem Alter sind dreieinhalb Jahre am gleichen Ort genug. Ich habe einfach Lust auf eine neue Herausforderung.
Aber nochmals: Eine neue Herausforderung sucht man, wenn man am gegenwärtigen Arbeitsort nicht mehr zufrieden ist. Ist es die politische Aussichtslosigkeit eines Beitritts?
MF: Nein. Politisch ist es im Moment sogar ausserordentlich spannend. Die schweizerische Europapolitik steht an einem Scheideweg, heute ist klar, dass wir den bilateralen Weg nicht mehr wie bisher weitergehen können. Jetzt muss man ernsthaft über Alternativen diskutieren, insbesondere auch über die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft der Schweiz.
Das ist doch aussichtslos, die Zustimmungsraten für einen EU-Beitritt sind im Keller.
MF: Tatsächlich sind die Umfragewerte im Moment auf einem Tiefststand. Als ich meinen Job als Generalsekretär der Nebs antrat, lag die Zustimmung zu einem Beitritt zur EU in der Bevölkerung bei etwa 30 Prozent. Heute liegt sie gerade noch bei etwa 15 Prozent. Das kann natürlich auch mal frustrierend sein. Aber die Ursache der rückläufigen Zustimmung ist wohl hauptsächlich in der gegenwärtigen Staatsschuldenkrise zu suchen. Das Image der EU ist deswegen arg ramponiert. Man sollte allerdings Politik nicht anhand von Meinungsumfragen machen. Diese können morgen schon wieder anders aussehen. Richtschnur der Politik sollte die langfristige Interessenwahrung sein.
Sind das nicht bloss Durchhalteparolen? Sind nicht vielmehr auch Sie selber zur Überzeugung gelangt, dass ein Engagement für einen Beitritt keinen Sinn macht?
MF: Ganz und gar nicht. Die heutige Europapolitik macht aus der Schweiz einen zugewandten Ort der EU. Wir übernehmen aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heute schon ähnlich viel EU-Recht wie ein Mitgliedsland, ohne dass wir aber bei dessen Ausarbeitung mitentscheiden konnten. Diese wachsende Fremdbestimmung und das sich daraus ergebende Demokratiedefizit werden in Zukunft noch grösser werden. Immer mehr der für uns relevanten Entscheide werden in den Gremien der EU gefällt. Der Beitritt macht daher Sinn, er ist ein Mittel zum Zweck. Es geht darum, dass die Schweiz ihr Umfeld und ihre Zukunft aktiv mitgestalten kann.
Die Schweiz hätte in der EU aber kaum Einfluss. Deutschland gibt den Takt vor, die kleinen Staaten müssen spuren.
MF: Ach was. Das ist typisch für die Debatte in der Schweiz. Man schwankt zwischen Kleinmut und Grössenwahn. Auf der einen Seite sagt man: Innerhalb der EU hätten wir als kleines Land eh nichts zu sagen – was völlig falsch ist, denn grössenmässig läge die Schweiz unter der EU-Staaten etwa im Mittelfeld. Und auf der anderen Seite betont man, wie wichtig die Schweiz für die EU als Handelspartner ist und will auf Augenhöhe verhandeln. Die Schweiz ist ein mittelgrosses europäisches Land, wirtschaftlich sind wir von beachtlicher Bedeutung und unser Finanzplatz ist einer der wichtigsten auf der Welt. Eine EU-Mitgliedschaft würde die Position der Schweiz insgesamt stärken.
Inwiefern?
MF: Entscheide in der EU werden oft in einem Konsensverfahren getroffen, vermehrt wird es künftig auch zu Mehrheitsentscheiden kommen. Dabei kann auch Deutschland als grösstes Land seinen Willen den anderen Ländern nicht einfach aufzwingen. Als Mitglied könnten wir mit anderen Ländern punktuelle Allianzen schmieden, mal könnte man sich durchsetzen, manchmal wohl auch nicht. Heute aber verhandeln wir mit der EU immer erst, nachdem die 27 Länder untereinander einen Weg gefunden haben und es eigentlich keinen Spielraum für abweichende Lösungen mehr gibt.
Aber hätten wir dafür nicht auch Verpflichtungen? Wir wären ein Nettozahler.
MF: Ja klar, es gibt immer Vor- und Nachteile, Rechte und Pflichten. Aber schauen wir doch, wo wir heute stehen: Wir sind mit über 120 bilateralen Verträge mit der EU verflochten und übernehmen fortlaufend EU-Recht, wir leisten einen finanziellen Beitrag an den wirtschaftlichen Aufbau der neuen Mitgliedstaaten, wir haben die Personenfreizügigkeit mit der EU und mit Schengen sogar die gleichen Aussengrenzen. Wir sind sozusagen ein Passiv-Mitglied der EU – wir bezahlen einen reduzierten Mitgliederbeitrag und dafür verzichten wir auf unser Stimmrecht.
Wenn es so einfach ist: Warum gelingt es der NEBS denn nicht, die Politiker davon zu überzeugen, dass ein Beitritt ein Gewinn wäre, kein Verlust?
MF: Im Gespräch mit Politikern unter vier Augen stellen wir fest, dass etliche die Realität sehr wohl sehen und einen EU-Beitritt nicht grundsätzlich ablehnen. Aber sie folgen, wie man so schön sagt, der «politischen Opportunität» und wollen sich in diesem unpopulären Thema nicht exponieren. Eine der Hauptaufgaben der Nebs ist es deshalb in den nächsten Jahren, das Thema EU-Beitritt wieder in die öffentliche Debatte zurückzuführen.
Wird das den EU-Befürwortern, den «Euroturbos» gelingen?
MF: Halt, halt! Wir sind keine unkritischen Anbeter der EU! Wir beobachten die EU und ihre Entwicklung sehr aufmerksam, und auch wir – die Nebs und auch ich – finden nicht einfach alles gut in der EU. In vielen Punkte sind Verbesserungen angesagt und Reformen notwendig. Gerade auch deshalb sollte die Schweiz mitreden können. Jetzt stehen wir politisch abseits, machen die Faust im Sack und passen uns dem an, was andere entschieden haben.
Was ist denn Ihre konkrete Prognose? Wird es gelingen, die Politiker und die Bevölkerung zu überzeugen, dass ein Beitritt Vorteile für unser Land brächte? Und in welchem Zeitpunkt?
MF: Eine konkrete Prognose ist im Moment kaum möglich. Es spielen ja auch viele externe Faktoren eine Rolle. Grundsätzlich sind europapolitisch fünf Varianten denkbar: Beibehaltung des Status quo ohne neue Verträge; neue bilaterale Verträge mit einem umfassenden institutionellen Rahmenabkommen; ein Beitritt zum EWR; eine EU-Mitgliedschaft – oder auch die Kündigung der bestehenden Abkommen…
Was ja wohl in ein wirtschaftliches Debakel münden würde…
MF: Ja, aber auch eine Eskalation in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU ist nicht vollkommen undenkbar. Etwa wenn die Masseneinwanderungsinitiative der SVP vom Volk angenommen würde. Diese lässt sich mit der Personenfreizügigkeit nicht vereinbaren und damit stünden die ganzen Bilateralen I auf dem Spiel.
Welche Chancen geben Sie neuen bilateralen Verträgen?
MF: Heute ist der bilaterale Weg blockiert, die EU will einen Systemwechsel. Um neue Marktzugangsabkommen abschliessen zu können, wird die Schweiz punkto Rechtsübernahme, Überwachung und Streitschlichtung ein EWR-ähnliches System akzeptieren müssen. Innenpolitisch sehe ich dafür im Moment keine Mehrheit, die Blockade könnte also noch eine Weile andauern.
Wie kommt die EU denn zu dieser Forderung nach einem Systemwechsel?
MF: Aus Sicht der EU ist diese Forderung eigentlich nur konsequent. Wer am gemeinsamen europäischen Binnenmarkt teilnehmen will, soll auch nach den gemeinsamen, sich stetig entwickelnden Regeln des Binnenmarktes spielen, so wie dies die EWR-Länder auch akzeptiert haben. Auf ein ähnliches System will sie jetzt die Schweiz verpflichten. Dies hätte durchaus auch Vorteile für die Schweiz. Eine solche Lösung böte Rechtssicherheit und der noch unvollständige Marktzugangs liesse sich weiter ausbauen. Allerdings würde dadurch der Status als Quasi-Mitglied ohne Stimmrecht gefestigt. Daher bleibt eine EU-Mitgliedschaft die bessere Lösung.
Will uns die EU letztlich nicht einfach den EWR- oder EU-Beitritt aufzwingen?
MF: Beide Schritte wären der EU zweifelsohne sehr recht. Ich denke aber, es geht um etwas anderes. Die bisherigen bilateralen Abkommen entstanden aufgrund einer anderen Ausgangslage. Die Schweiz hatte zwar 1992 einen Beitritt zum EWR abgelehnt, das offizielle strategische Ziel blieb aber die EU-Mitgliedschaft. Die bilateralen Abkommen waren dann eine Art Übergangslösung, die Schweiz konnte so trotz EWR-Nein am neu entstandenen europäischen Binnenmarkt teilnehmen. Im Jahr 2005 hat der Bundesrat das Ziel der EU-Mitgliedschaft aber verworfen und den bilateralen Weg sozusagen unilateral zum schweizerischen Integrationsmodell erhoben. Damit hat sich die Ausgangslage verändert und die EU will nun ihrerseits die Übergangs- in eine Dauerlösung überführen. Für die Schweiz wiederum ergibt sich dadurch eine Grundsatzfrage: Welchen Platz und welche Rolle streben wir für unser Land in Europa an? Wollen wir die Ärmel hochkrempeln und uns einbringen? Oder wollen wir die Hände in den Schoss legen und darauf hoffen, dass es die anderen schon gut machen?
Zurück zu Ihnen selber: Bleiben Sie beim Thema Schweiz/EU oder in welchem Bereich suchen Sie ein neues Engagement?
MF: Das Thema Schweiz/EU wird mich weiterhin interessieren. Die Schweiz ist und bleibt ja ein Teil Europas, die schweizerische Europapolitik bleibt eines der wichtigsten Politikfelder und betrifft uns auch in unserem Alltag sehr direkt. Zumindest in der Freizeit werde ich mich von diesem Thema also sicher nicht abwenden.
Und beruflich?
MF: Ich weiss es noch nicht. Das «Bienenhaus» Bundeshaus und die Politik faszinieren mich noch immer. Ich interessiere mich vor allem für Schnittstellen, so wie jetzt die Schnittstelle Schweiz/Europa. Mal sehen, was sich da ergibt.
**********
Michael Fust, geboren 1979, ist Historiker (Lic.phil.I). Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Bern.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine





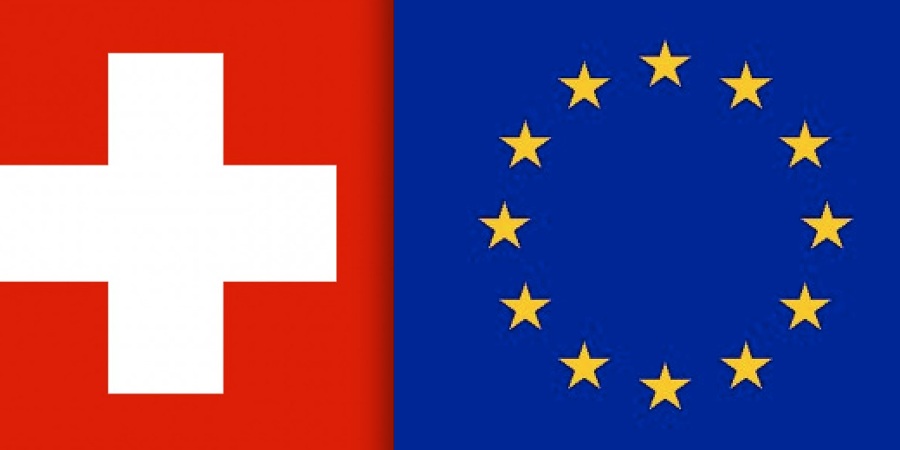



Schade, dass der äusserst informative Infosperber einem derart einseitigen EU-Befürworter so viel Platz einräumt, ohne dass relevante Fragen und Themen zur Sprache kämen. Wie kann einer den Anspruch erheben, ernst genommen zu werden, wenn er unsere Mitsprachemöglichkeit derart hoch ansetzt? Das sind doch alles nichtstubstantiierte Behauptungen. Von der Bevölkerung zahlenmässig her gesehen, hätten wir in der EU ein Stimmrecht mit einem Gewicht von gerade mal 5 % Anteil. Sicher, unser Verantwortlicher an den entsprechenden Sitzungen dürfte mal den grossen EU-Fürsten das Händchen schütteln und eine Rede halten, aber bei Abstimmungen würden wir regelmässig übergangen bzw. massiv überstimmt.
Die EU ist gut für grosse Staaten, die miteinander Kriege vermieden und vor allem Geschäfte machen wollen, aber sonst? Das Potential, auch im sozialen Bereich mehr Gerechtigkeit zu schaffen, wäre freilich vorhanden, aber mit diesen Leuten an der Spitze, mit dieser Mentalität? Das sind doch alles Grossfürsten die noch nicht zu erkennen vermochten, dass der von ihnen einseitig geförderte Kapitalismus eine krankmachende Wirtschaftsform darstellt. Da ist Mutti Merkel unter ihnen eine Protagonistin im Verteidigen und Alimentieren der Banken und der Banker. Aber auch sie wird eines Tages von den Deutschen WählerInnen durchschaut werden. Ihr wäre zu gönnen, dass sie einmal Zeit und Motivation findet, die Bücher ihrer Landsfrau aus der ehemaligen DDR von Sara Wagenknecht zu lesen.
Die EU ist derzeit ausserdem eine wenig demokratische Veranstaltung. Da haben wir nun wirklich nichts verloren. Wir haben die Möglichkeit, bei uns ein demokratisches Biotop zu entwickeln, ein demokratisches Modell, das aber von anderen Leute, als dem selbsternannten Oberdemokraten und EU-Fan Andi Gross inspiriert wird. Da hätten wir zu wirken, die Demokratie weiter zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass erstmals an der Basis unsere Gemeindeversammlungen wieder zu dem werden , was sie vor tausend Jahren in einem Teil unseres Landes waren: Genossenschaftliche Zusammenkünfte, Allmenden mit der basis-orientierten Mitbestimmung aller.
Die Ärmel hochzukrempeln und sich einbringen zu wollen in einer politischen Organisation, welche nicht mit sich reden lässt – die jedenfalls kein anderes Verhalten an den Tag legen kann, ausser in quasi-diktatorischer Weise lediglich Forderungen und Bedingungen zu stellen und dies erst noch im Klima eines selbstherrlichen, elitär-autoritären Machtbewusstseins, der grössere und stärkere zu sein – und für die einzig nur Geld zählt und alle Probleme mit Geld zudecken möchte, zeugt doch weit mehr von jenem Grössenwahn, der im Titel erwähnt und perfiderweise den EU-Beitrittsgegnern unterstellt wird.
Womit überhaupt sich denn einbringen wollen – ausser mit Geld und anteilmässig immerzu noch mehr Geld?! Ärmel hochkrempeln und mitreden ist etwas, das wir seit jeher tun – leider jedoch will man explizit nicht auf uns hören! Weder unser Demokratieverständnis, noch unsere direkt-demokratische Ausgestaltung, noch andere schweizerische Tugenden und Strukturen will man partout nicht zur Kenntnis nehmen. Unsere Mentalität wird eher belächelt, als geschätzt, auf unseren Wohlstand ist man neidisch und eifersüchtig und unsere Neutralität wird als feige Zurückhaltung eines bauernschlauen Drückebergers verstanden. Zu meinen, dass ein Beitritt an unserem Einfluss irgendetwas ändern könne, zeugt meines Erachtens wirklich von einer Art Grössenwahn.
Sich unserem Staatsverständnis, sowie unserer Eigenheiten, Charakteristiken und spezifischen Interessen hingegen nicht so stark bewusst zu sein, um diese gegenüber dreisten Machtansprüchen und unverhohlenen Forderungen behaupten zu können und zu wollen, zeugt ebenfalls weit mehr von Kleinmut, als dies den EU-Beitrittsgegnern wegen ihrer Beitrittsverweigerung vorgeworfen wird.
Und zu meinen, dass unsere Interessen zu vertreten einer Art „Rosinenpickerei“ gleichkomme – dabei jedoch zu übersehen, dass die anderen bereits den ganzen rosinenhaltigen Kuchen als den ihrigen betrachten und sich lediglich über dessen Aufteilung uneins sind – dessen bedarf es zudem einer extra grossen Portion Blauäugigkeit.
Der Gier nach Macht scheinen in klassischen Demokratien gerade die grössten Flügel zu wachsen durch den diesem System inhärenten und offenbar besonders ausgeprägten Zwang, mittels herausragenden Versprechungen zu genügend Wählerstimmen zu kommen. Doch absolut alles, was dem Volk gegeben werden kann, muss eben zuerst vom Volk genommen werden. Leider sind gerade die als eher vertrauenswürdig eingestuften, besonders sozial handelnden Politiker Meister im Vertuschen und Herunterspielen dieses Faktums.
Pensionsalter herunterschrauben, ausgeprägter Minderheitenschutz, immer mehr staatliche Versorgungseinrichtungen, Kommissionen, Organisationen, Gebühren und Abgaben zu schaffen und ganz allgemein den Sozialstaat ausbauen und die Eigenverantwortung überflüssig zu machen, bedeutet über kurz oder lang, griechische Verhältnisse herbeizuführen. Spätestens wenn die jetzigen Noch-Geldgeber auch nichts mehr geben können, wird man dann vielleicht begreifen, dass langwierigen finanziellen Engpässen nicht mit Geld sondern primär mit umfassenden, strukturellen Änderungen beizukommen ist. Die Frage ist und bleibt allerdings, ob sich diese Erkenntnis in klassischen Demokratien überhaupt umsetzen lässt…
Schon die Ueberschrift benennt das Problem genau. – Danke für diesen ausgezeichneten Beitrag!