Kommentar
Juso-Initiative – Economiesuisse malt schwarz
Niemand zahlt gerne 50 Prozent Steuern auf dem Vermögen – auch nicht auf der Hinterlassenschaft. Doch die allermeisten Schweizer wären froh, wenn ihre Nachkommen überhaupt in die Lage kämen, diese 50 Prozent zahlen zu müssen. Dazu braucht es nämlich ein Vermögen von mindestens 50 Millionen Franken.
Die Erbschaftssteuer-Initiative der Juso
mdb. Die Juso verlangen mit ihrer Erbschaftssteuer-Initiative, dass Erbschaften ab einem Betrag von 50 Millionen Franken mit 50 Prozent besteuert werden. Das Volk stimmt am 30. November darüber ab.
So gesehen müsste die Erbschaftssteuer-Initiative der Juso im kommenden November mit grosser Mehrheit angenommen werden. Es sei denn, es gelinge den Gegnern, dem Stimmvolk weiszumachen, dass eine solche Steuer unter dem Strich allen mehr schade als nütze.
Um diesen Beweis zu erbringen, hat Economiesuisse, der Dachverband der Schweizer Unternehmen, neulich eine Pressekonferenz durchgeführt, an der Vertreter von vier mittelgrossen Familienbetrieben dargelegt haben, dass die Annahme der Initiative ihre Existenz gefährden und Arbeitsplätze vernichten würde.
Der Titel des entsprechenden Pressekommuniqués lautet denn auch: «Juso-Initiative zerstört Schweizer Unternehmertum.» Dabei handelte es sich um die Emch-Aufzüge AG in Bern, das Transportunternehmen Henri Harsch in Carouge GE, den Hersteller von Isolationsmaterial Siga in Luzern und die Micro-Mobility-Systems von Wim Ouboter in Küsnacht ZH.
Economiesuisse will es nicht genau wissen
Doch wären die vier Firmen überhaupt von der Juso-Steuer betroffen? Massgeblich dafür ist nicht der Wert des KMU, sondern der des Nachlasses des grössten Mitbesitzers. Im Initiativtext steht: «Nicht besteuert wird ein einmaliger Freibetrag von 50 Millionen Franken auf der Summe des Nachlasses und aller Schenkungen.»
Gehört die Firma, wie etwa Emch, zwei Brüdern, so müsste jeder der beiden Anteile von mindestens 50 Millionen besitzen. Falls ein Erblasser in Gütergemeinschaft verheiratet ist, geht nur die Hälfte seines Besitzes in den Nachlass. Zumindest ist das im Kanton Solothurn so geregelt, der als einziger Kanton eine Nachlasssteuer kennt.
So gesehen müsste eine Firma mit zwei verheirateten Hauptaktionären mindestens 200 Millionen Franken wert sein, damit sie von der Juso-Initiative überhaupt betroffen ist. Ob eine Firma betroffen ist, liesse sich anhand der Steuererklärung des Hauptinhabers leicht überprüfen. Behelfsmässig könnte man den Unternehmenswert auch aufgrund des Gewinns schätzen. Gemäss dem Vermögenszentrum gilt für kleinere und mittlere Unternehmen ein Kapitalisierungssatz von mindestens zehn Prozent. Konkret: Der Wert des Unternehmens entspricht dem Zehnfachen des durchschnittlichen Jahresgewinns.
Hat Economiesuisse ihre vier Kronzeugen diesem Test unterworfen? Natürlich nicht. Man solle sich diesbezüglich bei den vier Firmen direkt erkundigen, heisst es auf Anfrage. Das Ergebnis: Harsch ist nicht betroffen, befürchtet aber, später betroffen zu sein. Die drei anderen Firmen liessen ausrichten, dass sie die Nachlasssteuer bezahlen müssten, ohne jedoch Details offenzulegen. Das ist zwar ihr gutes Recht, doch wer in einem nationalen Abstimmungskampf als Kronzeuge auftritt, müsste schon die Karten auf den Tisch legen.
Ob eine Firma von der Steuer betroffen wäre, ist nur die Vorfrage. Entscheidend ist, ob die Steuer wirklich die Existenz der Firma und deren Arbeitsplätze gefährden würde. Emch-Geschäftsleiter Bernhard Emch beschreibt es so: «Unser Vermögen steckt in Patenten und im Unternehmen und liegt nicht auf unserem Bankkonto.» Und weiter: «Weil das Unternehmensvermögen nicht einfach liquidiert werden kann und Kredite zur Begleichung der Steuer illusorisch sind, bliebe nur der Verkauf von Unternehmensanteilen oder gar der ganzen Firma. Ein Verkauf ins Ausland und der Verlust der lokalen Arbeitsplätze wäre wahrscheinlich.»
Dickes Finanzpolster
Kann sein, doch um das nachvollziehen zu können, müsste man die Bilanz und die Erfolgsrechnung der Firma Emch kennen. Angenommen die Hälfte des Eigenkapitals der Firma ginge in den Nachlass. Dann müsste ein Viertel des Eigenkapitals mit Krediten finanziert werden. Das ist viel. Und da rächt es sich, dass die Initianten keine Übergangslösung vorgeschlagen haben. Etwa in der Art, dass die Steuer ratenweise in fünf Jahren bezahlt werden müsste oder dass der Staat anstelle der Barzahlung als stiller Teilhaber an der Firma beteiligt werden könnte. Das könnte vielleicht im Ausführungsgesetz noch nachgebessert werden.

Ferner ist zu beachten, dass die Mitbesitzer grosser Familienunternehmen meist noch über ein beträchtliches, liquid angelegtes Privatvermögen verfügen. Davon müsste zwar auch die Hälfte versteuert werden, doch da bleibt immer noch ein Liquiditätspolster, das ins Unternehmen zurückfliessen könnte. Inwiefern der Erblasser die Steuer vermeiden kann, indem er vorab Teile des Unternehmens an die Nachkommen verschenkt, und ob diese Schenkungen bei der Berechnung der 50-Millionen-Grenze angerechnet würden, hängt vom Ausführungsgesetz ab. Der Initiativtext lässt da Spielraum. Und die Erfahrung zeigt, dass das Parlament als Gesetzgeber die Vorgaben des Volkes beziehungsweise der Verfassung mitunter locker auslegt.
Kommen wir nun zur Behauptung, wonach Kredite im Falle von Emch «illusorisch» seien. Das mag zwar im Einzelfall so sein, ist aber offenbar nicht die Norm. Gemäss der Statistik der Bankenkredite beanspruchen die Unternehmen mit 250 Mitarbeitern oder mehr (also die Kandidaten für die Juso-Nachlasssteuer) aktuell Kredite von 52 Milliarden Franken. Ihre Kreditlimite beläuft sich aber auf 114 Milliarden Franken, also gut 60 Milliarden mehr. Wenn man bedenkt, dass die Steuer gemäss den Initianten dem Staat jährlich 6 Milliarden Franken (hier) und gemäss dem Bundesrat gar nur gut 4 Milliarden Franken (hier) einbringen würde, sehen diese 60 Milliarden nach einem sehr beruhigenden Polster aus. Im Klartext: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Steuer eine Firma in finanzielle Schieflage bringt, scheint gering zu sein.
Die Herren der Jobs – Saus und Graus
Die Initianten behaupten, dass nur 0,05 Prozent der Steuerzahler von der Nachlasssteuer betroffen wären. Economiesuisse versucht, mit ihrer Propaganda den Eindruck zu erwecken, als ob im Falle einer Annahme sehr viele Unternehmen den Laden zumachen und die Arbeitsplätze ins Ausland auslagern müssten. Die Pressekonferenz und die entsprechende Medienberichterstattung zeigen aber, dass es Economiesuisse nicht darum geht, diese Befürchtung sachlich zu begründen und eine entsprechende Diskussion zu führen. Vielmehr geht es offenbar darum, eine Drohkulisse aufzubauen. Im Sinne von: «Wenn ihr uns zur Kasse bittet, nehmen wir euch eure Jobs weg.»
Der Berichterstatter von «20 Minuten» hat das offenbar verstanden und wie folgt auf den Punkt gebracht: «Wenn nun also das Geld für die Bezahlung von Erbschaftssteuern ausgegeben werden müsse, seien die Firmenerben plötzlich tatsächlich ‹reich›, so die Logik der vier Chefinnen und Chefs. Denn um die Steuer zu bezahlen, müssten die Firmen verkauft werden – wohl an ausländische Investoren. Das plötzlich frei verfügbare Geld könnten die Erben dann ausgeben, um sich ein Leben in Saus und Braus mit Privatjets und Jachten zu ermöglichen.»
Die Botschaft ist klar: Wir sitzen am längeren Hebel. Wir haben die dickeren Reservepolster. Für uns der Saus, für Euch der Graus.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





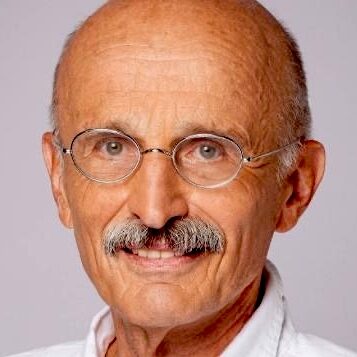



Logisch operiert economisuisse nur mit der halben Wahrheit. Sie müssen diese berechtigte Initiative auf jeden Fall bodigen. Da ist jedes Mittelrecht.
Vielleicht ist es tatsächlich ein Problem, wenn grosse Firmen im Wert von vielen Milliarden CHF belehnt oder verkauft werden müssten. Wäre es sinnvoll, wenn die Erben ihre Erbschaftssteuer auch in Form von Beteiligungen begleichen könnten. Der Staat würde dann teilweise Mitbesitzer dieser Firmen, was sicher im öffentlichen Interesse wäre. (ich kenne mich in diesem Thema überhaupt nicht aus. Vielleicht haben Eure Leser kluge Antworten dazu).
wvt reflektiert gescheit, aber an der realität vorbei bzw auf grundlage falscher annahmen:
– vorab bestimmt der staat, was 50+ mio wert hat – gerade bei unternehmen ein spiel mit annahmen und willkür, letztlich ‚selon les besoins du fisc‘
– dann ist die steuer in ‚cash‘ geschuldet. cash ist die wertvollste form von vermögen – wer je etwas verkaufen musste, um cash zu haben, kennt das thema
– es gibt drittens keine finanzierung für steuerschulden – wer von der künftigen erbschaftssteuer betroffen ist, muss ‚notverkaufen‘ oder die steuer aus laufenden einkommen zahlen – für 1 mio steuer müssen rund 1.5-2 mio verdient werden – das liegt weit ausserhalb der ch-kmu-realität
– die reichen werden von der steuer nicht betroffen, sie ziehen weiter (idealerweise vor der abstimmung)
– die steuer trifft tatsächlich die ‚unternehmer‘, sprich die leistungsträger der arbeiterklasse und schwächt diese sowie die schweiz fundamental
– finally: vermögen wird aus bereits versteuerten einkommen gebildet