Gibt es auch schuldige Zivilisten?
Kürzlich äusserte sich Kamala Harris zum Krieg zwischen Israel und den Hamas. Die NZZ berichtete so: «Zu viele unschuldige Zivilisten seien getötet worden, sagte die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris.»
Nehmen wir mal an, Harris habe das tatsächlich so gesagt – dann hätte die NZZ das niemals einfach so wiedergeben dürfen. Sie hätte gleich mehrere Fragen stellen müssen:
- Was heisst «zu viele»?
- Wie viele getötete «unschuldige Zivilisten» wären richtig gewesen?
- Und gibt es auch schuldige Zivilisten?
- Wodurch unterscheiden sie sich von den unschuldigen?
Zugegeben: Die Fragen sind zynisch. Sie zeigen aber auch, wie zynisch die Aussage von Kamala Harris ist. Oder zumindest gedankenlos. Infosperber zeigte im letzten November auf, mit wie wenig Sorgfalt wir sprechen und schreiben. Inzwischen hat Infosperber von etlichen Lesern und Leserinnen, die sich nicht in der Kommentarspalte äussern wollten, weitere Beispiele erhalten.
Verzerrt
Manchmal ist unsere Wortwahl so falsch, dass wir die Wirklichkeit verzerren:
- Kürzlich veröffentlichte die Berner Band «Züri West» ein neues Album. Radio SRF berichtete über deren Sänger Kuno Lauener. Er sei «angeschlagen». Dabei ist der Mann krank. Und zwar richtig. Er hat Multiple Sklerose. Er selber sagt: «Mir geht es beschissen!»
- Radio SRF berichtete auch darüber, dass es zwischen 1970 und 2000 bei Adoptionen «wohl in mehreren tausend Fällen zu Unregelmässigkeiten gekommen» sei. Tatsächlich wurden Kinder ihren leiblichen Eltern weggenommen und verkauft. Das sind nicht einfach «Unregelmässigkeiten». Den unpassenden Begriff verwendete das Bundesamt für Justiz in seiner Medienmittelung. Und Radio SRF übernahm ihn, statt ihn zu übersetzen. Eigentlich wäre das die Aufgabe aufmerksamer Journalisten.
Harmlos
Weit verbreitet sind Ausdrücke, welche die Wirklichkeit harmloser erscheinen lassen, als sie ist. Häufig stammen sie aus der Werbesprache, schaffen es aber erstaunlicherweise in die Alltagssprache:
- Die NZZ schreibt von «hochpreisigen» Elektronikgeräten, die Aargauer Zeitung von «hochpreisigen» Kleidern, und die Berner Zeitung schiesst den Vogel ab, indem sie über «hochpreisige Herbergen» berichtet. Mit den «Herbergen» meint sie Hotels. Und zwar Luxushotels. Denn «hochpreisig» heisst ganz einfach «teuer».
- Wenn es einer Firma schlecht geht, dann spricht der Chef häufig von «Herausforderungen», die es anzunehmen gelte. Auch Politiker, Sportler und Künstler stehen häufig vor «Herausforderungen». Die Wörter «Probleme» oder «Schwierigkeiten» meiden sie. Obwohl eigentlich diese Wörter angemessen wären. Oder sagt ein Kind etwa? «In der Schule stehe ich vor grossen Herausforderungen.»
- Auch beim nächsten Wort hilft die kindliche Sichtweise. Ein Kind sagt: «Ich habe Angst, in den dunklen Keller zu gehen.» Wirtschaftsleute, Politiker, Sportler oder Künstler gestehen nie, dass sie «Angst» haben. Sie haben «Respekt». Das tönt souveräner.
Unüberlegt
Wer Fremdwörter verwendet und sie auch noch auf eigenartige Weise zusammensetzt, der möchte häufig etwas verbergen oder verschleiern:
- «Energieintensiv» ist so ein Wort. Es ist völlig nichtssagend. Denn es sagt nicht, ob zum Beispiel ein Betrieb viel Energie herstellt oder viel Energie verbraucht. Gemeint ist natürlich immer der Verbrauch. Warum also nicht sagen, dass der Betrieb viel Energie verbraucht oder – wenn das der Fall ist – verschwendet? Und wenn wir schon dabei sind: Warum nicht sagen, ob es Öl, Strom oder Gas ist?
- Die Berner Zeitung berichtete kürzlich über «flächen- und emissionsintensive Gewerbebetriebe». «Flächenintensiv» heisst: Sie brauchen viel Platz. Aber was heisst «emissionsintensiv»? Stinken sie? Verpesten sie die Luft? Vergiften sie die Gewässer? Oder sind sie nur ein bisschen laut?
Kompliziert
Manchmal verwenden wir Wörter, die unnötig kompliziert sind. Warum nur? Weil wir klug wirken wollen? Weil wir dem Gesagten eine grössere Bedeutung geben wollen?
- Ein schreckliches Wort ist die «Gebäulichkeit». Das Wort besteht aus einer Vorsilbe und zwei Nachsilben: «Ge-», «-lich» und «-keit». Alle drei sind unnötig. Eine «Gebäulichkeit» ist nichts anderes als ein «Haus». Meinetwegen ein «Bau». Oder wenn es sein muss: Ein «Gebäude».
- Ähnlich ist es mit der «Begrifflichkeit». In der Fachsprache der Philosophie mag die «Begrifflichkeit» ihre Berechtigung haben. Aber in der Normalsprache bedeutet die «Begrifflichkeit» nicht mehr als der «Begriff».
- Die «Berner Zeitung» berichtete kürzlich darüber, dass im Wankdorfquartier ein «Areal entwickelt» werde. Fünf Mal stand das so im Artikel – vermutlich, weil das die Sprachregelung der Investoren ist. Aber die Aufgabe des Journalisten wäre es, die Werbesprache in Normalsprache zu übersetzen. Und dann würde das Areal nicht «entwickelt», sondern «überbaut». Die Investoren haben übrigens laut Berner Zeitung «Themen wie Verkehr, Erschliessung, Klima oder Biodiversität auch auf konzeptioneller Ebene mitgedacht» – was immer das auch heissen mag. Aber zugegeben: Es tönt gut.
Verwirrend
Eigentlich sollte Sprache der Verständigung dienen. Doch manche Leute bedienen sich ihrer, um sich abzuheben, statt um sich verständlich auszudrücken:
- Mit dem «Globalen Süden» sind nicht etwa die Länder auf der Südhälfte der Erdkugel gemeint, sondern Entwicklungs- und Schwellenländer. So gehören Länder zum «Globalen Süden», die ziemlich weit in den Norden reichen. Die Mongolei und China etwa – je nach Definition auch Kasachstan, die Ukraine und Weissrussland. Australien und Neuseeland hingegen gehören zum «Globalen Norden», obwohl die beiden Länder auf der Südhalbkugel liegen.
- Lange Zeit war der Begriff «Bankier» für den Besitzer einer Bank geläufig – allenfalls auch für die Mitglieder des Verwaltungsrats. Alle anderen, die bei der Bank arbeiteten, waren Bankangestellte. Heute ist das anders. Heute ist jeder ein «Banker» – ganz egal, ob er Besitzer oder Lehrling ist.
Modisch
Natürlich ist die Sprache ständig wechselnden Moden unterworfen. Doch was modisch ist, ist nicht immer gut:
- Im Fernsehen SRF zeigte sich der Reporter begeistert über die Sprungkraft des Zürcher Fussballers Nikola Katic: «Da ist Katic gefühlt 500 Meter höher gesprungen als alle anderen.» «Gefühlt?» Was hat der Reporter da genau gefühlt? «Gefühlt» sagen Journalisten meist, wenn sie es nicht so genau wissen. Oder wenn sie – wie in diesem Beispiel – Unsinn erzählen.
- Und gleich noch ein Beispiel dazu – diesmal aus einem Artikel über die amerikanische Automarke Cadillac in der Sonntags-Zeitung: «Wenn es ums Image geht, dann soll es für Cadillac in China der gefühlt sechs Meter lange Celestiq richten.» Die wenigen Leser, die sich für dieses Auto interessieren, möchten wohl lieber wissen, wie lang das Auto tatsächlich ist und nicht was der Journalist fühlt.
- Die Tamedia-Zeitungen brachten kürzlich eine Reportage aus Polen – angekündigt als «Roadtrip durch das Land». Warum nicht einfach eine «Fahrt durch das Land»?
- In letzter Zeit werden uns häufig so genannte «Rollenmodelle» präsentiert. Was das ist? Genau das, was man bis vor kurzem als «Vorbild» bezeichnete. Oder – wenn es unbedingt ein Fremdwort sein musste – als «Idol». Das «Rollenmodell» ist aus dem Englischen entlehnt. Dort heisst es «Role model». «Role model» ist länger als das deutsche «Vorbild». Und es bietet keinerlei Vorteile – ausser vielleicht, dass es modisch klingt.
«Dysfunktionale Familie»
«Die Jugend kapiert Texte nicht? Kein Wunder – die Erwachsenen haben vor lauter politischer Korrektheit eine Sprache geschaffen, die die Dinge nicht mehr beim Namen nennt.» Das schrieb Bettina Weber kürzlich in der Sonntags-Zeitung (Bezahlschranke).
Sie nennt in ihrem Artikel viele Beispiele. Etwa das «kaputte Daheim», das heute eine «dysfunktionale Familie» ist. Weber schreibt: Die «dysfunktionale Familie» rieche nicht «nach Rissquetschwunden, betrunkenen Vätern, süchtigen Müttern und Missbrauch. ‹Dysfunktional› riecht nicht, schmeckt nicht, schreit nicht. Ob das den betroffenen Kindern hilft?»
Weiterführende Informationen
Infosperber: Verharmlosende Sprache: Mangelnde Sorgfalt oder Absicht?
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





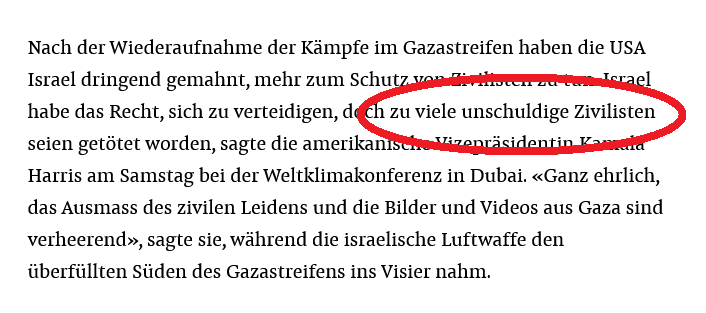

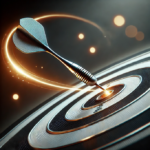


1. Vielen Dank für diese mit Humor geladenen Zeilen. Mir ist nach wie vor ein Rätsel, inwiefern diese «Verzerrungen» bewusst bzw. gezielt einfliessen. Ein bekanntes Beispiel ist die «NATO-Osterweiterung» gegenüber der russischen «Spezialoperation» nach Westen (hier ist keine Meinung gemeint, nur offensichtliche Kommunikationsmerkmale).
2. Eine brennende Frage in die Runde der langjährigen Profijournalisten: Warum lieben diese so unendlich gern Superlative? Immer wieder kommen die «Top Banker», die reichste Frau, der beste dies, die grösste das. Es würde mich sehr freuen, einmal etwas über die Ursache zu erfahren.
3. ChatGPT ist sehr kreativ beim Erstellen von beeindruckenden, jedoch völlig inhaltslosen Texten. Aber Achtung, dieses Spiel macht süchtig!
Leider vermischt der Artikel einige Verwendungen ungeliebter Wörter miteinander, die man unterscheiden sollte:
So ist «dysfunktional» tatsächlich schwer verständlich. Es gehört eher in eine wissenschaftliche Zeitschrift aus der Pädagogik als in ein Publikumsmedium. Aber mit der vielgeschmähten politischen Korrektheit hat die Verwendung des Wortes gar nichts zu tun. Wenn schon, dann mit papierener Sprache oder Verwaltungssprache. – Ein Seitenhieb gegen die p.c. klingt halt immer gut.
Die «Herausforderungen» und die «Entwicklung eines Grundstücks» hingegen kommen hingegen ganz klar aus der Sprache von «Kommunikationsabteilungen» grosser Unternehmen.
Zudem würde ich das «Rollenmodell» verteidigen: Ein Rollenmodell ist eine Person, die sich in einer ganz bestimmten Rolle vorbildlich verhält, ein Vorbild eine ganz allgemein «vorbildliche» Person und ein Idol (ach, auch schon wieder so ein böses Fremdwort!) eine Person, die jemand schon fast vergöttert.
Danke, was für ein erbaulicher Bericht. Als ein begeisterter Anhänger von Marshall Rosenbergs «Non Violence Communikation» und ehemaliger Streetworker sowie Mediator freue ich mich sehr, das hier über die Feinheiten, Untertöne und sublingualen Botschaften in Aussagen zu Ereignissen der gegenwärtigen Zeit eingegangen wird. Unsere Sprache beinhaltet viele offene und versteckte Gewalt, und/oder versteckte Gewaltaufforderungen. Oft ohne das dies den Betroffenen bewusst wäre. Unsere Sprache ist oft irreführend, verallgemeinernd, indifferent und sät oft Handlungsgewalt welche jenseits von angemessener und deeskalativer Notwehr liegt. Der Mund redet oft so, wie das Kind es gelernt hatte. Oft wird erst hinterher nachgedacht über die möglichen Konsequenzen.
Na ja, und die Lage im Gazastreifen ist «prekär».
Danke für den hilfreichen Artikel.
Ich sehe die Ursache hautpsächlich im Englischen. Kommuniziere ich mit meinen Englischen Arbeitskollegen hatte ich früher oft die Situation, dass wir bei Bezeichnung der Dinge wie sie sind, aufgelaufen sind. Wir wurden angehalten, «positiver» zu kommunizieren. Aus «Problem» wird dann «Incident» oder «Challenge» oder «Topic». Ähnliches ist seit einziger Zeit in deutschsprachigen Medien zu beobachten.
Zum sorglosen Umgang mit der Sprache merke ich an, dass dies im Kopf beginnt. Und hier bin ich klarer Gegner der «Gedanken sind frei» Mentalität und dass doch jeder denken möge was er will. Klar dürfen Menschen das. Gehe ich damit aber sorglos um verändert sich auch meine Sprache und später auch das Handeln weshalb wir unseren Kindern beizubringen versuchen, dass unsere Handlungen den Ursprung im Kopf haben und es deshalb eben sehr wichtig ist, auch dieses Konstrukt zu einem gewissen Grad unter Kontrolle zu halten.
Erwähnenswert wäre auch noch die ebenso gedankenlose wie dumme Phrase von «den zahlreichen Todesopfern, darunter auch viele unbeteiligte Frauen und Kinder», die der Anschlag gefordert habe. Die beim Attentat ebenfalls zu Tode gekommenen unbeteiligten Männer scheinen da offenbar als blosse «quantité négligeable» zu zählen …
Ein erhellender und kurzweiliger Artikel; er führt zu der Frage, warum man nicht immer Martin Luthers Diktat der «freien Schnauze» folgt. Und die ist sehr schwierig zu beantworten; im wesentlichen geht es darum, sich nicht angreifbar zu machen, Dinge so formulieren, dass man sie bei Gegenwind gleich relativieren oder in einem anderen Lichte darstellen kann. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man sich in der Öffentlichkeit, in der Firma, bei schwierigen Diskussion so eine Redeweise angewöhnt, um vieles so lange im Vagen zu lassen, bis sich ein Konsens bildet, bei dem man dann konkreter werden kann. Manchmal geht es auch schlicht um Wortgebilde um Zeilen zu füllen oder Bildung vorzugaukeln – um eine gewisse gehobene Geschwätzigkeit.