Kommentar
Mit hohen Mieten die Steuerkasse füllen?
In der Ausgabe vom 9. Mai hat die NZZ gleich zwei ganze Seiten dem Thema der steigenden Mieten gewidmet. Die erste Breitseite feuert sie gegen das «vermeintliche Wiener Wohnparadies» ab. Dort gehören 57 Prozent aller Wohnungen der Stadt oder Genossenschaften, und der Staat subventioniert den Wohnungsbau jährlich mit 2,5 Milliarden Euro. Viel zu teuer, marktwidrig und ineffizient, meint die NZZ.
Stadt Zürich: 146 Millionen Franken Mehreinnahmen
Im zweiten Text sagt sie uns, dass der gemeinnützige Wohnungsbau viel teurer sei, als viele denken. Zitat: «Ein Gemeinwesen, das sein Land zu einem günstigen Baurechtszins an einen gemeinnützigen Wohnbauträger abgibt oder auf der gleichen Basis selber baut, hat dadurch zwar keine eigentlichen Kosten; es verzichtet aber auf mögliche Einnahmen, was auf das Gleiche hinausläuft.»
Die NZZ zitiert eine Studie des Immobilienökonomen Niels Lehmann von der Universität Zürich. Danach könnte die Stadt Zürich für jede der 122 Wohnungen (mit 400 BewohnerInnen) der Überbauung Hornbach im Seefeld-Quartier monatlich 2400 Franken mehr einnehmen, sofern sie den marktüblichen Baurechtszins von 3% verlangen würde. Mit diesem Betrag, so die Studie weiter, könnte man die Mieten von 600 BewohnerInnen halbieren. Würde die Stadt Zürich alle ihre Liegenschaften zu marktüblichen Konditionen vermieten, könnte sie jährlich gar 146 Millionen Franken mehr einnehmen und müsste entsprechend weniger Steuern erheben.
Die NZZ schreibt nicht genau, wie Lehmann zu seinen Zahlen kommt, aber zumindest die Grössenordnung ist leicht nachvollziehbar: Laut Presseberichten hat die Swisslife neulich für ein Baugrundstück in Leutschenbach 11’718 Franken pro Quadratmeter bezahlt. Bei einer maximalen Ausnützungsziffer heisst das: In jedem vermietbaren Quadratmeter stecken rund 9000 Franken Grundstückpreis. Bei 3% Zins ergibt das hochgerechnet auf eine Wohnung von 100 Quadratmetern 2250 Franken monatlich – plus natürlich alle anderen effektiven Kosten.
Bedenkt man zudem, dass das Zürcher Seefeld-Quartier als deutlich bessere Lage gilt als Leutschenbach, sind die oben erwähnten 2400 Franken Mieterhöhung auch dann realistisch, wenn diese nicht den ganzen Baurechtszins widerspiegeln, sondern nur die Differenz zwischen dem von der Stadt verlangten und dem auf den aktuellen Bodenpreisen beruhenden marktüblichen Baurechtszins.
Doch wir zahlen nicht nur als MieterInnen drauf, sondern auch als KonsumentInnen. Ein Beispiel: Die SBB kassieren im Zürcher Hauptbahnhof Mieten von 3000 bis 5000 Franken pro Quadratmeter. Bei einem Umsatz von 25’000 Franken pro Quadratmeter heisst das: Bei jedem Franken, den wir im Shop-Ville ausgeben, zahlen wir 10 bis 15 Rappen Miete bzw. Bodensteuer.
Marktübliche Mieten für alle
Die NZZ geht davon aus, dass alle die marktüblichen Mieten kassieren und bezahlen sollten. Teure Lagen sollen teuer sein, «damit haushälterisch mit ihnen umgegangen wird und sie optimal genutzt werden». Zudem käme der Staat damit zu mehr Steuereinnahmen, die er teilweise dazu verwenden könnte, «diejenigen Nachfrager, die es nötig haben, direkt zu subventionieren», natürlich ohne übertriebene «Begehrlichkeiten» zu befriedigen.
Das stimmt. Hohe Preise zwingen uns zu einem sparsamen Umgang mit dem Boden und der Wohnfläche. Doch es bleibt die Frage, wer diese Knappheitsrente abschöpft. Die NZZ betrachtet ein Beispiel, bei dem dieses Geld an den Staat geht. In diesen Fall kann sich der Mieter zwar darüber ärgern, dass er dem Staat viel mehr abliefern muss als der Nachbar, der praktisch mietfrei im geerbten Haus lebt. Doch als Bürger hat er immerhin den Vorteil, dass er mit diesem Geld auch staatliche Ausgaben finanziert, etwa für Schulen, Infrastruktur etc. Er profitiert auch dann, wenn er nicht in den Genuss von staatlichen Wohngeldern kommt.
Ganz anders ist es, wenn private Grundeigentümer den Aufpreis kassieren, wenn diese sich – um es anschaulich darzustellen – auf der Dachetage eines 12-Parteien-Hauses gratis eine Attika-Wohnung einrichten und von ihren Mietern monatlich 11 mal 2400 Franken netto zusätzlich kassieren. Von den 26’400 Franken monatlichem Zusatzeinkommen können sie sich dann nicht nur zwei Ferraris in die Tiefgarage stellen, sondern auch noch eine Zweitwohnung im Tessin leisten – plus eine Spende an den Hauseigentümerverband, der sich gegen die steuerliche Abschöpfung des Mehrwerts zur Wehr setzt. In diesem Fall bleibt unter dem Strich auch von sparsamem Umgang mit dem Boden nicht viel übrig: Das, was unten an Wohnraum eingespart werden muss, wird oben wieder verschwendet.
Mieten richten sich nach der Kaufkraft
Das obige Beispiel stellt den Sachverhalt nur leicht überspitzt dar: Die Knappheitsrente des Bodens ist längst zu einer volkswirtschaftlich relevanten Umverteilungsmaschine geworden, und zwar Umverteilung von unten nach oben. Laut dem Immobilienberater Wüestpartner beläuft sich der aktuelle Marktwert aller Wohn- und Geschäftsimmobilien in der Schweiz auf 3640 Milliarden Franken. Davon dürften maximal 1500 Milliarden (2500 Fr. pro m2 Bruttogeschossfläche) auf den Wert der Bausubstanz entfallen. Es bleiben 2140 Milliarden für den reinen Bodenwert. Bei der von Wüestpartner ausgewiesenen durchschnittlichen Nettocashflow-Rendite (ohne Wertvermehrung) von 3,7% errechnet sich eine «marktgerechte» nationale Bodenrente von 77 Milliarden Franken. Zum Vergleich: Die AHV zahlt jährlich 44 Milliarden Renten aus.
Klar: Die 77 Milliarden sind ein theoretischer Wert. Zum Glück sind nicht alle Mieten so marktgerecht, wie die NZZ das gerne hätte. Und viele Leute können sich «marktgerechte» Mieten schlicht nicht leisten. Auch deshalb nicht, weil ihr Arbeitgeber, zum Beispiel die Valora, der SBB so viel Geld für die Ladenmiete bezahlen muss, dass für die Verkäuferin ein Lohn von 3900 Franken brutto genügen muss.
Anders als auf normalen Märkten, wo der Wettbewerb dafür sorgt, dass die Preise nur leicht über den effektiven Kosten liegen, richten sich die Immobilienpreise bzw. die Mieten rein nach der Kaufkraft der Nachfrager. Die effektiven Kosten bilden zwar die Untergrenze. Diese dürfte bei etwa 1000 Franken monatlich für 100 Quadratmeter liegen, sie ist aber praktisch nicht relevant. Wenn nun der Staat – wie das die NZZ vorschlägt – den weniger kaufkräftigen Wohnungssuchenden finanziell unter die Arme greift, finanziert er dadurch letztlich nur die Grundbesitzer.
Das Aktenzeichen «explodierende Bodenpreise» bleibt vorerst ungelöst. Immerhin beginnt es auch die NZZ zu ahnen, dass da sozialpolitisches Dynamit drin steckt.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine.





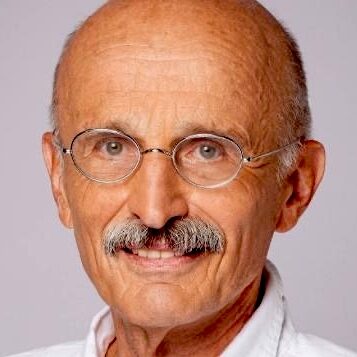



Do. Nacht strahlte SRF 1 eine denkwürdige Sendung aus: ‚Wem gehört die Stadt? Der neue Klassenkampf ums Wohnen‘.
– Zuvor wies die NZZ im fraglichen Artikel auf diese Sendung hin, nicht ohne die an sich klar Aussage im Film zum System-Fehlers im Kapitalismus umzudeuten.
— Sie plädiert für ‚Markt-Mieten‘ im Wohnungsmarkt.
— Im Film geht es darum, dass die Super-Reichen derzeit die Reichen + zuvor die Reichen die Normalos in den Städten per Überbieten der Mieten aus ihren Wohnungen vertreiben.
Niemand wird dieses Fakt widerlegen können.
Um was geht es beim ‚groben System-Fehler im Kapitalismus‘? Wir kennen die Antwort: Die Reichen werden immer reicher, die Normalos geraten dabei immer mehr unter die finanziellen Räder.
– Dabei ist die Geld-Verteilung nur einfach eine Konvention: Wir Normalos akzeptieren (mehr oder weniger Widerspruch-los), dass ’sie‘ für ihre Leistungen viel bis exzessiv viel Geld erhalten, während wir den Rest unter uns verteilen.
– ‚Sie‘ sprechen laufend von ‚Umverteilung von oben nach unten‘ + verschweigen, dass die Umverteilung real nur eine Richtung kennt + alle Statistiken dies seit Jahren bestätigen: Jene von unten nach oben.
Tatsächlich sind gelegentliche Umverteilungsübungen von oben nach unten nur überfällige Mini-Korrekturen im kranken System, weil uns Normalos sonst der Kragen platzen würde.
Also: Es liegt an uns Normalos zu stoppen, dass wir ‚ihnen‘ diesen exzessiven Reichtum zugestehen. Wir müssen diese Fehl-Entwicklung ändern wollen …
Die Immobilienbranche ist Kommunismus pur. Die Enteignung der Mieter wird immer perfekter. Und die Nomenklatura leistet sich die standesgerechten Datschas.