Kommentar
Der tiefere Grund für die tiefen Zinsen
Der 15-Milliarden-Franken-Verlust der Schweizerischen Nationalbank im letzten Jahr gibt den Kritikern wieder einmal Gelegenheit, das Direktorium der SNB für ihre Negativzinsen und für ihre aktuell auf 775 Milliarden Franken angewachsenen Devisenreserven hart zu kritisieren. Die Nationalbank habe damit die Wirtschaft nicht angekurbelt, dafür aber Pensionskassen und Banken in Schwierigkeiten gebracht. Sie sei mit dieser «Geldschwemme» ein viel zu hohes Risiko eingegangen und habe einen gefährlichen Immobilienboom ausgelöst.
Diese Vorwürfe sind nicht ganz falsch, doch ein wichtiger Punkt wird dabei übersehen: All diese Übel haben einen tieferen Grund. Sie lassen sich nicht einfach beheben, indem die Nationalbank höhere Zinsen zahlt oder die Käufe von Devisen einstellt. Dieser tiefere Grund liegt in den seit bald 20 Jahren weltweit auftretenden Nettofinanzierungsüberschüssen der Unternehmen.
Die Schweiz spart rund 60 Milliarden Franken zu viel
Im Klartext heisst das: Den Unternehmen insgesamt (nicht jedem einzelnen) bleibt nach dem Bezahlen aller Investitionen, Gehälter, Boni und Dividenden noch Geld übrig. Das bedeutet aber gleichzeitig: Privathaushalte und deren Pensionskassen können ihre Ersparnisse nicht mehr real investieren. Weder in Maschinen, noch in Fabrikgebäude, noch in neue Erfindungen. Denn das haben (fast) alles schon die Unternehmen bezahlt. Und wenn – wie in der Schweiz und in Deutschland – auch der Staat keine Schulden mehr macht, können die privaten Ersparnisse auch nicht in neue Staatsanleihen bzw. in Schulen, Strassen oder Schienen investiert werden. Denn das alles ist bereits vom Staat eigenfinanziert.
Im Falle der Schweiz sah das im Durchschnitt der letzten fünf Jahre so aus: Die Privathaushalte haben jährlich rund 73 Milliarden Franken und der Staat 2 Milliarden netto gespart, zusammen also 75 Milliarden. Davon haben die inländischen Unternehmen jeweils nur etwa 15 Milliarden für die Finanzierung ihrer (rund 110 Milliarden) Investitionen beansprucht. Den grossen Rest haben sie dank üppigen Margen und Gewinnen selbst finanzieren können. Unter dem Strich heisst das, dass die Schweiz jährlich rund 60 Milliarden Franken zu viel gespart hat.
Der Markt bestraft übertriebenes Sparen
Im Ausland sieht es ähnlich aus. In Euroland etwa haben die Privathaushalte im Schnitt der letzten fünf Jahre jährlich etwa 250 Milliarden Euro gespart. Gleichzeitig haben auch die Unternehmen nicht nur alle Investitionen selbst finanziert, sondern auch noch rund 250 Milliarden auf die hohe Kante gelegt. Von diesen total rund 500 Milliarden Euro wiederum ist etwa ein Drittel zur Fremdfinanzierung der staatlichen Investitionen verwendet worden. Es bleibt also ein Sparüberschuss von jährlich gut 300 Milliarden Euro in der EU und von 60 Milliarden Franken in der Schweiz.
Doch was heisst das – Sparüberschuss? Im Nachhinein gesehen wird das ganze BIP entweder konsumiert oder investiert. Alles, was nicht investiert wird, ist Konsum. Ein Sparüberschuss bedeutet also, dass auf Kredit konsumiert worden ist. Konkret: Die Anleger der Eurozone und die Schweiz haben ihr Geld in grossem Stil in staatlich garantierte Konsumkredite investiert. Und zwar nicht von irgendwelchen Staaten, sondern von solchen, die man heute als Schuldenstaaten bezeichnet.
Dass solche Guthaben nicht rentabel sein können, ist auch volkswirtschaftlich richtig. Kausal gesehen hängen nämlich die Investitionen von der Konsumnachfrage ab. Die Unternehmen investieren nur, wenn sie die erweiterten Produktionskapazitäten auch auslasten können. Zu hohe Ersparnisse, zu wenig Konsum bewirken somit, dass weniger investiert wird, womit das BIP sinkt bzw. langsamer steigt. Deshalb ist es logisch, dass der Markt übertriebenes Sparen mit Negativzinsen bestraft.
Unsichere Auslandsguthaben
Dass er dies tut, zeigt unter anderem die Entwicklung der Auslandsvermögen und der Zahlungsbilanz der Schweiz. Die entsprechenden Statistiken zeigen, dass unser Auslandsvermögen seit dem Jahr 2000 weit weniger gestiegen ist, als dies auf Grund der chronisch hohen Leistungsbilanzüberschüsse zu erwarten gewesen wäre. Die Devisenguthaben haben zwar regelmässig Renditen abgeworfen, sie haben sich (in Franken gerechnet) aber auch immer wieder entwertet. Der Euro hat heute fast 30 Prozent, der Dollar 40 Prozent weniger Wert als damals. Unter dem Strich haben unsere Auslandsguthaben in diesen fast 19 Jahren einen Verlust von rund 250 Milliarden Franken eingefahren, was einer Negativverzinsung von rund 0,8 Prozent entspricht. Und das bei einem erheblichen Kursrisiko.
Angesichts dieser Erfahrungen erstaunt es nicht, dass viele Anleger bereit sind, ihre unsicheren Auslandsguthaben gegen solide Guthaben gegenüber der Schweizerischen Nationalbank oder der Europäischen Zentralbank einzutauschen. Und zwar selbst dann, wenn sie dafür einen Negativzins zahlen müssen. Die SNB hat ihre Devisen im Wert von aktuell 775 Milliarden Franken alle freiwillig erhalten. Sie wird dafür vielleicht einmal einen höheren Zins zahlen müssen, wenn sie verhindern will, dass die Gelder zu schnell abfliessen und dadurch eine Inflation auslösen. Aber vorerst sieht es nicht danach aus.
Der Negativzins der Zentralbanken von 0,75 Prozent ist kein Zwang, sondern ein Angebot. Die Schweizer Geschäftsbanken müssen zwar gewisse Mindestreserven (Guthaben gegenüber der SNB) halten, aber diese betragen aktuell nur 2,5 Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten oder rund 17 Milliarden Franken. Ein Klacks im Verhältnis zu den freiwillig gehaltenen Guthaben. Mit ihrem kurzfristigen Zins setzt die Zentralbank also eine Untergrenze, unter die der Zins nicht fallen kann.
Auswirkungen auf die Realwirtschaft
Dies also die Perspektive der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Die ist für den einzelnen Anleger natürlich nicht bindend. Er kann seine Guthaben auch in Aktien oder Immobilien anlegen. Soweit dieses Geld jedoch nicht effektiv in neue Immobilien fliesst oder real in Unternehmen investiert wird (und das ist bei Nettoüberschüssen per Definition nicht der Fall), handelt es sich dabei bloss um einen Austausch bereits bestehender Besitztitel. Die Sparer kaufen sich gegenseitig Aktien oder Immobilien ab. Die Nettoüberschüsse werden dadurch nicht abgebaut.
Dennoch hat diese Anhäufung von Kapital durchaus gewaltige realwirtschaftliche Auswirkungen. Allein in den letzten zehn Jahren haben nur schon die (reichen) Haushalte und Unternehmen der Eurostaaten zusätzliche Guthaben von über 5000 Milliarden Euro aufgebaut. Die Verwaltung und die ständige Umwälzung dieser Vermögen kostet Geld, das auf die Normalbürger abgewälzt wird. Zudem wird diese Finanzmacht in grossen Investmentfonds und Firmen gebündelt und gewinnmaximierend eingesetzt. So können finanzkräftige Unternehmen (bzw. deren Aktionäre) etwa mit Auslagerungen von Arbeitsplätzen drohen, falls die Löhne und die Steuern nicht gesenkt werden. Dadurch werden zwar keine neuen Werte geschaffen, aber alte zugunsten der Aktionäre und zu Lasten der Arbeitnehmer umverteilt.
Auch der Immobilienmarkt bietet den Anlegern die Chance, das Maximum aus ihren volkswirtschaftlich unerwünschten Ersparnissen herauszuholen. Indem sie sich gegenseitig Immobilien abkaufen, treiben sie die Preise hoch und bitten die Mieter zur Kasse. Und zwar nicht zu knapp. Laut dem Immobilienberater Wüest Partner betrug 2017 der Marktwert allein der Mietwohnungen in der Schweiz 1126 Milliarden Franken und warf eine Gesamtrendite von 6,8 Prozent ab. Das sind jährlich rund 70 Milliarden, wovon knapp die Hälfte auf Wertsteigerungen beruht. Das ist in der Tat ein gröberes Problem.
Das Problem an der Wurzel packen – bei den Unternehmen
Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt: Dieses Problem kann nicht dadurch gelöst werden, indem die Zentralbanken die Zinsen erhöhen oder sonst irgend etwas tun. Die Notenbanker können das Problem bloss mehr oder weniger gut verwalten, gelöst werden muss es aber an seinen verteilungspolitischen Wurzeln – bei den Überschüssen des Unternehmenssektors. Diese müssen dazu gebracht werden, höhere Löhne und mehr Steuern zu zahlen und/oder ihre Produkte billiger zu verkaufen.
Wie das in Anbetracht der globalen Konkurrenz bewerkstelligt werden kann, ist natürlich eine knifflige Frage. Doch leider denken wir darüber noch nicht einmal nach, weil uns die Bankökonomen immer noch weismachen, dass alles nur eine Sache der Geldpolitik sei.
PS. Die hohen Unternehmensgewinne haben immerhin den ökologischen Vorteil, dass sie den Konsum bremsen – wenn auch nur den der Verlierer, der unteren Schichten. Sollten wir das verteilungspolitische Problem lösen, also höhere Löhne zahlen, ermöglichen wir mehr Konsum und verschärfen damit, als Kollateralschaden gewissermassen, das ökologische Problem. Pest oder Cholera, wenn man so will. Auch darüber müssen wir nachdenken.





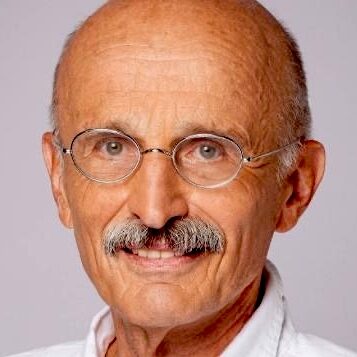




Bei der Unterschicht besteht ein gigantischer Investitions- bzw. Konsumstau (momentan ca 30‘000 Mio pA). Davon würde ein Grossteil dem Binnenmarkt zu Gute kommen. Verteilungspolitische Instrumente sorgen aber für immer mehr Divergenz. Zudem darf davon ausgegangen werden, dass viele Privatsparer aus Angst sparen (horten). Offenbar wünscht die politische Elite dieses Angstsparen – jedenfalls werden seit etlichen Jahren schlimme Weltuntergangs- und düstere Wirtschaftsszenarien an die Wand gemalt. Zudem müssen sizilianische (und andere) ‚Unternehmen‘ ihre Gelder halbwegs sicher anlegen – besser als in Schweizer Immobilien kann dies kaum geschehen. In der Summe kann man sagen: Erst handfeste soziale Unruhen würden für ein ausgleichendes Zurückschlagen des Pendels sorgen – vorher reagiert in Politik und Wirtschaft nachgewiesenermassen absolut niemand.
Danke für den – wie immer – anregenden Artikel! Informativ und desillusionierend. Den Inhalt auf einen Nenner gebracht: Im Kapitalismus mit seinem globalen Konkurrenzkampf kannst du nur zwischen Pest und Cholera wählen, um Veränderungen herbeizuführen. Das System «hängt», die Lohnabhängigen sowohl als auch die Kapitalbesitzer. Jene haben schon vor Monatsende kein Geld mehr zum ausgeben, und diese können auch nicht mehr ausgeben, sonst werden sie von der Konkurrenz beseitigt. Beim hängenden Computer muss man manchmal den Stecker ausziehen und neu starten. Das kapitalistische System verlangt dringend nach einem Neustart in Richtung Sozialismus!
Was ich an dieser Argumentation nicht verstehe: offenbar sparen ja auch die Privathaushalte und die öffentliche Haushalte zu viel. Wie soll dann eine klassische Umlenkung der Unternehmensübeschüsse in höhere Löhne und Steuern dazu führen, dass die weniger sparen? Leute und Staaten sparen, weil sie in Zukunft noch Optionen haben wollen: sie möchten «investieren» in Altersversorgung, Bildung zukünftiger Generationen und dergleichen. Überflüssiges Geld oder zu wenig Konsum ist nicht ihr Problem, sondern die Verteilung auf der Zeitachse. Früher haben Geldanlagen für diese Verteilung gesorgt, weil sie am anderen Ende Investitionen waren, und davon hat sich das Kapital emanzipiert, wie sie schön beschreiben. Ich kann nicht erkennen, wie dieses Problem durch höhere Löhne, höheren Konsum, höhere Staatsausgaben gelöst werden soll. Es sei denn all diese Höher fallen dermassen hoch aus, dass die Unternehmen tatsächlich wieder Kredite und Anleger brauchen. Aber ob das System nochmal in diese Nussschale zurück kriechen kann, wenn die Frage der Optionen über die Zeit hinweg nicht gelöst wird?
Vollkommen richtig! Zusammenhänge sauber dargelegt! Was wäre das für eine schöne Welt, wenn diese, letztlich banalen Zusammenhänge auf breiter Basis erfasst würden?! Die Auswirkungen auf unsere Wirtschaftspolitik, das Wirtschaften und Zusammenleben wären gewaltig!
Wer Vontobels Text begriffen hat, ist mehr im Bild als 95% der Wirtschaftsprofessoren, -studenten, -journalisten, Banker, Unternehmer … Ja, ich spreche aus Erfahrung (Wirtschaftsabschluss Uni Zürich).
Die (Volks-)Wirtschafts-News unserer Medien sind nicht deshalb «schwer zu verstehen», weil die «Wirtschaft wahnsinnig komplex» ist, sondern weil dort die von Vontobel dargelegten Basics vernebelt werden. Nicht etwa aus Böswilligkeit, sondern weil die Journalisten und selbsternannten «Wirtschaftsexperten» es nicht besser wissen, nichts anderes gelernt haben und annehmen, dass was alle ständig wiederholen, müsse wohl richtig sein (auch wenn sie es selbst «nicht ganz durchschauen"). Nicht zuletzt aber:
"Es ist schwierig für einen Menschen etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, es (gerade) nicht zu verstehen.» – Upton Sinclair
Also aufhören mit Lärmen ("Geldschwemme», «Gelddrucken», «Schuldenberge», «Sparen") – alles leere/unverstandene Worthülsen. Vontobels Text lesen, nochmals lesen, bis er – in all seinen Zusammenhängen und Konsequenzen – vollumfänglich erfasst ist!
Vontobel ist zu pessimistisch. Wie bei Pest / Cholera ist auch bei Ökonomie / Ökologie nicht «oder» sondern «UND» zu verwenden. Deren Verknüpfung ist jeweils eng: Hygienische/sanitäre Massnahmen & eine medizinische Grundversorgung bringen beide, Pest und Cholera, zum Verschwinden.
Dasselbe gilt bei ‚Ökonomie und Ökologie‘: Als «hygienische Massnahme» sind – durch gemeinschaftliche Beschlüsse (man nennt’s auch: «Demokratie"/"Staat") – jene Konsumgüter (bzw. Lebensstile) zu fördern, die eine Verbesserung betreffend Ökologie bringen. Eine Förderung erfolgt gerade auch dadurch, dass den umweltschädlichen Gütern/Lebensstilen auch jene Kosten auferlegt werden, die sie bei anderen Personen auslösen.
Unsere Wahl ist nur: Dumm stellen und die Hälfte unserer Arbeitszeit beim Aufräumen (& Bezahlen) der angerichteten Schäden verbringen. Im Katastrophen-/Entsorgungs- und Vorsorgebereich, in den Spitälern, Gefängnissen usw. – oder gleich von Beginn an solche Produkte & Lebensstile (bzgl. Verkehr, Raumplanung, Städtebau, Freizeit, Bildung) erstellen bzw. fördern, die zwar höhere direkte (sichtbare!) Kosten aufweisen, aber dies gerade dann nicht mehr tun, wenn eine Gesamtkostenrechnung erstellt wird (also unter Einschluss alle Folgekosten, der sog. «Externalitäten» – ein Begriff der geistigen Vernebelung bzw. Verantwortungslosigkeit).
Höhere Unternehmenssteuern somit für nachhaltige Raumplanung/Lebensstile, höhere Löhne nicht für Mehrkonsum/Obsoleszenz sondern nachhaltige Produkte …
Mir fehlt in diesem Artikel der Aspekt der Wechselkurse. Gerade die SNB richtet die Geldpolitik ja in bedeutendem Masse darauf aus, den Franken nicht allzu stark werden zu lassen (die Tendenz des Frankens, gegenüber anderen Währungen stetig aufzuwerten, hat natürlich auch mit den Leistungsbilanzüberschüssen zu tun).
Es wird auch nicht so klar erwähnt, dass viele andere Staaten massive Schulden aufgehäuft haben.
Aber die Grundproblematik ist schon klar: Zu viel Geld sammelt sich bei zu wenigen Unternehmen und Einzelpersonen.
P.S.: Wenn man die fremden Devisen einfach mit selbstgedrucktem Geld kaufen kann, sind 15 Milliarden Verlust darauf nicht so schlimm 😉
Danke für den ausgezeichneten Beitrag, ich setze mir einen Link.
Folgendes Zahnrad kann man an den im Artikel beschriebenen Mechanismus anbauen: Wenn wir davon ausgehen, dass auch beim Kreditgeschäft Angebot und Nachfrage spielen, so ergibt sich Folgendes:
Anleger – auch Pensionskassen – bekommen von den Banken (und diese von den Nationalbanken) keinen Zins und müssen sogar Negativzins zahlen. Folglich wird es uninteressant, Obligationen zu kaufen, Darlehen zu vergeben oder das Guthaben gar auf dem Konto zu lassen. Also suchen die Anleger andere Anlagemöglichkeiten. Dabei können sie nur in immer fragwürdigere Projekte investieren:
◦ Immobilien an guter Lage zu überhöhten Preisen,
◦ Mietwohnungen in der Pampa ohne Nachfrage,
◦ Obligationen von Schuldnern mit geringerer Bonität,
◦ Aktien, deren Kurse teilweise unverhältnismässig hoch sind,
◦ immer heiklere Finanzkonstrukte, Derivate und dergleichen, deren Risiken immer weniger Leute verstehen etc. Ein Beispiel: Noch nicht einmal die ETF sind richtig verstanden: die ETFs auf Aktien und die Aktien in den ETFs sind unterschiedlich liquid, was noch dadurch verstärkt wird, dass die Fondsgesellschaften dieselben Aktien für Baisse-Spekulationen verleihen. Unterschiedliche Liquiditäten ziehen bei Marktturbulenzen zwangsläufig Liquiditätsengpässe nach sich.
Zum Einwand von Brigitte Illmer: Höhere Löhne führen deshalb insgesamt zu mehr Ersparnisse, weil die Lohnempfänger einen grossen Teil ihres höheren Lohns konsumieren und nicht sparen. Im Idealfall sparen die Haushalte genau so viel, wie die Unternehmen und der Staat an Fremdfinanzierung benötigen, um ihre Investitionen finanzieren zu können. Das war einst – in etwa – üblich. Auf der Zeitachse läuft das so, dass die Aktiven Vermögen aufbauen – indem sie die realen Investitionen finanzieren – und dieses Vermögen dann als Pensionäre verzehren, bzw. im Tausch gegen Konsum und Pflegeleistungen an die Aktiven abtreten. Es gibt aber keinen direkten Zusammenhang zwischen der realen Kapitalstock und den Ersparnissen, die wir bei voller Kapitaldeckung zur Finanzierung der Renten brauchen. Deshalb muss die Rente überwiegend im Umlageverfahren finanziert werden.
Es tut mir leid, aber den Satz: «Höhere Löhne führen deshalb insgesamt zu mehr Ersparnisse, weil die Lohnempfänger einen grossen Teil ihres höheren Lohns konsumieren und nicht sparen» in Ihrer Antwort verstehe ich nicht. Wieso soll es zu höheren Ersparnissen führen, dass die Leute nicht sparen?
Meine Frage war, worauf sich der Optimismus gründet, dass eine Umlenkung der Unternehmensüberschüsse in Löhne zu mehr Konsum führen wird. Und nicht zu immer mehr Sparen. Ob die Anweisungen auf verschobene Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum im Umlageverfahren eingelöst wird oder irgendwie anders, ist dafür egal.