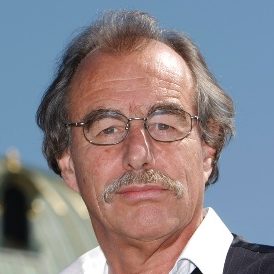Kommentar
Hilfloses Vorgehen gegen Fasnachts-Narren
Dass das Dorf Egerkingen sich während der Fasnacht stets unverschämt in «Negerchinge» umtaufe, verstosse wohl nicht gegen die Anti-Rassismus-Strafnorm, sagte Martine Brunschwig-Graf der «NZZ am Sonntag» am 17. März. Denn: «Man hält einfach eine alte Tradition aufrecht.» Der Artikel stand unter dem Titel: «Rassismus-Kommission knöpft sich Fasnacht vor.»
«Negerchinge» geht – Ku-Klux-Klan eher nicht
Die ehemalige Genfer FDP-Nationalrätin muss es wissen: Sie präsidiert die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR). Diese befasst sich nun auch mit jenen Narren, die anonym hinter ihren Masken an der Fasnacht landauf landab politisch unkorrekt bis rassistisch aufgetreten sein sollen (siehe Infosperber vom 19. März 2019). Konkret: «Mit den Symbolen die an den Umzügen gezeigt werden», wie Brunschwig Graf präzisiert. Weniger korrekt als die «Negerchinger» Narren hätten sich dabei etwa jene Schwyzer verhalten, die als Mitglieder des Ku-Klux-Klans verkleidet aufmarschiert seien, hält die EKR-Präsidentin fest: «Dieses Verhalten geht definitiv zu weit.»

Martine Brunschwig-Graf: «Ku-Klux-Klan geht zu weit» (Foto: wikipedia)
Denn: Da stecke wohl «rassistisches Gedankengut» unter den weissen Zipfelhauben – wohingegen in Egerkingen «wahrscheinlich nicht».
Strafverfolgungen von Fall zu Fall
Gegen die Schwyzer Ku-Klux-Klan-Narren, bei denen es sich um Neo-Nazis handeln soll, wurde denn auch ein Verfahren eingeleitet. Strafrechtliche Ermittlungen auch gegen einzelne Fasnächtler und Cliquen in Basel, wie jetzt bekannt wurde. Nicht aber gegen die im Infosperber erwähnten «Alte Stainlemer». Und auch nicht gegen die «Bebbi», die als uniformierte Kolonialisten durch Basel zogen – und eine Horde «Wilde» in Käfigen hinter sich herzogen.
Das wirft Fragen auf. Der 1865 in den Südstaaten der USA gegründete Klan ist eine geheime, gewalttätige und rassistische Vereinigung. Sie hat Tausende (vorab schwarze) Opfer ihrer Lynch-Justiz auf dem Gewissen. Verhöhnt ein Narr diese Opfer, wenn er an der Fasnacht als «Klansman» auftritt? Und wenn ja: Was ist dann mit den uniformierten Fasnachts-Kolonialisten, die eine nicht minder rassistische und gewalttätige Bewegung (mit Millionen ermordeter und versklavter Opfer) zeigen? Oder mit einem Fasnächtler, der als Mafioso verkleidet eine gleichermassen verbotene, wie gewalttätige Geheimorganisation repräsentieren würde.
An der Fasnacht mehr erlaubt – aber was denn?
Brunschwig Graf kennt diese Problematik: Auch sie räumt ein, an der Fasnacht gälten halt «andere Codes als während des Rests des Jahres». Sie droht dennoch: «Das heisst aber nicht, dass alles erlaubt ist.»
Nur: Was ist denn erlaubt? Offenbar die Clique «Negro Rhygass» und die Guggenmusik «Mohrekopf». Wie eben auch «Negerchinge». Oder im Wallis der Fasnachtsverein «Türkenbund», dessen Mitglieder alljährlich als Osmanen verkleidet auftreten.
Neue Gesetze nötig?
Dabei wurde anderenorts auch schon interveniert, wenn Fasnächtler als Indianer mit Federschmuck oder als Ölscheichs in weissen Nachthemden auftraten. Kurzum: Es herrscht viel Unklarheit und Willkür. Das hindert den Zürcher SP-Nationalrat Angelo Barrile nicht daran, jetzt vom Bundesrat per Motion einmal mehr ein Gesetz zum Verbot rassistischer oder gewaltverherrlichender Gesten, Symbole und Propagandamittel im öffentlichen Raum zu fordern.
Um die Lage zu erkunden hat Barrile, der auf die Klan-Kapuzen an der Fasnacht verweist, auch schon eine entsprechende Fragestunde-Frage an die Landesregierung gerichtet. Doch diese winkte eher ab: Die ganze Problematik sei doch schon von 2009 bis 2011 im Bundeshaus eingehend diskutiert worden. Aber schon damals sei bald mal klar geworden, «dass es nicht möglich ist, hinreichend präzise zu definieren, was strafbar sei und was nicht». Die geltenden Gesetze (etwa gegen öffentlichen Aufruf zu Gewalttaten, Anm. d. Red.) reichten zudem aus.
Dummheit und Bosheit lassen sich nicht verbieten
Die Debatte vor zehn Jahren drehte sich konkret darum, ob nur das Hakenkreuz oder auch Hammer-und-Sichel, ob nur der Hitlergruss oder auch die erhobene linke Faust der Revolutionäre verboten werden sollten. Oder: Müsste die Zahl 88 (unter Neonazis der Code für «Heil Hitler») ebenso aus dem öffentlichen Raum verbannt werden, wie in gewissen Hotels die Zimmerzahl 13 (wegen Aberglauben) nicht existiert? Und wenn ja: Was ist denn mit dem tausendfach öffentlich zur Schau gestellten «HH»-Zeichen auf Helly-Hansen-Jacken?
Solche Fragen zeigten damals rasch, dass sich die Symbol-Problematik gleichermassen unfassbar, wie ausufernd auf instabilem Gelände präsentiert. Und es setzte sich die Erkenntnis durch, dass sich weder Dummheit noch Bosheit verbieten lassen: Der Depp, der sich ein Hakenkreuz tätowieren lässt, oder hinten auf sein Auto klebt, wird nicht gescheiter, wenn ein Gesetz ihm dies verbietet. Das Böse verschwindet eben nicht dadurch, dass seine Anzeichen aus dem öffentlichen Raum verbannt werden. In concreto, «Klansmen» oder Kolonialisten in Uniform nach der Fasnacht polizeilich zu verfolgen bewirkt meist nur eines: Mehr Publizität für Dummheit und Bosheit.
Korrektere Sprache – statt gerechtere Realität
Die Diskussionen um erlaubte oder verbotene Symbole an der Fasnacht erinnert stark an die end- und oft fruchtlosen Debatten um korrekte oder weniger korrekte Sprache – und überlappt sich mit diesen teils. So ist es zwar korrekt, Frauen nicht mehr als «Fräulein» zu deklassieren (Fragt ein Franzose, dem sich eine Französin vorstellt: «C’est madame ou mademoiselle?» Darauf sie: «Et vous, c’est homme ou omelette?»). Aber oft halt auch in jedem Sinne billig: Die Anrede zu ändern kostet ja nichts. Wie es auch nichts kostet, «Neger» konsequent als Schwarze oder in den USA als «African American» zu bezeichnen.
Derlei Sprachkorrektur hindert vorgesetzte Männer jedoch nicht daran, zu «Frauen» beförderte Angestellte real weiterhin zu benachteiligen – und insbesondere schlechter zu bezahlen. Wie auch der Titel «African American» weisse Polizisten den USA noch kaum je daran gehindert hat, im Extremfall Schwarze zu misshandeln oder gar ungestraft zu erschiessen.
Schwule fielen nicht auf Sprach-Trick herein
Mehr noch: Die Korrektur der Sprache kann ein billiger Ersatz für die kostspielige Beseitigung ungerechter Verhältnisse sein. Putzfrauen heissen heute meist Raumpflegerinnen oder gar Facility-Managerin. Anderen den Dreck wegputzen müssen sie aber weiterhin. Und sie verdienen immer noch massiv weniger, als der meist männliche Hauswart.
Eine Gruppe von lange Benachteiligten und gar Verfolgten hat den Trick mit der billigen Sprach-Korrektur schnell durchschaut: Die Lesben und Schwulen. Auch aus ihnen wollten gut Meinende politisch korrekt «Homosexuelle» oder «Gleichgeschlechtliche» machen. Die Schwulen jedoch winkten ab: «Wir sind Schwule, sind stolz darauf und bleiben Schwule. Aber wir wollen endlich gleich und mit Respekt behandelt werden!».
Bessere Welt durch Kontrolle der Sprache?
Der linke Berliner Dramaturg Bernd Stegemann (zuvor Schaubühne, jetzt Berliner Ensemble) analysiert diese Problematik in seinem neuen Buch «Die Moralfalle» eingehend. Und erklärt sie in einem interessanten Interview im «Spiegel» (Nr. 13 / 2019).
Es gebe leider auch in der linken politischen Szene immer mehr Leute, «die meinen, man könne über die Kontrolle der Sprache zu einer besseren Welt kommen», sagt Stegemann. Dieser moralisch-idealistische Ansatz leiste für eine linke Politik jedoch

Bernd Stegemann: «Zuerst das Fressen, dann sie Moral.» (Foto: Deutschlandfunk)
nichts, ist er überzeugt: «Die klügere Linke hat schon immer gesagt: Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Die weniger kluge Linke verlässt sich auf Moral als Mittel der Erpressung.» Konzentration der Politik auf korrekte Sprache führe nur zu nebensächlichen Luxusproblemen, weg von den realen Ungerechtigkeiten und in die Isolation, warnt Stegemann. Denn: «Man muss es sich leisten können, sich über die Feinheiten der gendergerechten Sprache den Kopf zu zerbrechen», sagt er. «Wer bei Amazon im Lager arbeitet, der interessiert sich eher für gerechte Bezahlung.» Das wisse «die klügere Linke» und stelle lieber konsequent «die Frag nach den Eigentums- und damit den eigentlichen Machtverhältnissen».
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine