Kommentar
Erbschaftssteuer: Abstimmungskampf mit falscher Debatte
Eigentlich hätte es im Abstimmungskampf um die Erbschaftssteuer-Initiative der Juso um soziale und ökologische Nachhaltigkeit gehen müssen. Wie finanzieren wir die für den Schutz der Umwelt nötigen Ausgaben? Was bedeutet es für unsere Demokratie, wenn sich die Einkommen und Vermögen immer mehr konzentrieren und das reichste Prozent aller Steuerpflichtigen inzwischen fast die Hälfte aller Vermögen besitzt? Wie können wir diese Entwicklung am besten steuern? Stattdessen ist es den Gegnern der Vorlage gelungen, die Debatte in ganz andere Bahnen zu lenken: Bricht die Juso-Steuer das Rückgrat unserer KMU?
Zu diesem Zweck wurde der Eindruck erweckt, als sei ein beträchtlicher Teil der zu besteuernden Erbmasse in kleine und mittelgrosse Unternehmen investiert. Diese – so die These – würden durch die Erbschaftssteuer finanziell so stark geschwächt, dass sie den Betrieb nicht weiterführen und ins Ausland verkauft werden müssten. Das wiederum würde zum Verlust von vielen Jobs führen.
Ist da etwas dran? Schauen wir uns die Zahlen einmal genauer an.
5930 Milliarden Franken. So gross war Ende 2024 laut Nationalbank das Vermögen der Schweizer Haushalte. Davon entfielen 2800 Milliarden auf Immobilien und 1760 Milliarden auf kollektive Anlagen inklusive Pensionskassen, 100 Milliarden auf Obligationen und «nur» gut 400 Milliarden auf Aktien und Beteiligungen an Unternehmen. Dazu zählen auch alle von Inländern gehaltenen Aktien von Schweizer Grossunternehmen. Für massgebliche Anteile an mittelgrossen Unternehmen dürften maximal noch 100 Milliarden bleiben, vermutlich aber noch deutlich weniger.
Gehen wir die Sache noch von einer anderen Seite an: Der ganze, in Unternehmen investierte reale Kapitalstock der Schweiz beläuft sich auf gut 500 Milliarden Franken. Davon entfallen rund 220 Milliarden auf Hoch- und Tiefbauten (laut «bauenschweiz.ch» 17% aller Hoch- und Tiefbauten im Wert von 1300 Milliarden Franken). Dazu kommen rund 300 Milliarden für Ausrüstungen, Maschinen, Knowhow, Elektronik und kommerziell genutzte Autos. Das ergibt ein Total von gut 500 Milliarden Franken produktives Kapital, das von Unternehmen (aller Art) investiert und genutzt wird.
Davon dürfte gut die Hälfte auf die kapitalintensiven Grossunternehmen entfallen. (Allein Roche hat ein Betriebsvermögen von 52 Milliarden Franken, das aber nur zum Teil in der Schweiz investiert ist.) Für den Rest, also die KMU, blieben dann noch 250 Milliarden Franken, wobei man wissen muss, bzw. dank KI erfahren kann, dass unsere KMU im Schnitt zu 70 Prozent fremdfinanziert sind. Von den 250 Milliarden investiertem Kapital blieben demnach noch rund 75 Milliarden besteuerbares Eigenkapital übrig. Auch auf diese Weise kommen wir auf eine Grössenordnung von bloss gut einem Prozent des potentiell vererbbaren Gesamtvermögens aller Schweizer Haushalte von fast 6000 Milliarden.
Beim grossen Rest handelt es sich entweder um reines Finanzvermögen, oder um Immobilien, die übrigens pro Jahr rund 80 Milliarden an Wert gewinnen. Auch die reinen Finanzvermögen werfen jährlich gut 80 Milliarden Rendite ab. Von «hart erarbeiteten» Vermögen, kann also kaum die Rede sein, erst recht nicht aus Sicht der Erben. In unserem Zusammenhang geht es aber nicht um Gerechtigkeit und Moral, sondern darum, dass es keinen rein volkswirtschaftlichen Grund gibt, der gegen eine höhere Besteuerung dieser Erbschaften spricht. Dazu geht es schlicht um zu wenig Geld.
Die von den Juso vorgeschlagene Variante würde nur die paar Dutzend privat gehaltenen Unternehmen treffen, deren Eigenkapital pro Eigentümer, bzw. Erblasser, 50 Millionen Franken übersteigt. Und wer solche Betriebsvermögen anhäufen kann, verfügt in der Regel noch über ein Mehrfaches an Finanz- und Immobilienvermögen, das die Erben leicht versilbern können, ohne Griff in die Kasse des geerbten Unternehmens. Siehe etwa die Familie Spuhler und ihre Stadler Rail. Die Befürchtung, dass eine (oder diese) Erbschaftssteuer die produzierende Wirtschaft in Finanzierungsnöte bringen könnte, ist also sehr weit hergeholt
Wie also kommt es dazu, dass dieser unwahrscheinliche Nebeneffekt die ganze Debatte dominiert, bei der es eigentlich um viel wichtigere Probleme gehen müsste? Liegt es vielleicht daran, dass es einen engen Zusammenhang zwischen finanzieller und medialer Macht gibt? Demokratie sollte eigentlich damit anfangen, dass wir die richtigen Debatten führen.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





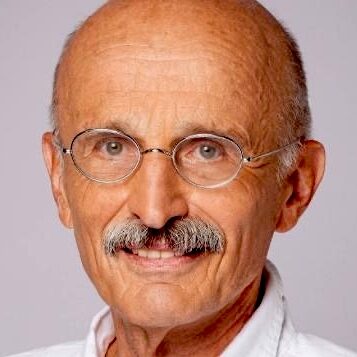




Vielen Dank für die aufschlussreichen Zahlen. Es ist mir ein Rätsel wie immer wieder mit falschen Argumenten Abstimmungen gewonnen werden. Sind wir noch eine Demokratie? Oder eher eine Geld-Diktatur?
Ich denke die Schweiz – wie die übrigen Länder der EU – sind eine Plutokratie, indenen es sich mit Geld -Geld – Geld, nicht nur gut leben lässt, auch das Ansehen der Person steigt mit seinem Bankkonto. Daran sind wir auch selbst schuld, da wir Menschen mit Geld hofieren, ihnen die Wünsche vorauseilend erfüllen und uns bis zu einem gewissen Grad devot verhalten. Daraus resultiert dann eine Steuergesetzgebung die aus Angst vor Fluchtgled – und/oder fliehenden Plutokraten/Oligarchen im vorauseilenden Gehorsam, alles vermeidet, was diese Gruppe beleidigen könnte. Also – mehr Zivilcourage – auch in der Schweiz. Ein bekannter Schwiezer sagte einmal: «wenn ein Schwiezer Bankier aus dem Fenster springt, spring ruhig nach, da gibt es etwas zu verdienen. (Wer war das wohl?)
Vielen Dank für die fundiert Klarstellung. Man wird bei dieser Abstimmung sehr gut sehen können, wieviele Stimmberechtigte sich von der Propaganda der Mainstream-Medien an der Nase herum führen lassen. Sie haben zum Erfolg dieser Unterschriftensammlung beigetragen, denn es gab und gibt darin kaum einen Beitrag über die Vorteile einer Erbschaftssteuer. Und das ist nicht das einzige Thema, das einseitig abgehandelt wird.