Hunderte Schulbesuche: Digitalcoach fordert Smartphone-Verbot
psi. Dieser Beitrag erschien auf netzpolitik.org (Creative Commons-Lizenz BY-NC-SA 4.0). Das Non-Profit-Medium wird hauptsächlich durch Leserspenden finanziert.
_____________________
Kinder waren wir alle mal, auch wenn nicht alle eine digitale Kindheit hatten. Daran erinnert Autor Daniel Wolff die Leser*innen seines Buchs immer wieder, und er appelliert direkt an ihr Einfühlungsvermögen. «Stellen Sie sich bitte für einen Moment kurz vor, Sie wären heute noch mal jung», schreibt er. «Würden Sie nicht auch versucht sein, unendlich viel Spass und Anerkennung auf Social-Media-Plattformen zu suchen (und zu finden), die drei Viertel Ihrer Freunde täglich und nächtlich permanent nutzen?»
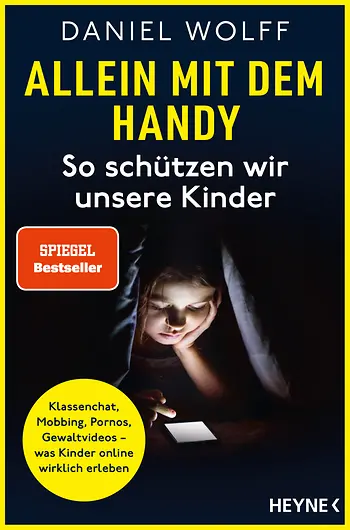
Das Zitat ist ein gutes Beispiel für die besondere Perspektive des Buchs. Als Digitaltrainer ist Wolff durch Hunderte Schulen gereist, darunter Grundschulen und weiterführende Schulen. Er hat mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Lehrer*innen gesprochen. Anschaulich gibt er wieder, wie Kinder etwa über Grusel-Videos oder aufdringliche Pädokriminelle erzählen. Über verlockende Smartphone-Spiele, die einem förmlich das Geld aus der Tasche ziehen; und über Tricks, um heimlich mit dem Handy im Bett die Nacht durchzumachen.
Die Wirren der Digitalgesetzgebung kümmern ihn ebenso wenig wie akademische Forschungsdesigns. «Ich bin kein Wissenschaftler, sondern Pragmatiker», schreibt Wolff, und das merkt man seinem Buch an. Er teilt seine Erfahrungen aus dem direkten Austausch mit vielen Kindern und Eltern, und füllt damit eine wichtige Lücke in der Debatte um Jugendmedienschutz.
Sein Buch zeigt, wie die Mühen von Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden oftmals weit entfernt von dem sind, was Kinder und Eltern in ihrem Alltag beschäftigt. Während Politiker*innen weltweit vor allem auf technische Lösungen hoffen, macht Wolff mit Nachdruck klar: Ohne intensive Anstrengungen von Eltern wird das nichts.
Einerseits kommt diese Rezension spät, denn das Buch ist bereits 2024 erschienen. Zugleich könnte sie kaum aktueller sein, denn Anfang September hat das deutsche Familienministerium eine neue Expert*innen-Kommission einberufen. Ein Jahr lang soll sie Empfehlungen entwickeln, um Kinder und Jugendliche im Netz besser zu schützen. Dabei sollen Fachleute aus mehreren Disziplinen zusammenkommen.
Auch diese Rezension will Verknüpfungen herstellen. Sie rückt acht im Buch besprochene Probleme in den Mittelpunkt und stellt die Frage: Was lässt sich daraus netzpolitisch lernen?
- 1. Smartphones fressen Schlafenszeit
- 2. Messenger-Gruppen mit Kindern explodieren
- 3. Kinder testen mit Gewalt und Horror ihre Grenzen
- 4. Wo «für Kinder» draufsteht, ist nicht «für Kinder» drin
- 5. Die Sogwirkung optimierter Feeds ist unwiderstehlich
- 6. Handy-Spiele nutzen alle Tricks, um an Taschengeld zu kommen
- 7. Kinder haben Angst vor der Reaktion ihrer Eltern
- 8. Digitale Medienerziehung ist harte Arbeit
- Und jetzt? Ein Ausblick
1. Smartphones fressen Schlafenszeit
🚧 Das Problem: Auf seiner Tour durch deutsche Schulen ist Digitaltrainer Wolff vielen auffällig müden Kindern begegnet. Er beschreibt ihre Augenringe, teils schon in dritten Klassen. Lehrkräfte und Eltern würden von «zunehmend unausgeschlafenen, fahrigen und/oder aggressiven Kindern» berichten. Der mutmassliche Grund: Mehr als die Hälfte der deutschen Kinder von 6 bis 13 Jahren würden ein Smartphone mit ins Bett nehmen.
«Vielen Eltern scheint nicht einmal im Ansatz klar zu sein, dass Kinder ein Gerät mit einem extrem hohen Aufforderungscharakter wie ein modernes Smartphone, das sich in ihrem Schlafzimmer befindet, tatsächlich nachts auch nutzen!», schreibt Wolff. Kinder und Jugendlichen ein Smartphone mit ins Bett zu geben sei die mit Abstand «schädlichste Idee» der Elterngeneration. In fast jeder Grundschule hätten bereits einzelne Kinder die Nacht vor einem neuen Schultag im Internet durchgemacht.
Wolffs Fazit:
«Mit einer einzigen konzertierten Massnahme könnten wir mit einem Schlag in kürzester Zeit den Bildungsstandard und alle schulischen Leistungen in ganz Deutschland positiver beeinflussen als mit allen milliardenschweren Schulreformen zusammen: KEIN SMARTPHONE INS KINDERBETT! Ausgeschlafene Kinder sind fröhlicher, konzentrierter, friedfertiger, freundlicher – und leistungsfähiger!»
Damit das funktioniert, empfiehlt der Digitaltrainer, dass die ganze Familie mitmacht. «Keiner in der Familie nutzt abends nach dem Zähneputzen noch digitale Geräte – und morgens vor dem Zähneputzen auch nicht!» Die Handys könnten in dieser Zeit etwa in ein Familienladegerät kommen, das an einem zentralen Punkt in der Wohnung steht.
🧭 Die netzpolitische Perspektive: Aktuell kreist die Debatte in Politik und Nachrichtenmedien vor allem um Handys in der Schule und um soziale Medien. Es geht um Gesetze und Kontrollen. Wie eine Familie nachts mit ihren Handys umgeht, hat damit zunächst wenig zu tun. Das Beispiel zeigt aber: Jugendmedienschutz wird mit Gesetzen und Schulverboten allein nicht funktionieren. Man muss alles in den Blick nehmen, was Kinder mit ihren Handys machen. Wenn es um Schlafmangel geht, ist auch die Debatte um einen späteren Schulbeginn relevant, der einem gesunden Schlafrhythmus näher käme.
2. Messenger-Gruppen mit Kindern explodieren
🚧 Das Problem: Schon wenn die Schüler*innen einer Klasse nur miteinander einen Messenger nutzen, ist Jugendmedienschutz gefragt. Wolff berichtet von sprudelnden Nachrichten im Klassenchat, oftmals Sticker und Emojis. Hunderte Nachrichten pro Tag in fünften und sechsten Klassen, Tausende in siebten und achten Klassen, auch in der Nacht. «Selbst wenn wir Erwachsenen eine solche Nachrichtenflut innerhalb weniger Stunden nicht kennen – tut es so gut wie jeder Siebtklässler!», schreibt Wolff.
Der meistgenutzte Messenger sei Whats-App. «Ich habe noch keine Schule kennengelernt, bei der die Klassenchats am Ende nicht doch im Wesentlichen über Whats-App gelaufen sind», schreibt Wolff. Durch Klassenchats entstehe ein «nie endender 24-Stunden-Schultag». Ab dem ersten Klassenchat werde WhatsApp «gefühlt sozial so unverzichtbar, dass nahezu alle Kinder unbedingt ein Smartphone haben wollen. Aus ihrer Sicht: müssen.»
Die Beschreibungen des Digitaltrainers zeigen: Klassenchats sind wie ein belebter Schulhof, aber die Grosse Pause auf diesem virtuellen Hof dauert den ganzen Tag. Und es sind meist keine Erwachsenen in Sicht. «Meiner ganz persönlichen, sehr groben Einschätzung nach findet etwa 70 Prozent des Cybermobbings an deutschen Schulen auf Whats-App statt», warnt Wolff. Die letzten, die davon etwas mitbekämen, seien oft die Eltern.
Er rät deshalb zum engen Kontakt zwischen Eltern und Kindern, und zwar von Anfang an. «Erlauben Sie Ihrem Kind Whats-App nur, wenn Sie bei Bedarf mitlesen dürfen», schreibt er. Zum Beispiel könne man sagen: «Ich werde das nicht tun, um dich zu kontrollieren, sondern um dich zu schützen, weil ich als dein Elternteil auch im Internet verantwortlich für dich bin, solange du noch ein Kind bist. Ich werde dir aber immer vorher Bescheid sagen, immer mit dir gemeinsam reinsehen – und niemals alleine.»
Das hätte sogar einen Effekt auf den ganzen Klassenchat. «Wenn in einer Klasse bekannt ist, dass es Eltern gibt, die ab und zu mal in den Klassenchat reinsehen, tauchen wundersamerweise von vornherein weder brutale Sachen dort auf – noch gruselige, eklige, nackige oder politisch zweifelhafte!», schreibt Wolff.
🧭 Die netzpolitische Perspektive: Die politische und mediale Debatte um Jugendmedienschutz beschreibt oftmals Gefahren von Aussen, etwa durch schädliche Inhalte oder Kontaktaufnahme durch Fremde. Die damit verbundene Hoffnung ist, dass sich die meisten Gefahren durch Abschottung der Kinder mit technischen Mitteln abwenden lässt.
Dabei geriet zuletzt in den Hintergrund, was Kinder und Jugendliche erleben, wenn sie schlicht untereinander online kommunizieren. Wie der genutzte Messenger heisst oder welche Altersfreigabe er hat, ist dafür zweitrangig. Für dieses konkrete Szenario sind vor allem Eltern oder Aufsichtspersonen gefragt.
3. Kinder testen mit Gewalt und Horror ihre Grenzen
🚧 Das Problem: Ob aus Neugier oder Gruppendruck, als Mutprobe oder durch den Reiz des Verbotenen – Kinder suchen und finden mit dem Smartphone Inhalte für Erwachsene, etwa Horror und Grusel. «Gewaltdarstellungen sind auf Kinder-Smartphones unvermeidbar», hält Digitaltrainer Wolff fest. Er schreibt: «In den 3. und 4. Klassen heben bei der Frage: ‹Habt ihr schon einmal etwas so Grausames, Blutiges oder Brutales gesehen, dass ihr nicht mehr schlafen konntet?›, fast immer alle Kinder, die bereits ein eigenes Smartphone besitzen, die Hand.»
Wer danach sucht, finde solche Videos auch auf Youtube und Tiktok. Hinzu kommen Websites mit Sitz im Ausland, die gezielt verstörende Inhalte verbreiten. «Kinder, die Whats-App auch in grösseren Gruppen wie Klassenchats nutzen, können jederzeit Links für extrem brutale, grausame oder gruselige Videos geschickt bekommen», warnt Wolff.
Der Digitaltrainer empfiehlt etwa Youtube nur in Hörweite der Eltern zu schauen. Allerdings rät Wolff auch: «Bereiten Sie Ihr Kind auf das Unvermeidliche vor». Eltern sollten vorher über die vielen «schlimmen» Sachen sprechen, die es gebe. «Dann ist Ihr Kind vorbereitet und weiss, dass Sie im Falle eines Falles ein kompetenter Ansprechpartner sind!»
🧭 Die netzpolitische Perspektive: In Politik und Nachrichtenmedien werden vor allem Massnahmen wie Filter und Alterskontrollen diskutiert. Sie sollen es Kindern schwerer machen, potenziell schädliche Inhalte zu finden. Dabei wird unterschätzt, wie gezielt Kinder solche Inhalte suchen, weil die Anreize dafür so stark sind, etwa Neugier und Gruppendruck. Deshalb muss Teil der Lösung sein, möglichst viele Kinder für das – wie Wolff es nennt – «Unvermeidbare» zu rüsten.
4. Wo «für Kinder» draufsteht, ist nicht «für Kinder» drin
🚧 Das Problem: Online-Angebote mit Labels wie «ab 0 Jahren» oder «ab 6 Jahren» sind trügerisch. So würden zunächst kinderfreundliche Spiele oftmals nicht kinderfreundliche Werbeclips anzeigen, schreibt Wolff, darunter rassistische Werbung. «Hunderttausende Spiele-Apps spülen täglich millionenfach minderwertigen Mist auf die Bildschirme unserer Kinder», kritisiert er.
Ein Knackpunkt ist die schiere Masse an Inhalten, wie aus dem Buch hervorgeht – und der mangelnde Wille, das angemessen zu prüfen. Zum Beispiel würden sogar auf einer dezidiert für Kinder vermarkteten Plattform wie Youtube Kids Inhalte landen, die nicht für Kinder geeignet sind. Das konnte netzpolitik.org mühelos bestätigen: Ein Zombie-Grusel-Video erschien über Empfehlungen auf Youtube Kids, selbst bei der niedrigsten Altersstufe bis vier Jahre.
Möglich ist so etwas, weil grosse Plattformen die Massen an neuen Inhalten oftmals nur flüchtig prüfen, etwa anhand von Stichworten, auch wenn Uploads als kindgerecht gekennzeichnet wurden. Das ist kein Vergleich zur sorgfältigen, händischen Kuratierung von Sendungen, die etwa im klassischen Kinderfernsehen zu sehen sind.
🧭 Die netzpolitische Perspektive: Schon jetzt gibt es Rechtsgrundlagen, die Plattformen zur Risikominderung für Minderjährige verpflichten, etwa das Gesetz über digitale Dienste (DSA). Das könnte etwa über Empfehlungssysteme oder Inhaltsmoderation passieren. Das Gesetz ist allerdings recht neu; die dazu gehörigen Aufsichtsbehörden nehmen erst langsam ihre Arbeit auf. Weil sorgfältiger Umgang mit hochgeladenen Inhalten teuer ist, dürften sich Online-Konzerne gegen alles wehren, das Geld kostet.
5. Die Sogwirkung optimierter Feeds ist unwiderstehlich
🚧 Das Problem: Werbefinanzierte Plattformen wie Tiktok, Instagram oder Youtube haben ein Interesse daran, die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer*innen zu binden. Mehr Nutzungszeit bedeutet mehr Werbung und mehr Geld. Inhalte, Features, Oberflächen und Algorithmen werden dahingehend optimiert. Digitaltrainer Wolff vergleicht etwa Tiktok mit einem «Trommelfeuer der Sensationen».
Mit Blick auf Youtube schreibt der Autor: «Stellen Sie sich aus Kindersicht einen Bildschirm mit einer Million Programmen vor, auf dem ganz einfach immer was Spannendes und Lustiges läuft! Und das Beste: Man kann diesen Bildschirm auch noch in die Hose stecken und dann heimlich auf dem Klo oder im Bett weitergucken!»
Umso stärker sind die Anreize für Kinder und Jugendliche, das Gerät möglichst intensiv zu nutzen. Eltern rät Wolff: «Schaffen Sie Alternativen für Ihr Kind!», also Aktivitäten, bei denen digitale Geräte stören.
🧭 Die netzpolitische Perspektive: Die enorme Sogwirkung algorithmisch sortierter Feeds hat die EU-Kommission bereits auf dem Schirm, etwa in den Leitlinien zum Schutz von Minderjährigen auf Basis des Gesetzes über digitale Dienste (DSA). Demnach müssen Dienste Massnahmen ergreifen, um Risiken zu mindern, zum Beispiel: kein unendliches Scrollen in einem Feed; keine Push-Benachrichtigungen, entschärfte Empfehlungssysteme. Auch in diesem Fall sind also Werkzeuge für Aufsichtsbehörden vorhanden, aber die Durchsetzung rollt erst an. Tech-Konzerne werden ihre finanziellen Interessen schützen wollen und sich dagegen wehren.
Die EU-Kommission sieht den Widerstand kommen. «Wenn es um die Sicherheit unserer Kinder im Internet geht, glaubt Europa an Eltern, nicht an Gewinne», behauptete jüngst Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) in ihrer Rede zur Lage der Union, in der sie vor allem Alterskontrollen befürwortete. In anderen Bereichen wie Datenschutz oder KI-Regulierung gibt es immer wieder Beispiele dafür, dass sich Lobby-Interessen am Ende doch durchsetzen.
6. Handy-Spiele nutzen alle Tricks, um an Taschengeld zu kommen
🚧 Das Problem: Begeisterte Kinder und Jugendliche lassen bei Anbietern von Smartphone-Spielen die Kassen klingeln. Per In-App-Kauf können Nutzer*innen zum Beispiel häufiger gewinnen oder seltene, virtuelle Gegenstände erwerben. Das ist für Kinder und Jugendliche nicht nur verlockend, weil es Spass macht, sondern auch, weil es soziale Anerkennung bringt. «Vor allem für die Jungs wird es sehr schnell sehr kompetitiv, weil alle anderen immer sehen können, wie viel und wie gut man in letzter Zeit so gespielt hat», schreibt Digitaltrainer Wolff.
«Wenn sie dürfen oder können, machen manche Kinder ihr Lieblingsspiel zum absoluten Lebensmittelpunkt», schreibt Wolff. «Es gibt dann nichts anderes mehr auf der Welt als Brawl Stars (sehr beliebt in den Klassen 3 bis 7) oder Fortnite (meist ab den 5. Klassen aufwärts).» Bereits Grundschulkinder würden Hunderte Euro für Smartphone-Games ausgeben.
Dabei würden Anbieter an allerlei Tricks nutzen, damit Kinder das Handy nicht mehr weglegen wollen und möglichst viel Geld ausgeben. Zum Beispiel Glücksspiel-ähnliche Lootboxen, also virtuelle Geschenkkartons, die man für echtes Geld kaufen muss. Meist ist nichts Interessantes drin, selten aber schon. Hinzu kommen manipulative Aufforderungen wie «Schnell dieses Special-Angebot kaufen: NUR HEUTE gibt es noch 45 Extra-Diamanten zum Preis von 10», schreibt Wolff.
Die Gaming-Branche ist inzwischen das grösste Segment der Unterhaltungsindustrie, noch vor Musik oder Filmen. Ein Teil der Einnahmen dürfte von Eltern kommen, die damit ihre Kinder glücklich machen wollen – oder einfach nur ruhigstellen. Wolff schlussfolgert:«Wir haben zugelassen, dass eine völlig unregulierte milliardenschwere Industrie mit allen Psycho-Tricks der Welt den Wunsch unserer Kinder nach Anerkennung industriell monetarisiert und täglich millionenfach aberntet – und haben noch nicht einmal begriffen, dass und wie das passiert.»
🧭 Die netzpolitische Perspektive: Abzocke und Manipulation durch Handy-Spiele ist in der öffentlichen Debatte um Jugendmedienschutz selten Thema. Dabei schadet das auch erwachsenen Gamer*innen. Mühen beispielsweise zur Regulierung von Lootboxen gibt es seit Jahren, allerdings mit wenig Erfolg. Zumindest im Gesetz über digitale Dienste (DSA) gibt es Ansätze, manipulative Designs bei Diensten einzudämmen.
Wie gross ist wohl der politische Wille, am Finanzierungsmodell einer Milliardenindustrie wie der Gaming-Branche zu rütteln? Eine Gelegenheit hätte die EU-Kommission: Mit dem geplanten Digital Fairness Act will sie Lücken im Online-Verbraucherschutz schliessen.
7. Kinder haben Angst vor der Reaktion ihrer Eltern
🚧 Das Problem: «Millionen Kinder der Welt verschweigen eisern, was ihnen online tags und nachts so begegnet», schreibt Digitaltrainer Wolff. «Die Eltern wiederum leben fröhlich vor sich hin und glauben, dass es bei der Internetnutzung ihrer Kinder keine wesentlichen Probleme gäbe».
Der Grund für das Schweigen ist Wolff zufolge simpel: Kinder wollen ihr Smartphone behalten. Sie befürchten, dass Eltern ihnen das Gerät wegnehmen, wenn sie erfahren, welche schlimmen Dinge damit passiert sind. Wegnehmen aber ist aus Sicht der Kinder und Jugendlichen «die gefühlt härteste Strafe im digitalen Zeitalter».
Wolff rückt hier etwas in den Mittelpunkt, das in Debatte um Jugendmedienschutz selten zur Sprache kommt: Vertrauen. «Denn nur wenn Ihr Kind Ihnen vertrauen kann, wird es sich eines Tages an Sie wenden – wenn es dagegen Angst vor Strafen oder Handy-Verbot hat, so gut wie nie», schreibt Wolff. Deshalb appelliert er eindringlich an Eltern: «Teilen Sie Ihrem Kind möglichst frühzeitig (am besten schon bei der Handy-Übergabe) mit, dass Sie ihm das Smartphone wegen Inhalten aus dem Internet nicht wegnehmen werden.»
🧭 Die netzpolitische Perspektive: Massnahmen zum Jugendmedienschutz werden oftmals mit Blick auf die verschiedenen Grundrechte von Kindern und Jugendlichen diskutiert, etwa den Schutz vor entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten, Teilhabe, Privatsphäre und Datenschutz. Kaum diskutiert wird aber, wie sich das Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und ihren Aufsichtspersonen bewahren und stärken lässt.
Relevant ist das gerade mit Blick auf das derzeit vieldiskutierte Social-Media-Verbot für Minderjährige. Ein solches Verbot könnte bewirken, dass Kinder die verbotenen Dienste heimlich weiternutzen – und entsprechend noch höhere Hürden sehen, sich bei Problemen vertrauensvoll an Erwachsene zu wenden. Immerhin müssten sie dann zugeben, dass sie etwas Verbotenes gemacht haben. Massnahmen zum Jugendmedienschutz müssten sich daran messen lassen, was sie für das Vertrauen zwischen Kindern und Eltern bedeuten.
8. Digitale Medienerziehung ist harte Arbeit
🚧 Das Problem: Es gibt keine einfache technische Lösung für Jugendmedienschutz. «Stellen Sie sich darauf ein, dass die Einhaltung von Medienzeiten eine Ihrer zentralen Erziehungsaufgaben in den nächsten Jahren sein wird», schreibt Digitaltrainer Wolff. «Es wird anstrengend, nervig und jeden Tag erneut ermüdend sein. Sie werden schreien, Ihr Kind wird weinen und/oder Sie hassen. Und es wird sich lohnen – alleine schon, weil es keine Alternative gibt!»
Zum Beispiel sollten sich Eltern ausführlich die Zeit für einen Mediennutzungsvertrag nehmen, bevor sie ihrem Kind ein Handy geben, rät Wolff. Vorlagen für dieses oftmals mehrseitige Dokument gibt es online. «Ja, einen Mediennutzungsvertrag auszuarbeiten ist aufwendig, mühsam und anstrengend», schreibt er. «Aber: Wenn Sie keine klaren Regeln haben, wird es in den nächsten Jahren garantiert noch aufwendiger, mühsamer und anstrengender!»
🧭 Die netzpolitische Perspektive: Weinende Kinder, die ihre schreienden Eltern hassen – solche Bilder zeichnen Politiker*innen nicht, wenn sie etwa Alterskontrollen fordern. Wer will sich schon gern sagen lassen, dass etwas «aufwendig, mühsam und anstrengend» wird? Stattdessen stehen technische Massnahmen im netzpolitischen Fokus, und zwar solche, die Sorgenfreiheit versprechen. Gegen sexualisierte Gewalt soll die Chatkontrolle helfen, also die Massenüberwachung vertraulicher Kommunikation. Gegen schädliche Inhalte sollen Alterskontrollen helfen, also das massenhafte Abfragen von Ausweisdaten und biometrischen Daten.
Aus dem Blick gerät dabei die zentrale Rolle von Eltern und Aufsichtspersonen. Hier fällt häufig das Argument, man könne den ohnehin überlasteten Eltern nicht noch mehr zumuten. Doch auch hier gibt es politische Ansätze. Wie viel möchte der Staat tun, um Eltern mehr Zeit und Energie für ihre Kinder zu gewähren – etwa durch mehr Kindergeld oder Regelungen für flexiblere Arbeitszeiten? Im Vergleich dazu sind Gesetze für mehr Überwachung und Kontrolle im Netz billig zu haben – und leider oft wertlos.
Und jetzt? Ein Ausblick
Auch Digitaltrainer Wolff nennt in seinem Buch konkrete, politische Ideen. «Was aus meiner Sicht alle Schulen baldmöglichst einführen sollten, ist ein ‹echtes› Smartphone-Verbot», schreibt er. Genau das wird gerade kontrovers diskutiert – unter anderem das Kinderhilfswerk und der Bundeselternrat sind gegen pauschale Verbote. Stattdessen sollten Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern gemeinsame Regeln entwickeln.
Weiter plädiert Wolff in seinem Buch für eine verpflichtende Altersverifikation bei Social-Media-Plattformen. Fachleute aus den Bereichen Kinderschutz und digitale Grundrechte sehen das allerdings kritisch. Die Kritik reicht von der Warnung, dass Alterskontrollen allenfalls ein Baustein sein können bis hin zur generellen Ablehnung. Ein Problem: Solche Kontrollsysteme stellen nur eine trügerische Sicherheit her; zugleich schaffen sie neue Gefahren für Minderjährige und für Erwachsene, die sich massenhaft online verifizieren müssten.
Schliesslich spricht sich Wolff für ein Schulfach «Digitalität» aus. Zu viele Eltern würden sich dem Thema Medienkompetenz verweigern; die Erziehungsaufgabe bliebe an den Schulen hängen. Einen Blick auf Schulen hat auch die Wissenschaftsakademie Leopoldina in einem aktuellen Diskussionspapier geworfen. Demnach fehle es nicht an Materialien, sondern an Fachpersonal, Zeit und Fortbildungsmöglichkeiten.
Die Suche nach netzpolitischen Lösungen ist ein Thema für sich. «Allein mit dem Handy» geht hier nicht in die Tiefe. Stattdessen überzeugt das Buch durch eine umfassende Problembeschreibung. Das gelingt, weil der Autor immer wieder die Perspektive einbringt, die er von den Kindern und Jugendlichen gelernt hat. Zum Beispiel, dass man auf das Thema Spass nie verzichten sollte: «Wenn Sie mit Kindern und/ oder Jugendlichen über Smartphones und das Internet sprechen und dabei nicht auch über Spass reden, hören sie Ihnen schon nach kürzester Zeit überhaupt nicht mehr zu!»
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine. Sebastian Meineck ist Journalist und seit 2021 Redakteur bei netzpolitik.org.
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.









Es wäre ein sinnvoller Standard, dass in Klassenchats (beispielsweise bis Ende der obligatorischen Schulzeit) immer die Eltern mit drin sind, natürlich nur passiv.
Da könnten die Kinder auch gleich lernen, dass für wirklich private Angelegenheiten ein Chat mit vielen Teilnehmern sowieso ein völlig falscher Kanal ist.
Herr Heierli
viel wichtiger wäre doch den Kindern beizubringen, dass man nicht immer und jederzeit mit dabei sein muss?
Die Kommunikation in Chats überfordert die Kinder komplett (bzw vermittelt ihnen etwas komplett falsches). Wer immer die Idee hatte diese Art der Kommunikation sei einfacher hat die Kinder dabei komplett aus dem Blick verloren.
Um eine Mailadresse zu kriegen muss ein Kind mindestens 13 Jahre alt sein. Handys sollen sie aber schon mit 6 haben?
Aus meiner Sicht ist es verantwortungslos Kindern derartige Geräte und eine derartige Kommunikation aufs Auge zu drücken, ohne ihnen zuerst das Basiswissen zu vermitteln (z.b. dass der Sinn eines Handys nicht ist, dauernd erreichbar zu sein sondern umgekehrt). Oder wie wichtig es ist, erst zu denken und dann zu handeln (was bei der ganzen Chatterei oft vergessen wird). DIe Menschheit kann leider mit den Tools nicht verantwortungsvoll umgehen und unsere Kinder schon gar nicht (wenn es ihnen nicht beigebracht wird).
Das natürlich auch!
Kinder sollten viel später ein eigenes Smartphone erhalten, erst dann, wenn sie eigentlich keine Kinder mehr sind.
Wenn es nur um die Erreichbarkeit geht, ist ein altes «Natel», das nur telefonieren und SMS kann, absolut ausreichend.