Kommentar
«Herablassende und polemische Kritik an wirksamer Behandlung»
Red. Peter Schwob ist seit 33 Jahren psychoanalytischer Psychotherapeut und war 20 Jahre Präsident des Basler PsychotherapeutInnen-Verbandes. Sein Artikel ist eine Erwiderung auf den Artikel «Die Schweiz, das Psycho-Paradies» des Psychotherapeuten Dietmar Luchmann.
REPLIK VON PETER SCHWOB
Dietmar Luchmann, selber Psychotherapeut, attackiert die Psychotherapie. Er argumentiert eng und herablassend, obwohl er sich doch seit Jahrzehnten damit befasst. Dabei schreibt er ja auch wahre Sätze. Es stimmt, nicht auf die Gesundheit hat man ein Recht, sondern auf Unterstützung auf dem Weg dahin; es stimmt, auf das aktive Engagement der Patientinnen kommt es an; es stimmt, nicht jede Psychotherapie läuft gut. Aber die Hauptbotschaft von Luchmanns Text ist eine Anmassung: Wenn alle das machen, was er macht, und wenn alle so denken, wie er denkt, dann ist die Krise der psychotherapeutischen Versorgung gelöst, dann sind Unterbezahlung, Therapieplatzmangel und Bürokratie kein Problem mehr. So ist es nicht.
Luchmann behauptet, fast alle psychischen Probleme in zehn Stunden zu lösen, indem er den Leuten das richtige Denken beibringt, krankmachende Denkfehler überwindet und leiderzeugende Denk- und Verhaltensmuster identifiziert und verändert. Dass das hilft, leuchtet mir ein – bei isolierten, eng umschriebenen Störungen zum Beispiel aufgrund von Überforderung, schädlichen Glaubenssätzen oder akuten äusseren Konflikten. Und dann kann man auch getrost nach ein paar Monaten eine Nachuntersuchung machen und feststellen: Problem gelöst. Dieses Problem.
Das sichtbare Symptom und das tieferliegende Problem
Denn ob das wirkliche Problem gelöst wurde, lässt sich so nicht überprüfen. Nicht einmal, ob Patient und Therapeutin das wirkliche Problem überhaupt erkannt haben. Jede Psychotherapie beginnt mit einem Leidensdruck, einem Symptom. Sie beginnt mit dem, was den Patienten umtreibt, sein Leben einengt, es zur Last werden lässt, jetzt oder schon lange. Dieses Anfangsthema ist sein erster Beitrag zur Therapie, ist Ausdruck der Hoffnung, dass wir ihn ernstnehmen und in seine Welt eintreten. Was wir dort antreffen und wie sich die therapeutische Beziehung im Verlauf der Psychotherapie entwickelt, ist nicht vorauszusehen. Es kann sein, dass sich das Anfangsthema gut klären und abschliessen lässt. Dann ist die Therapie zu Ende.
Meine Erfahrung ist aber, dass es meistens nicht so ist: Ich verstehe das ansatzweise Klären des Anfangsthemas eher als Test, es bildet den Vertrauensboden, auf dem dann erst verzweigtere, schwerer formulierbare, schmerzlichere Themen sich darstellen können. Das sichtbare, sagbare Symptom schwimmt wie eine Boje über dem noch unsichtbaren Problem. Die Therapie an diesem Punkt für beendet zu erklären, ist schade bis zerstörerisch – eine Zurückweisung; die Bestätigung dafür, dass das Leiden weitergehen muss.
Das Aha-Erlebnis, …
Die meisten Themen, die ich in Therapien erlebt habe, hängen nicht mit Denkfehlern zusammen, sondern mit der Lebensgeschichte. Es sind nicht kognitive Irrtümer und Verzerrungen, sondern über Jahre gewachsene emotionale Wahrheiten. Oder eben gerade nicht gewachsene, sondern blockierte, eingefrorene, vermiedene, verkümmerte, ins Gegenteil verkehrte. Sie sind nicht einfach in der Patientin gewachsen, sondern in einer Familie, einem Umfeld, einer Zeit – sie sind Teil ihrer Identität geworden, ihrer Realität, man kann sie nicht einfach blossstellen oder richtigstellen.
Und diese schwierigen Themen fangen überhaupt erst im Verlauf der Therapie an, sich zu entfalten und spürbar zu werden: Erst im Rahmen einer vertrauensvollen Beziehung aktualisieren sie sich, formen und färben die therapeutische Beziehung, machen sie in einem ganz bestimmten, einmaligen Sinne schwierig – und sind genau dann überhaupt erst zu erkennen und zu bearbeiten, wenn der Therapeut sie an sich selber, an der eigenen Reaktion erlebt. Und wenn er sie verstehen und in Worte fassen, der Patientin zur Verfügung stellen kann. Gut möglich, dass Therapeut und Patientin überwältigende, erschreckende oder beglückende Aha-Momente erleben: So hängen das Anfangsthema, die Alltagsprobleme und dieser jetzige gemeinsame Augenblick zusammen!
… das Herr Luchmann verbaut
Diese Chance (in der psychoanalytischen Theorie Übertragung genannt) verbaut Luchmann sich und seinen Patienten, indem er sie nicht im regelmässigen intensiven Gespräch behandelt, sondern zeitlich äusserst beschränkt und ausschliesslich auf Distanz, nämlich schriftlich (gemäss seinen Websites).
Klingt doch sehr nach Selbstschutz, sich so herauszuhalten. Er hat ja recht: Es ist ausgesprochen unbequem, oft verwirrend, manchmal beängstigend, sich mit seinen Patienten auf ihre innere Realität einzulassen – von gefühligem Plaudern keine Spur. Diese intensive therapeutische Arbeit von beiden, Patient und Therapeutin, denunziert er als Denkverweigerung und Schmarotzertum. Vielleicht darum, weil er sich lieber mit Menschen beschäftigt, die auf der Suche «nach einem noch präziseren Betriebssystem für (ihr) Denken» sind (wie es auf der Website von Herrn Luchmann steht) als mit solchen, die leiden.
Psychotherapie, die auf Einsicht des Patienten hinwirkt, an seinen Willen appelliert und auf einfache Entscheidungen baut, verleugnet die Macht des Unbewussten. Jede Hausärztin weiss, wie wenig Appelle bewirken (mehr Sport treiben, abnehmen, Schlafhygiene).
Die Krankenkassen verstehen das zum Glück. Sie finanzieren Langzeittherapien eigentlich immer, aber erst nach eingehender Prüfung unserer ausführlichen schriftlichen Berichte über schon erfolgte und noch geplante therapeutische Schritte. Ihnen ist klar (und es ist schon lange gut untersucht und durch die Outcome-Forschung erwiesen), dass intensive, lange Psychotherapie den Medikamentenverbrauch und die Hospitalisationsrate senkt und die psychische und soziale Stabilität dauerhaft (das heisst viele Jahre über die Therapie hinaus) verbessert. Soweit ich sehe, ist dafür nicht entscheidend, welcher Therapierichtung eine Therapeutin angehört – entscheidend ist, ob sie das Leben der Patientin im Blick hat oder auf Anpassung drängt.
Es geht eben nicht um «Wellbeing»
Man weiss, dass zwei Drittel der Hausarzt-Konsultationen psychosomatische Probleme betreffen, also körperliche Erscheinungsformen von psychischen Konflikten. Die im medizinischen Alltag normalen (und von den Patientinnen sehr oft auch gewünschten) Interventionen – zum Beispiel mit Krankschreibungen, Beruhigungs- und Schlafmitteln, Rückenoperationen, intensiven Abklärungen – erfassen oft nicht das Wichtige und Nötige und sind darum nicht effizient. Die Evaluierung der medizinischen Grundversorgung ist insofern äusserst mangelhaft und die Unterversorgung enorm.
Wenn eine Therapie gut läuft, nehmen die meisten Anfangssymptome mit der Zeit ab (manchmal sogar sehr rasch). Was auch nach längerer Zeit bleibt, damit muss der Patient leben lernen. Auch das ist Teil der Psychotherapie: zu unterscheiden zwischen nützlichen und schädlichen Bewältigungsstrategien, und sich der Trauer darüber zu stellen, dass nicht alles möglich ist und dass wir endlich sind.
Aber das, was sich vor allem entwickelt, ist die therapeutische Beziehung und in ihr die Persönlichkeit der Patientin. Nein, da geht es nicht um Wellbeing, wie das Bundesrat Couchepin damals nannte, also etwas, was nice to have ist und darum von vornherein aus der kassenfinanzierten Psychotherapie ausgeschlossen gehört. Sondern es geht um die Bereiche der Patienten, dank deren sie das Leben gut genug meistern können oder eben nicht – lieben, arbeiten und in der Welt wirksam werden können, oder krank sein und ihre Umwelt in Mitleidenschaft ziehen müssen.
_____________________
Duplik von Dietmar Luchmann
Effizienz und Evidenz sprechen gegen Psychoanalyse
Die Replik auf meinen Artikel «Die Schweiz, das Psycho-Paradies» bestätigt präzise die von mir kritisierten Punkte: Statt einer sachlichen Auseinandersetzung mit der Effizienzfrage führt der Psychoanalytiker Peter Schwob persönliche Angriffe und verteidigt ein ineffizientes System. Meine Kritik richtet sich gegen Methoden, deren Wirksamkeit fragwürdig ist, nicht gegen wirksame Psychotherapie. Die nachfolgende Analyse stellt die Faktenlage klar.
1. Der Zirkelschluss vom «wirklichen Problem»
Kernargument von Schwob ist die Metaphorik einer «Boje» (sichtbares Symptom) über einem tiefen, unsichtbaren «wirklichen Problem». Diese Erzählung schafft einen argumentativen Zirkelschluss, der auf Kosten von Patienten und Prämienzahlern geht und potenziell endlose Therapien rechtfertigt: Da das «wirkliche Problem» nebulös und unfassbar bleibt, kann sein Fortbestehen jederzeit als Beweis für seine abgründige Tiefe dienen.
Kognitive Psychotherapie hingegen lehrt Patienten nicht nur, das Symptom zu bewältigen, sondern gibt ihnen Werkzeuge (kognitive Umstrukturierung) an die Hand, um künftige Probleme selbständig zu lösen. Das Ziel ist die Befähigung zur Autonomie, nicht eine langfristige Abhängigkeit.
2. Denkfehler als Ergebnis der Lebensgeschichte
Schwob behauptet, psychische Probleme wurzelten in der Lebensgeschichte und seien keine «kognitive[n] Irrtümer». Damit wird ein falscher Gegensatz aufgebaut. Kognitive Psychotherapie analysiert sehr genau die kognitive Prägung durch die Lebens- und Lerngeschichte. Sie erkennt, dass vergangenes Leid heute durch sehr konkrete, schädliche und veränderbare Denk- und Verhaltensmuster aufrechterhalten wird. Anstatt in der Analyse der Vergangenheit zu verharren, trainiert sie die Selbstwirksamkeit für die Zukunft.
3. Unsachliche Angriffe und Falschbehauptungen
Schwob verlässt die Sachebene und greift mich mit Unwahrheiten an. Er behauptet, ich arbeite «ausschliesslich auf Distanz, nämlich schriftlich». Diese Behauptung ist falsch; ich therapiere seit über 30 Jahren in hochintensiven persönlichen Settings. Dies wirft die Frage auf, ob hier versucht wird, den Kritiker zu diskreditieren.
Für die Kernfrage meines Artikels ist vollkommen unerheblich, ob meine Klienten hochbegabt sind oder nicht, ob sie in der freien Natur, per Mail oder im Sessel therapiert werden. Die Frage lautet nicht, wer ich bin, sondern ob es wahr ist, dass das Schweizer Psychotherapie-System ineffizient ist und Patienten oft unnötig lange in Therapien festhält.
Darüber hinaus legt Schwob mir die Begriffe «Denkverweigerung und Schmarotzertum» in den Mund – Worte, die aus seiner Feder stammen, nicht aus meiner. Ich werte diese sinnentstellende Wiedergabe meiner Position als einen weiteren Angriff auf meine professionelle Integrität.
4. Fakten zu Krankenkassen und Forschung
Die Behauptung, Krankenkassen finanzierten Langzeittherapien nach «eingehender Prüfung», ist irreführend. Die Prüfung basiert auf Berichten der Therapeuten selbst und ist damit eine Kontrolle ohne unabhängige Instanz. Die überwältigende Mehrheit der evidenzbasierten Studien widerlegt die angebliche Überlegenheit von Langzeit-Psychoanalysen. Der renommierte Psychotherapie-Forscher Klaus Grawe von der Universität Bern stellte in seinem Standardwerk «Psychotherapie im Wandel» fest: Kognitive Psychotherapie ist «hochsignifkant wirksamer als psychoanalytische Therapie und Gesprächspsychotherapie» (1994, S. 670). Diese wissenschaftliche Evidenz, die den ökonomischen und therapeutischen Vorteil kognitiver Psychotherapie belegt, wird von Schwob komplett ignoriert.
5. Diskreditierung als letztes Mittel
Da die Fakten meines Originalartikels – höchste Psychiaterdichte der Welt, inakzeptable Therapiedauer von 60 Monaten, mehr Psychotherapeuten und Psychiater in Praxen als Hausärzte und Kinderärzte – unwiderlegt bleiben, weicht Schwob auf persönliche Angriffe aus. Er erfindet Vorwürfe, über die er sich empört. Er analysiert meine Website, um das Zerrbild eines Psychotherapeuten zu konstruieren, der sich angeblich nicht beschäftige «mit solchen, die leiden». Dieser direkte Angriff auf meine berufliche Ethik und menschliche Integrität ist aus meiner Sicht eine Schmähkritik, die nur auf die unzulässige Herabsetzung der Person zielt. Damit offenbart er den Rechtfertigungs-Notstand für seine psychoanalytische Psychotherapie.
Fazit: Ein Paradigmenwechsel ist überfällig
Die Abwehrhaltung in der Replik illustriert ein Phänomen, das der Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn in «Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen» (1962) beschrieb: Wenn ein altes Paradigma durch ein neues, leistungsfähigeres ersetzt wird, reagieren dessen Vertreter oft nicht mit rationaler Akzeptanz, sondern mit emotionaler Verteidigung; sie verteidigen nicht die Wahrheit, sondern ihre Welt.
Die persönlichen Angriffe sind dabei kein Zufall: Sie ersetzen die fehlenden Sachargumente für eine Methode, deren Ineffizienz belegt ist. Die Legitimation einer von der Allgemeinheit finanzierten Psychotherapie misst sich an ihrer nachweisbaren Wirkung und Effizienz – nicht an ihrer Geschichte und Metaphorik. Das Ziel muss immer der schnellstmögliche Weg zur Autonomie des Patienten sein.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Peter Schwob ist seit 33 Jahren psychoanalytischer Psychotherapeut und war 20 Jahre Präsident des Basler PsychotherapeutInnen-Verbandes.
Dietmar Luchmann ist Psychotherapeut mit jahrzehntelanger Erfahrung in der gesetzlichen Krankenversicherung und Inhaber der Angstambulanz am Zürichsee.
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.







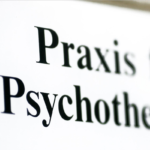


Für uns Leser ist doch eine Kernaussage wichtig: zwei Drittel der Hausarzt-Konsultationen betreffen psychosomatische Probleme. Wer die Psyche heilt, heilt den Körper. In einer narzisstischen Gesellschaft gibt es narzisstische Therapeuten, die ihre Zufuhr aus den Patienten ziehen und diese abhängig halten wollen (Ärzte, Pharma als auch Therapeuten). Dieses Problem könnte man mit einer Eignungsabklärung vor Ausbildungsbeginn lösen (halte ich für alle Richtungen in der Medizin für sinnvoll). Eine einzige Therapieform als Lösung für alle Probleme zu proklamieren, halte ich für zu kurz gedacht, da es zum Beispiel für die Behandlung einer komplexe Posttraumatische Belastungsstörungen unabdingbar ist, alternative Beziehungserfahrungen zu machen und das braucht einerseits ein gesundes Nervensystem (im Therapeuten) und andererseits Zeit.
Wenn man die Sprache von Herrn Luchmann in Betracht zieht – er «stellt klar», dass es «endlose» «nebulöse» Therapien gibt, die in «abgründige Tiefe» gehen usw. – dann entsteht der Verdacht, dass er bei sich selbst dort zu wenig hineingeschaut hatte. Denn Luchmann – im Gegensatz zum gegnerischen Standpunkt, der seinen eigenen «komplett ignoriert» – «analysiert sehr genau» und fühlt sich «unzulässig» herabgesetzt (als ob es eine zulässige gäbe). Und seine Gegner «verteidigen nicht die Wahrheit» (wie er, meint er). Luchmanns Sprache lässt den Schluss zu, dass sie rechthaberisch ist und ihr Anwender ein Durchsetzungsproblem hat, das den Diskurs erschwert.
Ist es ein Hahnenkampf? Einer, der viel über die menschliche Natur verrät: Auch Experten für psychische Gesundheit sind nicht frei von psychodynamischen Mustern. Vielleicht wäre ein gemeinsames Supervisionsgespräch der beiden sogar erkenntnisreicher als jede Replik.
Ich finde Peter Schwob unlogisch und Dietmar Luchmann wertvoll. Meine Erfahrung: Endlosigkeit hat mit Unwirksam zu tun. Probleme werden zerredet statt gelöst (Patientin: «Kaffeehausklatsch»). Ich kenne x–Fälle, mehr tragisch als komisch, obwohl es des Humors nicht entbehrt, wie hier Kasse gemacht wird. Beispiel für ein falsches Dogma: Der Patient ist die Ursache, die sich ändern muss (nicht die Umwelt). Eine Psychoterapeutin «behandelte» eine Patientin jahrelang inklusive vieler externer Termine (wie Hypnose) und sagte, sie habe mehrere Patienten mit demselben Problem: Wohnenlärm. Die Therapien brachten nichts, aber immense Kosten und Kräfteverluste der Patienten. Bundesamt: Lärm macht krank, Gewöhnung nicht möglich; NZZ: Akustische Gewalt. Statt endlos Praxiskonten zu füllen, plädiere ich für Ursachenbehebung (medizinische Termini: Expositionsstopp, Milieuwechsel). Ätiotrop statt «Psychosomatisierung» in unserer zunehmend krankmachenden, nicht artgerechten Umwelt (vgl. Artensterben).