Lateinamerika: Bilanz fällt durchzogen bis ernüchternd aus

Seit Anfang 2022 regiert in Chile eine gemässigt linke Koalition unter der Führung des 39-jährigen Präsidenten Gabriel Boric. Die Zeitschrift «Lateinamerika Nachrichten» zieht in einem ihrer Monatshefte Bilanz. Die Analyse vermittelt den Eindruck von Enttäuschung und Ratlosigkeit. Sogar von Stillstand ist die Rede. Durch die Machtverhältnisse in der Legislative sind der Linken die Hände gebunden. Mit diesem Umstand müssen die meisten Regierungen in Lateinamerika, die strukturelle Reformen anstreben, zurechtkommen.
Entscheidend war in Chile die Niederlage bei der Volksbefragung über den ersten, deutlich linkspopulistisch angehauchten Entwurf zu einer neuen Staatsverfassung. Auch den zweiten Entwurf, diesmal von konservativen Kräften diktiert, lehnte das Volk ab. So bleibt Pinochets Grundgesetz aus dem Jahr 1980 auf unbestimmte Zeit in Kraft – und das wirkt fast auf die gesamte Arbeit in Regierung und Parlament lähmend.
Immerhin ist es gelungen, die Inflation von 12 auf 4 Prozent zu drücken und den gesetzlichen Mindestlohn auf umgerechnet rund 500 Euro anzuheben. Auch konnte die Regierung in dem für Chile so wichtigen Kupferbergbau neue Steuern durchsetzen. Die zusätzlichen Einnahmen werden an die Provinzen weitergeleitet und gleichzeitig wird der bisher straffe Zentralismus etwas gelockert.
Chile: Kleinfischer kämpfen für Fangrechte
Eine der grössten Sorgen der Bevölkerung ist die wachsende Bedrohung durch Kriminalität vor allem in der Hauptstadt Santiago. Dazu kommen Skandale und Querelen zwischen verschiedenen Sektoren des politischen Spektrums sowie immer wiederkehrende Exzesse von Polizeigewalt, was hauptsächlich dem Erbe der Diktatur zuzuschreiben ist. Das ist aktuell auch bei einem endlosen Seilziehen um ein neues Fischereigesetz zu beobachten, wie «amerika21» berichtet. Das neue Gesetz soll Kooperativen von Kleinfischern höhere Fangquoten sichern. Doch die rechte Mehrheit im Senat verschleppt die Verabschiedung und versucht den Gesetzesentwurf zu Gunsten der industriellen Grossfischerei zu ändern.
Seit den Zeiten des uneingeschränkten Neoliberalismus beherrschen eiskalte Interessen des Grosskapitals das wirtschaftliche Geschehen in Chile. Die konservative Mehrheit im Kongress lässt die Haie der Fischereiindustrie gewähren, obwohl dabei weite Abschnitte der gut 4000 Kilometer langen Pazifikküste rücksichtslos leergefischt werden. Das zwingt die Regierung immer wieder, für manche Fischarten ein Fang- und Konsumverbot anzuordnen. Für die kleingewerbliche Fischerei, von der in Chile viele tausend Familien existenziell abhängig sind, ist nur eine Seemeile (knapp zwei Kilometer ab Küste) freigegeben. Kleinfischer, die sich gegen diese Ungerechtigkeit auflehnen, werden von militarisierten Polizeitruppen niedergeknüppelt.
Was in Chile auch unter Präsident Boric schiefgeht, versucht ein lokaler Politikwissenschaftler zu ergründen, dessen Analyse in der spanischen Zeitschrift «Agenda publica» nachzulesen ist. Der Autor vergleicht die Herrschaft des jungen Präsidenten mit jener anderer Staatsoberhäupter nach der Pinochet-Ära. Diese hätten die Möglichkeit struktureller Reformen gegen die vielfältigen Widerstände von rechts realistischer eingeschätzt und damit – allerdings bescheidene – Ziele erreicht.
Immerhin räumt der Autor ein, dass Boric Lehren gezogen habe aus seiner bisherigen Amtszeit. Was seine Arbeit erschwere, sei die zunehmende Fragmentierung in der Regierungskoalition – eine Tendenz zur Spaltung, die inzwischen auch im Lager der konservativen Opposition zu beobachten ist. Unter solchen Umständen ist es klar, dass dem amtierenden Präsidenten die Zeit davonrennt. Bereits fahren Anhänger und Gegner ihre Geschütze auf für die allgemeinen Wahlen im Oktober dieses Jahres.
Argentinien: Der Schuldenberg wird immer grösser
Eine Zwischenbilanz zu Argentinien 18 Monate nach dem Wahlsieg von Javier Milei ist auf der klar linksgerichteten Plattform «Geopolitical Economy» erschienen. Hier wird die These aufgestellt, dass der «libertäre», in Wirklichkeit ultraneoliberale Staatschef die Grundlagen der argentinischen Ökonomie zerstöre, um das Vordringen des multinationalen Kapitals zu begünstigen und damit das Land in eine Kolonie zu verwandeln.
Die Analyse vergleicht die Schuldenpolitik von Néstor und Cristina Kirchner mit jener von konservativen und neoliberalen Staatschefs wie Menem, Macri und neuerdings Milei und urteilt über langfristige Folgen. Demnach ist die Politik der letztgenannten aus neutraler Warte vor allem in makroökonomischer Hinsicht verheerender und in sozialen Belangen schlicht katastrophal. Als Illustration mag hier das Gespräch mit dem Erzbischof von Buenos Aires dienen, das die deutsche Journalistin Gaby Weber, die seit Jahrzehnten in Argentinien lebt, für das «Overton-Magazin» geführt hat.
Abschliessend zum Thema Argentinien lohnt es sich, bei «amerika21» nachzulesen, wie Präsident Milei die Aufnahme eines weiteren Megakredits beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar rechtfertigt. Damit schuldet Argentinien allein dem IWF rund 60 Milliarden Dollar – weltweit ein absoluter Rekord. Nach monatelangen Diskussionen schliesst dieser Vertrag mit einer Klausel, die erste Schritte zu einer Lockerung des bisher straff kontrollierten Devisenhandels enthält – ein in jeder Hinsicht heisses Eisen.
Paraguay: Massenproteste für soziale Gerechtigkeit
Paraguay scheint aus einem schier endlosen Dämmerzustand zu erwachen. Wie «amerika21» berichtet, demonstrieren Scharen von Studentinnen und Studenten, denen sich Tausende von Kleinbauern anschliessen, gegen die seit 1953 fast ununterbrochen herrschende Colorado-Regierung (die «Roten»). Rot ist in diesem Land nicht die Farbe linksgerichteter Kräfte, sondern der Konservativen aller Gattung. Der Protest richtet sich gegen deren Herrschaft im Allgemeinen, im Besonderen aber gegen die Verteilung von finanziellen Mitteln, die reichlich in die Staatskasse fliessen.
Die Regierung in Asunción kassiert Jahr für Jahr Milliarden Dollars aus den Erträgen von zwei der grössten Wasserkraftwerke der Welt – Itaipú und Yacyretá. Da beide Kraftwerke an Grenzflüssen zu Brasilien respektive Argentinien liegen, hat Paraguay ein vertragliches Recht auf die Hälfte des erwirtschafteten Profits – so viel Geld, dass die Colorado-Regierung kaum weiss, wohin damit. In der Praxis steckt die Regierung quasi unbegrenzte Summen in den Bau und Ausbau von Einkaufszentren, in denen jeder erdenkliche Luxus für die Oberschicht angeboten wird, doch bei sozialen Ausgaben und den Budgets für die Bildung knausert die Regierung. Auch Massnahmen für eine Agrar- und Landreform kommen nicht vom Fleck. Gleichzeitig werden Polizei und Armee hochgerüstet, um einen drohenden Volksaufstand in Schach zu halten.
Brasilien: Ex-Präsident Bolsonaro droht lange Haftstrafe
In Brasilien steht der Prozess gegen den früheren rechtspopulistischen Staatschef Jair Messias Bolsonaro im Mittelpunkt des Interesses. Bolsonaro wird vorgeworfen, nach seiner Wahlniederlage im Oktober 2022 einen Putsch gegen die Regierung seines Nachfolgers Lula da Silva geplant zu haben. Anders als sein erklärtes Vorbild Donald Trump, soll Bolsonaro nicht ungeschoren davonkommen, schreibt «BBCMundo». Brasiliens oberster Richter Alexandre de Moraes, der selber im Visier der Putschisten stand, scheint entschlossen, den Prozess gegen Bolsonaro und seine Mitverschwörer mit harter Konsequenz durchzuziehen. Der Fall gilt als spektakulärstes Verfahren in der Justizgeschichte Brasiliens. Bolsonaro droht eine Haftstrafe bis zu 40 Jahren.
Ecuador: Amtierender Präsident setzt sich bei Stichwahl durch
In Ecuador bleibt Daniel Noboa Präsident. Der junge Staatschef hat die Stichwahl am 13. April mit einem überraschend klaren Ergebnis gewonnen. 11 Prozent betrug sein Vorsprung auf die linksgerichtete Kandidatin Luisa González, die rund 44 Prozent der Stimmen erhielt.
Noboa ist der Sohn des reichsten Mannes im Land und ein überzeugter Anhänger neoliberaler Politik. Seit etwas mehr als 16 Monaten ist er Präsident Ecuadors. Noboa hatte González bereits vor zwei Monaten in der ersten Wahlrunde besiegt, damals allerdings mit einem hauchdünnen Vorsprung. Die Wählerwanderung von rund einer Million wirft auch nach der Analyse im «IPG Journal» Fragen auf: Aus welchen Segmenten der Bevölkerung stammen diese Stimmen zu Gunsten des Milliardärsprösslings? Wie hat die aktuelle schwere Wirtschaftskrise die Wahl beeinflusst? Was verspricht man sich von der Justiz, die als korrupt und überfordert gilt? Wie soll diese im Verbund mit einer stockkonservativen Regierung die übermächtig gewordene Drogenmafia in Schach halten? Ein Kommentar in der deutschen Tageszeitung «taz» macht deutlich, dass nach der Wahl Noboas vor allem der ärmere Teil der Bevölkerung Ecuadors noch mehr leiden wird.
Honduras: Magere Bilanz einer Hoffnungsträgerin
Bei Halbzeit der Legislatur wird auch in Honduras eine Zwischenbilanz gezogen. Knut Henkel, Korrespondent der «taz» in Zentralamerika, stützt sich bei seiner Einschätzung vor allem auf Aussagen des populären Jesuiten Padre Melo. Dieser kritisiert die Kommunikationsstrategie der Regierung von Xiomara Castro, einer Politikerin, die sich auf sozialdemokratischen Spuren voranzutasten versucht. Nun gilt die honduranische Innenpolitik als ein System, wo «Seilschaften, Patronage … und Korruption seit Jahrzehnten zum politischen Alltag gehören». Immerhin: Die gegenwärtige Regierung in Tegucigalpa habe bis dato keinen schweren Skandal zu beklagen. Dank gelungener Koalition mit der Liberalen Partei habe die Regierung von Xiomara Castro einige Reformen durchboxen können. Dennoch haben seit 2023 schätzungsweise 200‘000 Menschen ihre Heimat Honduras verlassen und damit ihre Hoffnungslosigkeit gegenüber der herrschenden Politik zum Ausdruck gebracht. Der Exodus hat in den allermeisten Fällen nur ein Ziel: die USA. Doch seit Donald Trump die Grenzen am Rio Grande dicht gemacht hat, ist für die meisten Migranten in Mexiko Endstation.
El Salvador: Mega-Gefängnis für 40’000 Insassen
Ebenfalls in der «taz» wird ein beredtes Zeugnis von der jüngeren Entwicklung im Kleinstaat El Salvador abgelegt. Die Lebensbedingungen waren wegen der Ausbreitung der gefürchteten Mara-Jugendbanden in den letzten Jahren katastrophal. Mit einer Politik der ultra-harten Hand konnte der junge Präsident Nayib Bukele Entführungen und Erpressungen dieser Banden spürbar reduzieren, wenn nicht gar verhindern. Dabei spielte die Eröffnung einer neuen gigantischen Haftanstalt für 40‘000 Insassen eine Schlüsselrolle.
Der Preis für diese repressive Kampagne ist nicht kalkulierbar. An die 10‘000 Personen werden im Gefängnis ausserhalb der Hauptstadt San Salvador in äusserst prekären und erniedrigenden Verhältnissen für unbestimmte Zeit festgehalten. Schreiendes Unrecht geschieht dann, wenn Verhaftungen willkürlich oder auf blossen Verdacht hin erfolgen. In einem Staat, dessen Justiz schwerfällig und bestechlich ist, darf niemand auf ein faires Gerichtsverfahren hoffen. Solche Unrechtsfälle sollen zu Hunderten vorgekommen sein – manchmal bloss, weil jemand zur falschen Zeit am falschen Ort war. Es ist völlig unklar, was mit den inhaftierten Männern passiert. Bleiben sie für immer im Gefängnis? Oder kommen sie traumatisiert wieder heraus? Werden sie jemals einen Job finden oder sind sie ein Leben lang stigmatisiert, auch wenn sie unschuldig im Gefängnis sassen?
Panama verlässt Chinas «Neue Seidenstrasse»
Die demokratisch gewählte Regierung von Panama hat sich im Streit um die Rechte über den Kanal zu bemerkenswerten Konzessionen gegenüber Washington durchgerungen. Die chinesische Verwaltung in den Häfen am Nord- und am Südende der Wasserstrasse soll über eine Milliarde US-Dollar Konzessionsgebühren nicht vertragsgemäss mit dem panamaischen Staat abgerechnet haben. Eine Untersuchung mit chinesischer Beteiligung soll nun Klarheit bringen, berichtet «La Nacion» (Buenos Aires). Präsident José Raúl Mulino kündigte an, sein Land werde sich aus dem chinesischen Handels- und Investitionsprogramm «Neue Seidenstrasse» zurückziehen. Man wolle die «problematische Präsenz [Chinas am Isthmus] reduzieren» – auf wessen Wunsch wohl?
__________________________________________________________
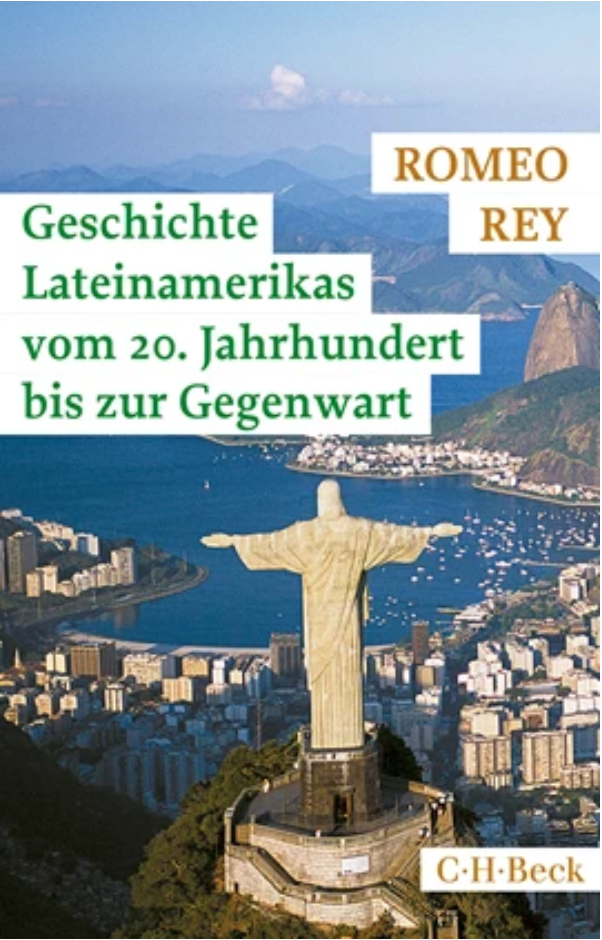
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine. Der Autor war 33 Jahre lang Korrespondent in Südamerika, unter anderem für den «Tages-Anzeiger» und die «Frankfurter Rundschau».
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.









