Rio Ziele: Die nachhaltige Unverbindlichkeit
Das Wort «nachhaltig» stammt aus der Waldwirtschaft, und Forstleute wissen genau, was es bedeutet: «Nur soviel Holz schlagen, wie nachwächst.» Oder bezogen auf die Natur als Ganzes: Nur soviel nutzen, wie die Natur erneuern respektive regenerieren kann. Die Schweizer Volkswirtschafts-Professorin Heidi Schelbert dehnte den ökologischen Begriff später sinngemäss auf die Ökonomie aus: «Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung heisst, von den Zinsen leben und das Vermögen nicht aufessen.»
Diesen Nachhaltigkeits-Anspruch erweiterte 1987 die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (Brundlandt-Kommission) auf die Menschheit als Ganzes: «Nachhaltige Entwicklung deckt die Bedürfnisse der Gegenwart, ohne zukünftigen Generationen die Grundlagen für deren Bedürfnisbefriedigung zu nehmen.» Mit dieser abstrakten Definition öffnete die Brundlandt-Kommission den Spielraum für Interpretationen: Wo enden die Bedürfnisse der Gegenwart – beim Lebensstandard in der Schweiz oder in Indien? Und inwieweit vermindert der Raubbau an Erdöl und andern nicht nachwachsenden Rohstoffen die Möglichkeit späterer Generationen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen?
Rio 1992 und die Nachhaltigkeit
Politische Bedeutung erhielt die «Nachhaltigkeit» fünf Jahre später, am Erdgipfel von 1992 in Rio de Janeiro, an dem die drei grossen Themen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft erstmals an einer Regierungskonferenz gemeinsam behandelt wurden. Daraus entstand ein neues magisches Dreieck, gebildet aus den Eckpunkten ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Konkreter: Die nachhaltige Entwicklung in den drei Bereichen Natur, Wirtschaft und Gesellschaft muss gleich gewichtet werden. Damit öffnete sich ein neues Konfliktfeld. Denn die ursprüngliche, streng ökologische Forderung, nicht mehr zu nutzen, als die Natur nachwachsen lässt oder regenerieren kann, kollidiert mit den ökonomischen und gesellschaftlichen Forderungen, das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen aller zu sichern.
Das «Business Council for Sustainable Development», das in Rio die Interessen der Wirtschaft vertrat, definierte die Nachhaltigkeit nochmals einseitiger: «Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung gründet auf der Erkenntnis, dass Wirtschaftswachstum und Umweltschutz untrennbar miteinander verbunden sind.» In der Folge ersetzten auch die meisten Regierungen die neutrale Formulierung «nachhaltige Entwicklung» mit der Forderung nach «nachhaltigem Wachstum».
Mehr Wirtschaft, weniger Natur
Diese Umformulierung machte das Wachstum der Wirtschaft zur Voraussetzung für die nachhaltige Entwicklung insgesamt. Die Vertreter von Politik und Wirtschaft verschoben damit das Gewicht in der Nachhaltigkeits-Debatte – zu Gunsten der Wirtschaft und zu Lasten von Natur und Gesellschaft. Denn Wirtschaftswachstum bietet keine Garantie, weder für soziales Wohlergehen noch für ökologische Nachhaltigkeit. Im Gegenteil: Während die Weltwirtschaft, begrünt mit der Etikette «Nachhaltigkeit», weiter wuchs, blieb die soziale und ökologische Nachhaltigkeit auf der Strecke.
Konkret: Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit und Übernutzung der Natur nahmen seit 1992 tendenziell weiter zu. Das belegt – neben unzähligen weiteren Statistiken und Studien – die Naturbuchhaltung des «Footprint Networks»: Der ökologische Fussabdruck der Menschheit überschritt die ökologische Kapazität des Planeten Erde im Jahr 1992 um 22 Prozent, im Jahr 2008 bereits um 53 Prozent. Knapp 20 Jahre, nachdem sich die Regierungen in Rio zu einer nachhaltigen Entwicklung bekannten, stieg die Verschuldung der Menschheit gegenüber der Natur um einen Viertel.
Wandel zur Beliebigkeit
Verbreitet hat sich die Nachhaltigkeit vor allem verbal: «Nachhaltig» wird heute nicht nur gewachsen, gelebt, gehandelt, gearbeitet, gebaut, geschenkt oder investiert. Heute gibt es auch nachhaltiges Bewusstsein, Management, Spielzeug, etc. und von Toyota sogar ein «nachhaltiges Autohaus». Mit dem schwammigen Wort «nachhaltig» lässt sich heute alles und auch das Gegenteil schönfärben und rechtfertigen. Die Nachhaltigkeit wandelte sich zur Beliebigkeit.
Das gleiche Schicksal droht andern, einst präzis definierten Postulaten. Zum Beispiel der «2000-Watt-Gesellschaft»: Die konstante Leistung von 2000 Watt entspricht einer Menge von 17 600 Kilowattstunden. So gross war im Jahr 1994 der durchschnittliche Primärenergieverbrauch pro Jahr und pro Kopf der Menschheit. Das damals am Paul Scherrer Institut (PSI) präsentierte Konzept sah vor, diese Durchschnitts-Menge nicht weiter ansteigen zu lassen und gleichzeitig gerecht auf die Menschheit zu verteilen. Demnach hätten die Industriestaaten ihren Energieverbrauch auf ein Drittel bis ein Fünftel senken müssen, während armen Entwicklungsländern mehr Energie zustand (und immer noch zusteht). Die «2000 Watt-Gesellschaft» fasste damit in eine Zahl, was der Philosoph Hans Jonas einst als Prinzip der ökologischen Verantwortung wie folgt definierte: «Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der dauernden Möglichkeit menschlichen Lebens auf Erden.»
Von der Zahl zur Metapher
Das 2000-Watt-Ziel lässt sich in der Schweiz und andern wohlhabenden Staaten nur erreichen, wenn Wirtschaft und Gesellschaft ihre Produktion und ihren Konsum von Gütern, Dienstleistungen, Wohnraum und Verkehr massiv reduzieren. So verbraucht eine Person in der Schweiz im Durchschnitt rund fünfmal mehr Primärenergie (inklusive Importüberschuss an grauer Energie), als die 2000-Watt-Gesellschaft erlaubt. Das hindert Bund, ETH und diverse Städte nicht daran, die «2000-Watt-Gesellschaft» als «Nachhaltigkeits»-Ziel» vollmundig zu postulieren, ohne aber die dazu notwendigen Mittel respektive Einschränkungen zu verordnen.
Umweltverbände propagieren heute «Wegweiser in die 2000-Watt-Gesellschaft» und Bauherren preisen ihre Bauten vollmundig als «Leuchtürme der 2000 Watt-Gesellschaft» an. Der präzise Begriff «2000 Watt-Gesellschaft», der die Begrenzung der Menge und die global gerechte Verteilung miteinander verknüpft, ist zum Etikettenschwindel und zum Label provinzieller Standortförderung verkommen. Einer, der das in einem Interview mit der «Weltwoche» öffentlich eingestand, ist Ralph Eicher, Präsident der ETH: «Die 2000 Watt-Gesellschaft», sagte Eicher, «ist nur eine Metapher fürs Energiesparen».
Die «Nachhaltigkeit» ist ebenfalls zur «Metapher» geworden, aber nicht nur für ein Thema allein, sondern für drei: Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft. «Nachhaltigkeit» verknüpft die Unverbindlichkeit des Begriffs mit der Illusion, Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtigkeit und Naturerhaltung liessen sich konfliktfrei unter einen Hut bringen. Das geht nicht. Wer eine nachhaltige Entwicklung im ursprünglichen Sinn des Wortes anstrebt, muss Prioritäten setzen. Und dabei wird klar werden: Die Natur kann ohne Wirtschaft und Gesellschaft leben. Ohne Natur aber ist alles andere nichts.






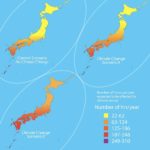


Dazu passen die zwei folgenden Gedichte:
Gleichgewicht
Das Fundament ist die Natur;
Drinn eingefügt die Menschheit nur.
Und diese darf zu gross nicht werden;
Sonst stört’s das Gleichgewicht auf Erden.
Zentrum der Ethik
Wir haben es genug gehört:
Natur, die wird sehr stark zerstört
Von Frauen und von Männern.
D’rum sollte es nun dämmern;
Das Resultat von der Geschicht’:
Natur die braucht den Menschen nicht.
Wir brauchen aber die Natur.
D’rum bleibt der einzge Ausweg nur,
Dass wir Natur viel höher ehren
Und uns nicht stets noch mehr vermehren.
Im Ethik-Zentrum soll statt Mensch allein,
Die ganze Schöpfung eingebettet sein.
Beide Gedichte sind aus dem Buch «Öko-Balance".