Kitas: Dieser Schuss geht hinten hinaus
«Über 57’000 Franken im Jahr – Eltern ächzen unter hohen Kita-Rechnungen». Das war am Montag die Hauptschlagzeile im Tages-Anzeiger. Noch am selben Tag beschloss der Nationalrat, in den nächsten vier Jahren 200 Millionen Franken zur Finanzierung der Kitas beizutragen. Das Anliegen der Kita-Lobby ist verständlich: Die Betreuung von Kleinkindern erfordert Zeit. Zeit, während der ein Elternteil kein Geld verdienen und entsprechend weniger in die Altersvorsorge einzahlen kann. Das ist deshalb ungerecht, weil es vor allem die Frauen trifft. Die Alliance F schreibt dazu: Mit Bundesgeldern für die Kitas würden die «Familienbudgets in Zeiten der Teuerung entlastet und Anreize für eine Pensums-Erhöhung geschaffen.» Natürlich fehlt auch nicht der Hinweis auf die «von der Wirtschaft dringend benötigten Fachkräfte».
Doch geht die Rechnung wirklich auf?
Rechnen wir: Eine Familie mit – für die Erhaltung der Art nötigen – zwei Kleinkindern (wovon ein Baby) zahlt in der Kita «Regenbogen» in Zürich für eine Vollbetreuung monatlich 6796 Franken. Da Kitas nur in Ausnahmefällen einen Profit abwerfen, dürfte dies den effektiven volkswirtschaftlichen Kosten entsprechen. Und das, obwohl Kita-Mitarbeiterinnen eher schlecht bezahlt werden. Studierende der Höheren Fachschule Kindererziehung (HFK) erhalten im ersten Lehrjahr 2’000 Schweizer Franken pro Monat. Ihr Verdienst steigt kontinuierlich auf bis zu 3’800 Franken monatlich im vierten Lehrjahr. Mit drei bis fünf Jahren Berufserfahrung steigt der Lohn dann auf rund 4600 Franken (hier).
Gewinn: Maximal 75 Stellenprozente
Selbst wenn wir annehmen, dass alle, die zu den Dienstleistungen der Kitas beitragen, im Schnitt 4600 Franken verdienen, heisst das, dass die Betreuung von zwei Kleinkindern etwa 150 Stellenprozente beansprucht.
Mit einer Kita-Vollbetreuung könnte ein Elternpaar ein Arbeitspensum von total 175 Prozent leisten und wäre damit zeitlich voll am Anschlag. Schliesslich müssen die Kinder jeden Morgen zur Kita gebracht und abends wieder abgeholt werden. Und wenn eines der Kinder krank wird, muss ein Elternteil zuhause bleiben.
Eine Kita-Vollbetreuung schafft also maximal zusätzliche 75 Stellenprozente, beansprucht aber rund 150 Stellenprozente, meist Frauen, die zudem vier Jahre lang als Kindererzieherinnen ausgebildet werden müssen. Statt das «brachliegende Fachkräftepotential» der Frauen «besser auszuschöpfen», wie es immer wieder heisst, wird es durch die Kitas absorbiert und der Wirtschaft entzogen.
Die volkswirtschaftliche Rechnung sieht noch viel schlechter aus, wenn man berücksichtigt, dass jedes Jahr rund 30 Prozent der Kita-Mitarbeiterinnen aus dem Beruf aussteigen. Teils wegen der miesen Bezahlung, teils weil sie eine eigene Familie gründen wollen. Das verschlechtert die Qualität der Betreuung und erhöht die administrativen Unkosten und vor allem die Kosten der Ausbildung pro geleistetes Arbeitsjahr. Zumindest aus volkswirtschaftlicher Sicht wird die Sache auch dadurch nicht besser, dass der Staat in die Lücke springt und den Preis für die Kitas auf– wie das der Gewerkschaftsbund fordert – 10 Prozent des Familieneinkommens beschränkt.
Das Problem: Männer wollen eine Vollzeitstelle
Was ist die Alternative? Vielleicht hilft ein Blick zurück. Noch in den 1970er-Jahren war es auch bei der damals tiefen Produktivität normal, dass ein männlicher Alleinverdiener eine vierköpfige Familie durchbringen konnte. Die Kindererziehung war Sache der Ehefrau, der Grosseltern und der Nachbarschaft. Es brauchte keine Spezialausbildung, keine Kita-Lokale, keine Kita-Bürokratie, keine langen Wege. Der grosse Nachteil: Fast alle bezahlte Arbeit – und die mit dem Lohn verbundene Macht – ging an die Männer. Heute besteht das Problem darin, dass die Männer immer noch eine Vollzeitstelle beanspruchen. Um auch für die Frauen bezahlte Arbeit zu schaffen, haben wir die Kinderbetreuung kommerzialisiert, professionalisiert und staatlich finanziert.
Viel effizienter wäre es, die Erwerbsarbeit etwa auf zwei 60-Prozent-Stellen aufzuteilen und die Rahmenbedingungen für die unentgeltliche Arbeit in der Familie und Nachbarschaft zu verbessern. Dazu müssten wir aber mit alten Gewohnheiten brechen und männliche Privilegien abschaffen. Das ist schwierig und bestenfalls langwierig. Mit Kitas konnten wir das Problem schneller «fixen». Allmählich wird aber klar, dass wir uns mit diesem «Quick-Fix» nicht nur untragbare Kosten – 57’000 Franken pro Jahr – aufgehalst, sondern auch einen Niedriglohnsektor aufgebaut haben – unter dem vor allem die Frauen leiden.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.








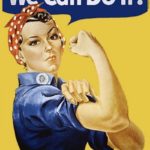


Kinder sind unsere Zukunft, auch wenn die grad etws düster aussieht. Investitionen bei Kinder sind trotzdem zukunftsträchtig. Besser als in eine sinnlose Armee zu investieren oder die Landwirtschaft zu vergolden.
Ein etwas seltsame Vereinfachung, den Preis pro Kind duch das Einkommen einer Betreuerin zu teilen und daraus zu schliessen, dass ein Kind von 1,5 Frauen betreut wird. Wer bezahlt die Miete, die zwei behindertengerechten geschlechtergetrennten Klos, die Versicherungen, das Mobiliar, die eurogenormten Hochsicherheits-Spielgeräte, die tausendundeine Abgabe und Gebühr, etc. etc. etc. ?
Meine Rechnung geht so, dass das Paar mit seinen 6796 Franken neben der Arbeit der Kita-Betreuer auch die von Ihnen erwähnten Kosten abdeckt, und dass alle, die hier auf irgend eine Weise mitarbeiten im Schnitt 4600 Franken verdienen, was per Saldo rund 150 Stellenpozente ergibt. Das ist – zugegen – stark vereinfacht, zeigt aber das Problem.
Herr Vontobel wieder mit dem gesamtwirtschaftlichen Laserblick! Ausgezeichnet. Doch ist das Problem wirklich, dass Männer 100% arbeiten wollen? Ist das Problem nicht vielmehr, dass Frauen heute eben auch 50%-80% arbeiten wollen oder sogar müssen? Während die Grosseltern nicht mehr vor Ort, sondern weit weg wohnen, oder auf Kreuzfahrt sind?
Ja, das Problem ist in der Tat, dass die Grosseltern nicht mehr vor Ort sind, bzw. dass die Nachbarschaften und Familien nicht mehr funktionieren. Der Text deutet an, das es sich lohnen würde, genau dies zu ändern. Dass wir heute als Familie mehr arbeiten mässen als einst, hängt an der Ausbeutung durch die Vermieter und Bodenbesitzer. Siehe dazu meine einschlägigen Texte
Ist Herr Vontobel mit seiner Zahlenakrobatik wirklich der Meinung, dass irgendein Arbeitgeber sich mit 60% Arbeitszeit zufrieden gibt? Ich kenne nur sehr wenige Stellen, auf denen dies möglich ist. Außerdem hieße 60% Arbeitszeit auch nur 60% Verdienst; das will doch keiner. Auch Herr Vontobel wird es nicht toll finden wenn sein Klempner oder Elektriker plötzlich das Weite sucht, weil zuhause ein Kind zu betreuen ist. Das sind weltfremde Ansichten, die vielleicht in Kleingruppen oder im dörflichen Bereich möglich sind; die Amisch etwa machen das so, aber da ist die Sozialstruktur völlig anders. In einem funktionierenden Sozialstaat werden Leistungen wie Kinderkrippe, Kindergarten, Hort und dortige Speisung durch die hohe Arbeitsproduktivität der Eltern erwirtschaftet und sind kein Ballast. Nach Vontobels Rechnung könnte man ja genausogut öffentliche Bibliotheken dichtmachen und deren Angestellter in produktivere Arbeiten abkommandieren.
Die Frauen sind ja heute durchschnittlich besser ausgebildet als die Männer. Aus diesem Grund sollten sie eher mit höheren Pensen berufstätig sein. Solange die Männer ihre Pensen nicht entsprechend reduzieren, ist der Staat für das Schliessen der Betreuungslücke verantwortlich. Dieser Verantwortung gerecht zu werden, heisst, nicht nur 200 Mio. zu investieren, sondern zwei Milliarden. Eine Reichtumssteuer oder eine lohnadäquate Umweltsteuer könnten die Finanzierung problemlos garantieren, so dass die Berufe in diesem Bereich auch leistungsgerecht entlöhnt und die Ausbildungen den Anforderungen angepasst werden. In Skandinavien geht das ja auch.
Zwei Milliarden, das schreibt und fordert sich so leicht. Doch umgerechnet auf Arbeitsstellen entspricht das etwa 20’000 Kita-Mitarbeitern in einem 80% Pensum, die alle auch noch ausgebildet und in Anbetracht der Fluktuationsrate mindestens alle fünf Jahre ersetzt werden müssen. Diese Stellen werden dann vorwiegend von den Frauen besetzt, mit denen wir eigentlich den Fachkärftemangel beheben wollten. Wir müssen die Realität hinter den Zahlen sehen.
«Mit Frauen den Fachkräftemangel beheben» scheint mir ehrlich gesagt der Ursprung dieses ganzen Problems zu sein. Denn das führt zu «fehlenden Müttern», entweder weil es erst gar keine Kinder mehr gibt (double income no kids), oder weil diese eben an die Kita abgegeben werden müssen, womit der Teufelskreislauf weiterdreht. Und klar, die Grund- und Immobilienbesitzer halten die Hände auf und kassieren dabei ohne eigene Leistung (Rentiers).
Ich sehe nicht ein, weshalb wir Steuerzahler für die Kittas aufkommen sollen. Viel sinnvoller wäre doch, wenn die Unternehmen Kittas anbieten würden. Je nach Ort, könnten sich die Unternehmen zusammen tun und eine Kitta anbieten. Schliesslich sind es doch die Unternehmen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen! Also sollen sie dafür aufkommen. Solche Unternehmen gibt es bereits, z. Bsp. Spitäler.
Selbstverständlich wäre das der einzig richtige Ansatz. Leider ist die Macht der CH Wirtschaft so gross dass es nie stattfinden wird.
Die Kosten für die Allgemeinheit sind weitaus höher: Wer seine Kinder nach dem regulären Mutterschaftsurlaub in die Kita gibt, muss früh abstillen, das führt zu einem höheren Brustkrebsrisiko, die Folgen für das Kind sind nicht nur körperlicher sondern auch psychischer Natur – diesen „Quick Fix“ werden wir als Gesellschaft in spätestens zwanzig Jahren durch massiv höhere Gesundheitskosten und Arbeitsausfälle spüren.
Wer Schicht, an Wochenenden oder Nachts arbeitet, hat nichts von diesen Millionen. Die Alleinerziehenden brechen bei dieser Lösung reihenweise zusammen und belasten die Sozialsysteme.
Eine bedarfsgerechte und faire Lösung könnte auch sein, anstatt Institutionen zu subventionieren, die angefallene Arbeit zu entlöhnen, wie es Ökonomin Madörin berechnet hat. Die Zahlen mögen immens erscheinen, wenn wir aber alle Faktoren zusammenzählen, bin ich sicher, dass wir damit günstiger fahren würden.
Eine interessante Rechnung. Ich vermisse die Zusatzkosten, weil der Lohn ja nicht der einzige Kostenfaktor ist. Da wäre eine offene Kita-Rechnung hilfreich.
Man könnte die Sache auch viel grundsätzlicher ansehen: Wissenschaftlich gesehen ist die frühe Kindheit die wichtigste Bildungsphase. Gute Rahmenbedingungen sind daher unverzichtbar. Wenn die Eltern diese aus ökonomischen Gründen nicht garantieren können, braucht es staatlich finanzierte und qualitativ gute Institutionen wie die Schule. Von dem her gibt es gute Gründe, die Kitas kostenfrei und mit gut ausgebildeten Personal anzubieten wie das die skandinavischen Länder es machen.
Bildung funktioniert nur bei guter, stabiler Bindung – das menschliche Nervensystem ist erst mit sieben Jahren vollständig ausgereift, vorher braucht es beständige Ko-Regulation von einem ausreichend gesunden, entspannten, erwachsenen Nervensystem (korrekte Spiegelung der Emotionen, zeitnahe, korrekte Befriedigung der Grundbedürfnisse, Körperkontakt etc.), Stillen ist für die spätere Gesundheit bis etwa zum dritten Lebensjahr wichtig. Ohne Bindung keine Bildung. Ich kenne keine einzige Kita, die die genannten Bedingungen zufriedenstellend erfüllt.