Das «Entlastungspaket» belastet die Gesundheit
«PFAS sind in fast allen Lebensmittelkategorien drin. Es gibt also keine Entwarnung». So fasste «Tagesschau»-Sprecherin Monika Schoenenberger vor wenigen Tagen einen Beitrag über Lebensmittel zusammen, die auf Ewigkeitschemikalien überprüft wurden. Als Folge der Tests dürfen derzeit keine Fische aus dem Zugersee mehr verkauft werden.
Seit Monaten gibt es fast wöchentlich neue Meldungen: PFAS im Trinkwasser, PFAS in Baugruben, PFAS in Bratwürsten, PFAS in Milch und Käse, PFAS auf Sportplätzen, PFAS auf Kinderspielplätzen, PFAS im Schnee.
Bisheriges Fazit: Die Stoffe dürften viel weiter verbreitet sein als lange erhofft. Erstmals zeigte dies ein Forschungsteam um die damalige ETH-Forscherin Juliane Glüge 2020 auf. Heute ist klar: Die giftigen Stoffe finden sich in praktisch allen Industriezweigen, und wir kommen täglich mit ihnen in Kontakt. Etwa auch über beschichtete Take-Away-Becher, Shampoos, Wandfarbe, Backpapier, Velokettenschmiere, Imprägniersprays, Skiwachs oder WC-Papier. Das Problem dabei: Nicht alle Hersteller müssen angeben, dass ihre Produkte giftige Stoffe enthalten.
Zudem waren die Grenzwerte bisher auch aus Rücksicht auf die Hersteller vergleichsweise locker. Bruno Le Bizec ist Direktor des französischen Labors Laberca in Nantes. Dort erforscht er für die EU PFAS-Belastungen in Mensch und Umwelt.
Le Bizec sagte gegenüber «SRF Puls»: «Die Grenzwerte basieren zum Teil auf der von der EU berechneten tolerierbaren wöchentlichen Aufnahmemenge. Diese Grenzwerte berücksichtigen aber auch die realen Handlungsmöglichkeiten der Hersteller, damit nicht von einem Tag auf den anderen die Hälfte der Lebensmittel nicht mehr gesetzeskonform ist. Deshalb braucht die Umsetzung Zeit und geht Schritt für Schritt hin zu tieferen Grenzwerten.»
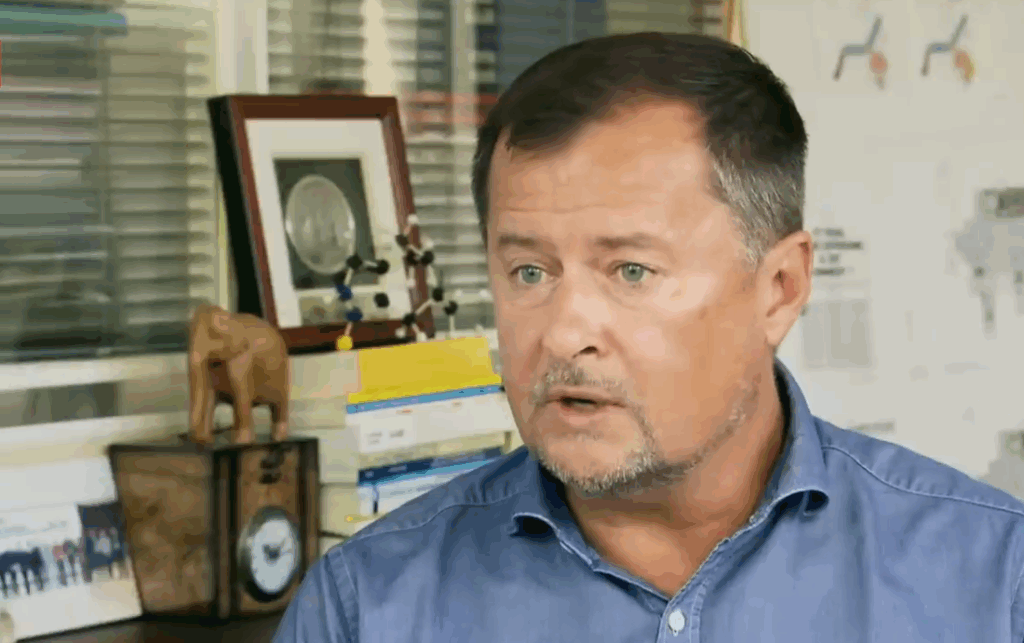
Die Schweiz orientiert sich dabei an der EU. Dass vermehrt zu hohe PFAS-Werte festgestellt werden, hat deshalb auch damit zu tun, dass wegen der strengeren Auflagen mehr kontrolliert wird.
Bund hält Vorsorgeprinzip ungenügend ein
Doch die Schweiz hat auf die Gefahr bisher ungenügend reagiert. Zu diesem Schluss kam letztes Jahr die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK). Sie hatte den Umgang des Bundes mit giftigen Stoffen, die meist krebserzeugend, erbgutschädigend oder fortpflanzungsgefährdend sind, untersucht.
Im EFK-Bericht steht, der Bund könne das aus der Verfassung abgeleitete Vorsorgeprinzip nur unzureichend umsetzen. Denn es fehlten Grundlagen, um das Ausmass des Vorkommens von problematischen Stoffen in der Umwelt und im Menschen umfassend festzustellen. «Um Vorkommen systematisch zu überwachen, braucht es ein Monitoringsystem. Es ist deshalb ein Mindestmass an Beobachtungsstrukturen aufzubauen, um frühzeitig besorgniserregende Konzentrationen zu identifizieren.»
Um die gesundheitlichen Risiken der PFAS-Belastung eingehender zu prüfen, lief zu diesem Zeitpunkt bereits ein ambitioniertes Forschungsprojekt. Fast 800 Menschen aus den Kantonen Bern und Waadt hatten Fragen zu ihrer Gesundheit beantwortet und biologische Proben abgegeben. Diese wurden auf 30 verschiedene Stoffe untersucht.
Die Zwischenresultate schreckten auf: Die Chemikalien liessen sich in fast allen Beteiligten nachweisen. Mehr als die Hälfte ihrer Blutproben wiesen Werte über der Unbedenklichkeitsgrenze auf. Bei etwa vier Prozent waren sie gar besorgniserregend. Und dies, obschon die zwei am häufigsten gefundenen Substanzen, PFOS und PFOA in der Schweiz bereits verboten waren. Ein Zusammenhang zwischen PFOA und Nierenkrebs und Hodenkrebs gilt als erwiesen.
BAG-Expertin: Dringliches Handeln angezeigt
Die beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) verantwortliche Chemikerin Natalie von Götz sagte zu den Studienresultaten in der Sendung «SRF Puls» im Februar 2024: «Wenn man jetzt nichts tut, wird es immer mehr werden, und dann kommen sicherlich auch gesundheitliche Effekte.»

Und ETH-Professor Martin Scheringer sagte dazu vor wenigen Monaten in den Tamedia-Zeitungen: «Von den Teilnehmenden dürften einzelne tatsächlich wegen PFAS Krankheiten entwickeln.»
Mit einer grossen Gesundheitsstudie, welche weitere vom Parlament beschlossene Forschungsmassnahmen abdecken sollte, wollte das BAG mögliche Zusammenhänge zwischen PFAS und Krankheiten, menschlichem Verhalten oder bestimmten Biomarkern im Blut untersuchen.
Der Bundesrat wollte das auch. Basierend auf den Vorarbeiten entschied die Regierung noch im Juni 2023, die Machbarkeit einer grossen Biomonitoring-Studie mit 100’000 Probandinnen und Probanden eingehend prüfen zu lassen.
Doch vor eineinhalb Monaten folgte der Knall. Die «Tagesschau» berichtete darüber, dass die Vorarbeiten zur grossen Studie gestoppt worden waren. Dies hatte der Bundesrat wenige Tage zuvor auf eine Anfrage von Nationalrätin Manuela Weichelt (Grüne) mitgeteilt.
Vom BAG hiess es damals vage, der Entscheid sei «angesichts der angespannten finanziellen Lage des Bundes» und «in Absprache mit dem Innendepartement (EDI)» getroffen worden.
BAG hielt Entscheid monatelang unter dem Deckel
Nun zeigen Infosperber-Recherchen, dass Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, Vorsteherin des Innendepartements (EDI), die wichtigen Forschungsbemühungen bereits über ein halbes Jahr zuvor – im Februar 2025 – einstellte. Gemäss einer Informationsnotiz, die Infosperber mit Verweis aufs Öffentlichkeitsgesetz einsehen konnte, tat sie dies auf Antrag aus dem BAG. Der Bundesrat wurde erst zwei Monate später darüber informiert. Und öffentlich wurde es nochmals fünf Monate später.

Auf Anfrage schreibt das BAG: «In Anbetracht des Entlastungspakets wurde die Erfolgsaussicht eines Finanzierungsantrags für die Gesundheitsstudie als zu gering angesehen, um einen solchen Antrag vorzubereiten.»
Die Studie wäre gemäss BAG zwar tatsächlich teuer. Aufbau und Unterhalt einer sogenannten Biobank, welche den Gesundheitszustand der Schweizer Bevölkerung repräsentativ abbilden würde, würden die Schweiz über die kommenden 20 bis 30 Jahre maximal zwölf Millionen Franken pro Jahr kosten, wobei auch günstigere Varianten für höchstens fünf Millionen Franken denkbar wären. Zur Einordnung: Die Schweiz entrichtete letztes Jahr Subventionen von über 14 Millionen Franken an Tabakbauern.
In den Dokumenten listet das BAG zudem auf, weshalb die Schweiz eine solche Studie bräuchte:
- Die Schweiz hat zu wenige qualitativ hochwertige Gesundheitsdaten, als dass sie Interventionen effizient planen und gute Gesundheitsforschung betreiben könnte.
- Die Schweiz bräuchte für den Krisenfall eine verfügbare Infrastruktur, um schnell Daten zu erheben. Dies hätten die Verzögerungen während der Corona-Pandemie gezeigt.
- Die Studie würde evidenzbasierte politische Entscheide unterstützen, etwa bei der Evaluation regulatorischer Massnahmen.
«Entlastungspaket» wirkt belastend
Brisant ist deshalb: Indem das BAG und Baume-Schneider die Arbeiten an der Gesundheitsstudie stoppten, übten sie sich in vorauseilendem Gehorsam. Und die flächendeckenden, mit «Opfersymmetrie» begründeten bundesrätlichen Sparbemühungen entfalten auch eine abschreckende Wirkung – in diesem Fall gar mit Gesundheitsrisiken.
Das sogenannte «Entlastungspaket» des Bundesrats ist heftig umstritten. Wie der Vernehmlassungsbericht zeigt, sind zahlreiche Massnahmen, insbesondere im Forschungs- und Bildungsbereich, äusserst schwach abgestützt. Die einzelnen Kürzungen müssen erst noch vom Parlament beschlossen werden. Die Sparübung wurde ursprünglich als Überprüfung unnötiger Subventionen verkauft. Die Kürzung von Forschungsausgaben war nicht Ziel der Übung (Infosperber berichtete).
Wegen Aufrüstung: Kürzungen für die Forschung
Die vom Bundesrat beauftragte Expertengruppe um Serge Gaillard weitete den Auftrag aber aus. Sie nahm gleich auch eine «ausgabenpolitische Gesamtschau» vor. So wollte sie auch bei der Ressortforschung sowie den Bundesbeiträgen an Hochschulen und Nationalfonds Ausgaben kürzen. Dies, obschon Gaillard selber sagte, die Finanzlage sei «nicht besonders dramatisch».
In ihrem Bericht hielt sie fest, Kürzungen bei der Forschung seien zwar «aufgrund der Beurteilung gemäss dem Prüfraster der Expertengruppe nicht begründbar.» Aber wenn weiterhin politischer Konsens darüber bestehe, dass die Armeeausgaben bis 2035 auf ein Prozent des Bruttoinlandproduktes erhöht werden sollen und dafür keine «einnahmenseitigen Massnahmen» ergriffen würden, sei «eine umfassende Priorisierung über sämtliche Ausgaben angezeigt.»
Gleichzeitig gab die Gruppe an, ihren Kernauftrag nicht vollständig umgesetzt zu haben. So wurden landwirtschaftliche Subventionen nicht im Hinblick auf mögliche biodiversitätsschädigende oder andere negative Umwelteffekte geprüft. Dabei waren Forschende der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) bereits 2020 im zum Schluss gekommen, dass mindestens 15 Milliarden Franken Subventionen die Biodiversität schädigen während Bund, Kantone und Gemeinden wiederum gut eine Milliarde Franken für biodiversitätsfördernde Massnahmen ausgeben.
Bundesrat hält an Kürzungen für die Wissenschaft fest
Seit diesem ersten Bericht ist einige Zeit vergangen und einzelne besonders unpopuläre Massnahmen wie etwa Kürzungen bei den J+S-Beiträgen wurden wieder rückgängig gemacht.
Doch in der Botschaft, welche er dem Parlament für die anstehende Debatte während der Wintersession präsentierte, hält der Bundesrat an den umstrittenen Kürzungen für die Wissenschaft, welche auch Grund für die Einstellung des Biomonitoring-Projekts sein dürften, fest: bei der eigenen Ressortforschung, bei den projektgebundenen Beiträge an die Hochschulen, beim jährlichen Beitrag an den Nationalfonds. Dies obschon insbesondere die Kürzungen bei den Hochschulen juristisch höchst umstritten sind (Infosperber berichtete).
So hat die bürgerliche Mehrheit im Parlament, welche die Bundesfinanzen seit Jahren verantwortet, das letzte Wort. Das Kürzungspaket wird während der Wintersession im Ständerat debattiert. Im Frühling folgt der Entscheid des Nationalrats. Zuletzt hat sich das Parlament bei den Umweltchemikalien gegen mehr Gesundheitsschutz entschieden. So lässt es zu, dass mit PFAS belastetes Fleisch weiter verbreitet wird. Und ist auf bestem Weg, den Gewässerschutz weiter zu schwächen, obschon er bereits heute den Anforderungen des Bundes nicht genügt.
Parlament könnte «Katastrophe» verhindern
Dem ambitionierten Projekt einer nationalen Gesundheitsstudie droht damit Schiffbruch. Eine Fortsetzung des nationalen Projekts durch private Geldgeber und Forschungsinstitutionen ist derzeit nicht in Sicht.
Gemäss Studienleiterin Nicole Probst-Hensch, Professorin am Schweizerischen Tropen-Institut in Basel, unterstützt immerhin der Kanton Basel-Stadt die Weiterführung einer regionalen Kohorte in der Nordwestschweiz.
Hensch sagt, sie sehe als wissenschaftliche Beirätin der deutschen Kohorte, wie wichtig diese Langzeitdaten in vielerlei Hinsicht sind. Deutschland untersucht seit 2014 laufend über 200’000 Bürgerinnen und Bürger, die zu Beginn zwischen 18 und 69 Jahre alt waren. «Keine solche Infrastruktur zu haben, ist für die Schweizer Forschungslandschaft eine Katastrophe.»
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.










Wieso belasten wir das Monitoring nicht den Unternehmen? Die Unternehmen machen Mia. Gewinne und die Folge-Kosten bezahlt die Allgemeinheit. Das würde den Konsum von kritischen Produkten verteuern und den Konsum hoffentlich dämpfen. Wie kann man als Unternehmen Stoffe verkaufen ohne, dass je geschaut wird wie schädlich der Stoff ist. Und wenn dann der Verdacht aufkommt, muss der Geschädigte sich sein Recht mit viel Geld über viele Jahre erstreiten, falls er nicht vorher stirbt…und wenn es Tausende sind, dann muss dies jeder Einzelne tun! Super Wirtschaftssystem! Die Mehrheit der Volksvertreter finden dies richtig und die Mehrheit der Menschen in der Schweiz auch, weil sie könnten ja andere Politiker wählen! Dies ist nicht einfach, weil Transparenz fehlt meistens. Gut gibt es Infosperber, weil so hat jede Person die Möglichkeit darüber nachzudenken.
Danke an die Recherchierenden und Schreibenden, dass diese Thematik und der Umgang damit an die Öffentlichkeit kommt. Ich stelle mir dieselbe Frage wie M. Ursprung: «Warum wird die Politik nicht aktiv und macht Gesetze, welche die Inverkehrbringenden, also die Unternehmen, welche diese Stoffe herstellen und/oder in ihre Produkte einarbeiten, in die Verantwortung nehmen?». Dafür wäre eigentlich das Produktehaftpflichtgesetz, PrHG da. Nur wie sieht dieses aus? Die aktuelle Fassung stammt aus dem Jahre 1994, ist also gut 30 Jahre alt. Einer der längsten Artikel darin ist Art. 5 Ausnahmen von der Haftung. Der ist so formuliert, dass praktisch kein fehlbares Unternehmen schuldig gesprochen und bestraft werden kann. Bitte Politikerinnen und Politiker macht euch endlich an eure Arbeit!!!
Zwei an sich gute Vorschläge. Ich befürchte nur, dass, wenn die Verursacher die Studien bezahlen, sie plötzlich zu ihren Gunsten ausfallen….