Lateinamerika taumelt nach rechts

Nach einer über ein Jahrzehnt anhaltenden Phase linksreformistischer Politik haben in Lateinamerika ab 2015 wieder vermehrt neoliberale und ultrakonservative Kräfte an Einfluss gewonnen. Davon zeugt ein Sammelband, der im Verlag des in Buenos Aires erscheinenden «Le Monde diplomatique» (südamerikanische Version) sowie ein kürzlich verfasstes Hintergrundpapier des «Lateinamerika Forum Berlin». Beide Quellen stellen fest, dass rechtspopulistische und autoritäre Tendenzen auch in dieser Region verstärkt auftreten.
Argentinien: Entscheidende Wahl im Oktober
Als Bannerträger dieser restaurativen Bewegung tritt vor allem Argentiniens Präsident Javier Milei in Erscheinung. Mit seiner «Kettensägenpolitik» will er das Problem der galoppierenden Inflation und die gleichzeitige Wachstumskrise in den Griff bekommen und im einst reichen Land das Versagen der Vorgängerregierungen korrigieren. Doch volle 18 Monate nach seiner Machtübernahme beträgt die Teuerung immer noch zwischen 2 und 3 Prozent – monatlich! Dieser ständige Aderlass, gekoppelt mit der notorischen Zunahme der Arbeitslosigkeit hat zur Verelendung grosser Bevölkerungskreise geführt. Und dennoch: Ein grosser Teil der Bevölkerung steht weiter hinter Mileis Politik. Wie stark sein Rückhalt im Volk ist, wird sich bei den Zwischenwahlen im Oktober zeigen. Eine Bestandsaufnahme der britischen «BBC Mundo» analysiert, welche sozialen Sektoren unter Mileis ultra-neoliberaler Wirtschaftspolitik am schwersten leiden.
El Salvador: Bukele treibt Regierungskritiker in Exil
Weniger aus wirtschaftlichen als vielmehr aus innenpolitischen Gründen verfolgt Präsident Nayib Bukele im mittelamerikanischen Kleinstaat El Salvador ebenfalls einen harten Kurs. Sein Hauptanliegen gilt und galt dem Kampf gegen kriminelle Jugendbanden, Maras genannt, die es vor allem auf die wohlhabende Minderheit im Land abgesehen haben. Mit einer Politik der brutal harten Hand hat der 43-jährige Staatschef diese schwerwiegende Bedrohung inzwischen in den Griff bekommen. Spezialeinheiten haben Zehntausende Menschen ins Gefängnis gesteckt. Anfang 2023 wurde in El Salvador die weltweit grösste Haftanstalt eröffnet, wo bis zu 40’000 Menschen eingesperrt werden können.
Bukele erinnert mit seiner meteorartigen Laufbahn an Alberto Fujimori, der sich 1990 inmitten einer von linksradikalen Terroristen (Sendero Luminoso) heraufbeschworenen Staatskrise in Peru als «Retter in der Not» präsentierte und die Wahlen klar gewann. Auch er «räumte auf» – jedoch, wie es in der Geschichte Lateinamerikas schon oft geschah, fehlte es dem Sieger nicht an Ehrgeiz, seine Macht mit einem «Eigenputsch» zu zementieren. Heute findet selbst eine bürgerliche Zeitung wie die NZZ, dass Bukele autoritär herrsche und «seinen Repressionsapparat immer mehr auch gegen seine internen Kritiker benutzt». Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, die die Regierung kritisieren, bekommen Bukeles harte Hand zu spüren. Die «Deutsche Welle» berichtet, dass im letzten Monat rund 40 Journalisten aus Angst vor einer Verhaftung das Land verlassen mussten, weil Präsident Bukele sein Vorgehen gegen Kritiker verschärft hat.
Guatemala: Korruption bleibt ein Problem
Guatemala wird seit Januar 2024 verfassungsmässig vom sozialdemokratisch gesinnten Präsidenten Bernardo Arévalo regiert. Doch schon bald nach dessen Amtsübernahme wurde ein von rechter Seite orchestrierter Machtkampf entfesselt. Im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht die oberste Staatsanwältin Consuelo Porras. Monatelang hatte sie versucht, Präsident Arévalo den Einzug ins Amt zu verwehren, obwohl er mit grossem Vorsprung gewählt worden war. Unter ihrer Führung verlangt die lokale Justiz jetzt die Auslieferung von zwei hohen kolumbianischen Diplomaten, berichtet «BBC Mundo». Die beiden sollen laut Staatsanwaltschaft in den Korruptionsskandal um die brasilianische Baufirma Odebrecht verwickelt sein.
Nun ist aber weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus bekannt, dass Korruption in den meisten Ländern des Erdteils ein grosses Übel ist – nirgends jedoch so übel wie in Guatemala. Die angeklagten Kolumbianer hatten hohe Chargen in jener internationalen Kommission inne, die im Auftrag der Vereinten Nationen Nachforschungen über die Rolle der höchsten Organe der guatemaltekischen Justiz führen sollten. Acht Jahre lang konnte diese Gruppe angesehener ausländischer Juristen (CICIG) einen Fall nach dem anderen freilegen und mehrere ehemalige Staatspräsidenten wegen Korruption in höchsten Sphären hinter Gitter setzen. Der juristische Konflikt mit Kolumbien hat daher einen klaren innenpolitischen Hintergrund und kann als Racheaktion gewertet werden. Porras gilt als Schlüsselfigur im politischen Machtkampf zwischen den führenden oligarchischen Gruppen des Landes und der legitimen Herrschaft von Präsident Arévalo, seines Zeichens direkter Nachfahre des ersten 1945 glaubwürdig demokratisch gewählten Staatsoberhaupts von Guatemala.
Kolumbien: Tiefe Gräben in der politischen Landschaft
Ähnlich gelagert sind die Interessenverhältnisse in Kolumbien. Dort ist eine gemässigt linkspopulistische Allianz unter der Führung von Präsident Gustavo Petro im Amt. Ein kurzer Kommentar in der deutschen Tageszeitung «junge Welt» zeigt tiefe Gräben in der politischen Landschaft dieser über 52 Millionen Menschen zählenden Nation auf. Sie spalten nicht nur Rechte von Linken, sie ziehen sich bis tief hinein in die Reihen der linksextremen Opposition. Die ELN-Guerilla ist die älteste von einst fünf Rebellengruppen, und sie ist derzeit die einzige, die zum bewaffneten Kampf aufruft. Aber auch sie ist in zwei Teile zerfallen: die einen paktieren, des jahrzehntelangen Kampfes im Untergrund müde, mit der Regierung, während die anderen weiterhin an die Macht der Waffen glauben – wie seit den 1960er-Jahren ohne Unterbruch.
Die bürgerlichen Medien konzentrieren sich vor allem auf die Lähmung des reformistischen Willens der Regierung Petro, der als einstiger Guerillaführer elementare sozialpolitische Veränderungen herbeiführen möchte. Kolumbiens vereinigte Rechte, Liberale wie Konservative und erst recht die Ultras, legen Petro lieber Steine in den Weg, als einem Linken den geringsten Kredit zu gewähren.
Nicaragua: Herrscherpaar räumt Gegner aus
Lektionen von Politik der harten Hand werden auch in Nicaragua erteilt. Der frühere Chefkommandant der Sandinistischen Befreiungsfront FSLN, Daniel Ortega, teilt die Macht nur noch mit einer Person: seiner Gattin Rosario Murillo. Das Herrscher-Ehepaar geht den Weg zu einer autoritären Herrschaft unbeirrt weiter in der Überzeugung, sie beide verkörperten die wahren Werte des Sandinismo. Ortega und Murillo richten ihre repressive Kampagne gegen jegliche Opposition – selbst gegen ehemalige Waffenbrüder und -schwestern. Laut einem Bericht der «Deutschen Welle» wird dabei die Grenze zu Costa Rica, dem demokratischen Musterstaat der Region, immer häufiger überschritten.
So wurde in San José, der Hauptstadt von Costa Rica, ein ehemaliger Angehöriger der FSLN mit acht Kugeln niedergestreckt. Die Botschaft an die Zehntausenden «Nicas», die vor der Gewaltherrschaft des Ehepaars Ortega-Murillo ins friedliebende Nachbarland geflohen sind, ist unüberhörbar: Auch im Ausland können sie sich vor den Schergen des Regimes in Managua nicht mehr sicher fühlen. Die Botschaft richtet sich auch an Journalisten, Juristen, Geistliche und Studenten – an alle, die auf einen Umsturz in Nicaragua hoffen und dies öffentlich zum Ausdruck bringen.
Bolivien: Neuwahlen in schwerer Wirtschaftskrise
Je näher die allgemeinen Wahlen vom 17. August in Bolivien rücken, desto schwieriger gestaltet sich die wirtschaftliche und politische Situation im Land. In weiter Vergangenheit liegen die Zeiten des (bescheidenen) Wirtschaftswunders, das im Andenstaat eine Wende zum Besseren zu verheissen schien. Die Knappheit an ausländischen Devisen, an Treibstoff und teilweise auch an Grundnahrungsmitteln hat inzwischen ein dramatisches Ausmass erreicht. Ein detaillierter Bericht über die «Mehrfachkrise» in Bolivien liefert die «Deutsche Welle». Im Mai lag die Inflation bei 18,4 Prozent im Jahresvergleich – dem höchsten Wert seit fast 20 Jahren. Auch die Landeswährung Boliviano verlor zunehmend an Wert. Der Wechselkurs zum US-Dollar, der über ein Jahrzehnt lang bei 7 Bolivianos eingefroren war, wurde neu bei 15.60 fixiert. Ob damit grösseres Ungemach abgewendet wurde, unterliegt schweren Zweifeln. Trotz anhaltender Kritik lehnte der 61-jährige Regierungschef Luis Arce von der Partei «Bewegung zum Sozialismus» (MAS) einen Rücktritt bislang ab. Er kündigte jedoch an, bei der kommenden Präsidentschaftswahl im August nicht erneut kandidieren zu wollen.
Nach dem ökonomischen Desaster stellt sich kurz vor den Wahlen die Frage, wer Anspruch erheben könnte, der wahre Kandidat des Volkes zu sein. Die einst unzerbrechlich scheinende «Bewegung zum Sozialismus» ist tief gespalten und geschwächt. Als deus ex machina und «Einheitskandidat» der Linken bietet sich laut «Nueva Sociedad» Jungpolitiker Andrónico Rodríguez an, ein 36-jähriger Kokabauernführer und aktueller Senatspräsident, der in der MAS aktiv war. Parteigründer und Boliviens Ex-Präsident Evo Morales darf nach einer Entscheidung des Obersten Wahlgerichts bei den kommenden Wahlen nicht mehr antreten.
Brasilien: Ein Lehrstück in Realpolitik
Bei der Renaissance konservativer und neoliberaler Kräfte in weiten Teilen Lateinamerikas kann Brasilien nicht fehlen. Die wirtschaftlich und politisch unabhängige Nachrichtenplattform «Sumaúma» analysiert das politische Gezerre um ein Gesetzesprojekt, das die Zukunft der nationalen Umweltpolitik gründlich in Frage stellt – dies zu einem Zeitpunkt, wo sich Grüne aus aller Welt auf das nächste Gipfeltreffen COP30 vorbereiten, das just in Belém, also mitten im Amazonas-Urwaldgebiet stattfinden wird.
Der lange Artikel setzt gute Kenntnisse über die brasilianische Innenpolitik voraus, was es erschweren könnte, den Faden nicht zu verlieren. In grossen Zügen legt die Analyse Spuren von penibler Abhängigkeit frei. Sie zeigt auf, wie die Regierung von Lula da Silva sich verbiegt und von ihren Prinzipien abweicht, damit sie ihre zumeist brüchige Allianz mit rechtsgerichteten Parteien zusammenhalten und wichtige legislative Vorhaben im Kongress durchbringen oder – wie im geschilderten Fall – verhindern kann.
________________________________________________________________________
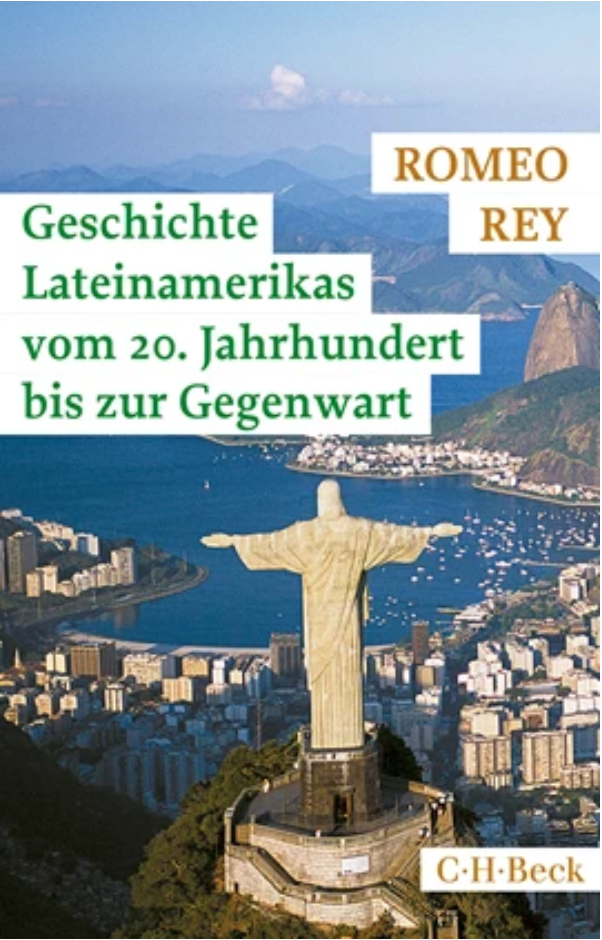
284 Seiten, 3. Auflage, C.H.Beck 2015, CHF 25.10
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine. Der Autor war 33 Jahre lang Korrespondent in Südamerika, unter anderem für den «Tages-Anzeiger» und die «Frankfurter Rundschau».
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.










Bei Mileis Amtsantritt (Dez 2023) lag die Monatsinflation bei ca. 25 %; seither ist sie auf 1,6 % im Juni 2025 gefallen. Für Herrn Rey scheint das und vieles andere nicht erwähnenswert. Sein Artikel betont berechtigte soziale Härten, lässt aber zentrale Makro‑Trends weg: massiv sinkende Inflation, historischer Haushaltsüberschuss, schrumpfende Armut, Aufschwung bei Produktion, Handel und Investorenzufriedenheit. Dadurch entsteht ein verzerrtes Bild, das den Übergangscharakter der Krise – nach Jahrzehnten chronischer Fehlsteuerung – unterschätzt und den bislang erreichten Kurswechsel unterschlägt. Eine seriöse Bilanz nach 18 Monaten muss sowohl die noch offenen Baustellen als auch die bereits messbaren Fortschritte berücksichtigen. Schade, dass es solcherlei ideologiegetriebene Artikel in den Infosperber schaffen.
Vielen Dank Hr. Lehmann, vielen Dank dass sie ihren Kommentar geschrieben haben, sonst hätte ich es machen müssen.