Kommentar
Juso-Initiative – es geht um die Demokratie, nicht um Jobs
Die Juso-Initiative fordert eine Steuer von 50 Prozent auf den Teil von Erbschaften, der 50 Millionen Franken übersteigt. Für die allermeisten kleineren und mittleren Unternehmen ist das kein Problem. Für etliche grössere Familienunternehmen hingegen schon. Ein Paradebeispiel dafür ist Stadler-Rail und dessen Grossaktionär Peter Spuhler, der 40 Prozent an der Firma mit einem Marktwert von rund 750 Millionen hält und der auch noch an einer Reihe kleinerer Unternehmen beteiligt ist. Insgesamt wird sein Vermögen auf 3,6 Milliarden Franken geschätzt.

Die genaue Zusammensetzung des Vermögens ist unbekannt. Nehmen wir einmal an, dass insgesamt 2,6 Milliarden Franken in mittelgrossen Familienunternehmen gebunden sind und sich die liquiden Mittel auf mindestens 500 Millionen Franken belaufen.
Drei Fragen
Nun stellen sich drei Fragen: Ist die Juso-Steuer so hoch, dass Superreiche ihren persönlichen Steuersitz ins Ausland verlegen? Wie bedrohlich sind die zu erwartenden Steuerausfälle? Und: Gefährdet der Abfluss von Liquidität die Jobs in den vom Erblass betroffenen Familienunternehmen?
Beginnen wir mit der dritten Frage. Dazu hat sich Peter Spuhler wiederholt so geäussert, dass es seinen Erben unmöglich wäre, bei Stadler-Rail die notwendigen Investitionen in die Forschung weiterhin zu finanzieren. Wirklich? Machen wir eine grobe Überschlagsrechnung: Stadler-Rail ist an der Börse 1,86 Milliarden Franken wert. Das Eigenkapital beläuft sich aber bloss auf 720 Millionen Franken, wovon Spuhler rund 300 Millionen hält. Wir können davon ausgehen, dass das Ausführungsgesetz zu einer eidgenössischen Erbschaftssteuer bei massgeblichen Beteiligungen vom Buchwert ausgeht und nicht vom Börsenwert. Folglich vererbt Spuhler im Falle von Stadler rund 300 Millionen Franken. Davon sind 50 Millionen Franken steuerfrei, und von den restlichen 250 Millionen fallen 125 an den Staat.
Die 125 Millionen entsprechen etwa 7,5 Prozent des Börsenwertes der Firma. Die Erben könnten die Steuer also etwa durch den Verkauf von eigenen Aktien finanzieren. Der Anteil der Spuhler-Dynastie an Stadler-Rail würde damit von rund 40 auf 32,5 Prozent sinken, ohne dass auch nur ein Franken aus der Firma entnommen werden müsste. Börsen dienen genau diesem Zweck: Eigentumsrechte an der Firma können verschoben werden, ohne dass der Firma Kapital entzogen wird. Zudem dürften den Erben auch noch etliche 100 Millionen an liquiden Mitteln zufliessen.
Stark übertrieben
Das zeigt: Die Drohung, dass eine Erbschaftsteuer viele Firmen zwingen könnte, sich ans Ausland zu verkaufen, wodurch viele Arbeitsplätze verloren gingen, zumindest stark übertrieben ist. Die Schweiz gilt im internationalen Vergleich weiterhin als sehr guter Standort. Eine ganze Produktion zu verlegen, ist eine teure und riskante Sache. Und warum soll man die ganze Belegschaft verlagern, wenn der Besitzer die Steuer dadurch vermeiden kann, indem er oder sie selbst auswandert?
Nächste Frage: Ist die Steuer so hoch, dass sie den Erblasser zur Steuerflucht bewegen könnte? Spuhler hat diese Frage wiederholt bejaht und die zu erwartende Steuer mit rund 1,5 Milliarden Franken beziffert. Das ist sehr hoch gegriffen. Wie erwähnt dürfte bei massgeblichen Beteiligungen (vermutlich ab 10 Prozent) vernünftigerweise nicht der meist stark aufgeblasene Marktpreis für die Steuer massgeblich sein, sondern der effektive Buchwert. Dieser ist bei mittelgrossen Unternehmen wie Stadler-Rail oder Rieter nur etwa halb so hoch. Bei Grossunternehmen wie etwa Nestlé ist der Unterschied noch viel grösser. Aber klar: Auch eine Erbschaftssteuer von «bloss» 100 Millionen Franken könnte ein Grund zur Steuerflucht sein.
Die Treulosen werden untreu
Bleibt die Frage, wie schmerzlich die zu befürchtende Abwanderung von Superreichen für die normalen Steuerzahler ist. Im Einzelfall kann dies in der Tat sehr weh tun. Nehmen wir den aktuellen Fall der luzernischen Gemeinde Meggen, die sich bisher erfolgreich darauf spezialisiert hat, anderen Gemeinden, Kantonen und Ländern die guten Steuerzahler abzujagen. Als Folge davon ist die Finanzkraft Meggens pro Steuerzahler (gemessen an der allgemeinen Bundessteuer) mehr als dreimal mal so hoch wie im eidgenössischen Mittel. Nun hat der Gemeindeammann gegenüber der «Luzerner Zeitung» gesagt, «dass zahlreiche potenziell von der Juso-Initiative betroffene Personen im Fall einer Annahme bereits im Dezember wegziehen würden». Die Treulosen werden auch Meggen untreu. Wen wundert’s?
Solche Einzelfälle werden von den Medien gerne aufgegriffen und vermitteln ein falsches Bild. Doch auch beim Versuch, das Thema auf der nationalen Ebene zu beleuchten, wird oft mit falschen Zahlen operiert. Etwa im «Tages-Anzeiger». Obwohl laut Abstimmungsbüchlein nur etwa 0,6 Promille aller Steuerzahler direkt betroffen wären, geht der «Tagi» in einem Leitartikel ohne weitere Begründung davon aus, dass sich viel mehr vor der Steuer fürchten. Er macht folgende Rechnung auf: «Die fünf Prozent der Steuerpflichtigen mit den höchsten Einkommen generieren zwei Drittel der direkten Bundessteuer und 87 Prozent der Vermögenssteuer.» Und schliesst daraus: «Bereits heute finanzieren also die Reichsten einen grossen Teil des Staates.»
Kein berauschender Wert
Das ist stark übertrieben. 87 Prozent der Vermögensteuer sind nur etwa 8 Milliarden Franken. Zwei Drittel der direkten Bundessteuer sind ebenfalls rund 8 Milliarden. Macht 16 Milliarden. Hochgerechnet auf aktuelle Werte von 2024 sind das rund 17,5 Milliarden oder rund 10 Prozent aller Staatsausgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden. Gemessen daran, dass diese 5 Prozent mehr als einen Viertel aller steuerbaren Einkommen beanspruchen, ist das kein berauschender Wert.
Gewiss: Diese reichsten 5 Prozent beziehungsweise 0,6 Promille zahlen zwar auch kommunale und kantonale Steuern, aber in Steueroasen wie Zug oder Ob- und Nidwalden, wo die Sätze viel tiefer sind als in der übrigen Schweiz. Sie zahlen zwar auch Mehrwertsteuer, doch weil sie nur einen Bruchteil ihres Einkommens konsumieren können, ist auch diese Belastung klar unterdurchschnittlich. Und vor allem: Die Einkommen der Reichen bestehen überwiegend aus Kapitaleinkommen., die nur sehr mässig besteuert werden.
Augenwischerei
Was das praktisch bedeutet, hat die Konjunkturforschungsstelle in einer Studie am Beispiel eines in Zug lebenden «Mustermillionärs» aus den reichsten 0,1 Prozent der Steuerzahler vorgerechnet. Ergebnis: «Die Einkommenssteuer von Max Muster reduziert sich so auf 3,9 Prozent.» Auch wenn man die 215’000 Franken Vermögenssteuer auf seinen 83 Millionen Franken berücksichtigt, steigt der Steuersatz bloss auf 7,4 Prozent. Eine halbwegs «normale» Steuerbelastung erreicht Max Muster nur, wenn er – wie etwa auch Peter Spuhler – die Gewinnsteuern seiner Unternehmen dazu rechnet. Doch das ist Augenwischerei. Mit der Gewinnsteuer bezahlt das Unternehmen die von ihm beanspruchten staatlichen Leistungen. Volkswirtschaftlich gesehen, werden die entsprechenden Kosten auf die Kunden abgewälzt.
Dass die Unternehmen eine derart privilegierte Behandlung geniessen, ist Ausdruck der Macht, die sie nicht zuletzt dank ihrer Wegzugsdrohungen auf die Politik und auf die Medien ausüben. Das zeigt sich auch bei der Diskussion um die Juso-Initiative – die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit abgelehnt wird. Doch je tiefer die Steuern für die «Mustermillionäre» , desto mehr wächst ihre Macht. Bei der Erbschaftssteuer geht es somit nicht nur um die Staatsfinanzen, sondern auch um die Demokratie. Dieses Problem muss auch nach der Ablehnung der Juso-Initiative weit oben auf der politischen Agenda stehen.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





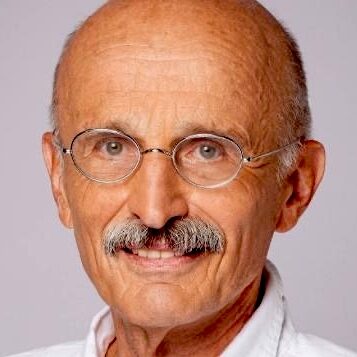



Diese JUSO-Initiative dürfte nur begrenzte Wirkung entfalten. Grosse Vermögen werden häufig über intern. Gesellschafts-, Stiftungs- oder Truststrukturen organisiert. Dadurch kann die wirtschaftliche Berechtigung rechtlich und operativ von der tatsächlichen Nutzung getrennt werden, was zu einer reduzierten Transparenz sowie zu erheblichen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten führt.
Ein oft genanntes Beispiel ist der US-Bundesstaat South Dakota, der Trust-Konstruktionen mit unbefristeten Laufzeiten sowie weitreichende Geheimhaltungsbestimmungen vorsieht. Diese Rahmenbedingungen können dazu beitragen, Vermögen über Generationen hinweg ausserhalb des Zugriffs bestimmter nationaler Regelungen zu halten.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie wirkungsvoll die Juso-Initiative ist. Wirkungsvoll ist sicher Herr Spuhlers Jammern, doch denke ich, dass er auch im Offshore-Bereich Gesellschaften hält, wenn nicht, dann ist er eine löbliche Ausnahme, was mich überraschen würde!
Wird diese Initative abgelehnt liess sich eine Mehrheit wieder in’s Bockshorn jagen.
Ja, es geht um Demokratie: Soll das Geld der Reichen bestimmen oder die Menschen? Die Abstimmung wird zeigen welcher Anteil für Demokratie einsteht und welcher Anteil sich lieber Dominieren lässt.
Laut Wikipedia hat Herr Spühler 3 Kinder. Wenn sie die einzigen Erben sind, erhält jedes 100 Mio. 50 Mio davon sind der Freibetrag, Bleiben für jeden der 3 Erben 50 Mio, von denen die Hälfte die geplante Erbschaftssteuer wäre. Jeder bezahlt also 25 Mio. Erbschaftssteuer, und der Staat erhält zusammen 75 Mio CHF. Herr Spühler könnte ja auch seine Belegschaft als Erben einsetzen. Beispielsweise 3 vertraute Personen aus der Geschäftsleitung. Der Staat ginge dann leer aus, und das Geld bliebe in privaten Händen. Aber immerhin wäre das unsinnige gigantische persönliche Vermögen etwas besser verteilt. Dass mehrere Erben bestehen könnten, wird in der Argumentation konsequent verschwiegen..
Die Anzahl der Erben spielt bei dieser Nachlasssteuer keine Rolle. Entscheidend – für die 50 Mio Limite – ist die allein die Höhe der Hinterlassenschaft.
Ihre Berechnung beruht auf dieser Prämisse:
«Wir können davon ausgehen, dass das Ausführungsgesetz zu einer eidgenössischen Erbschaftssteuer bei massgeblichen Beteiligungen vom Buchwert ausgeht und nicht vom Börsenwert.»
Wieso können wir davon ausgehen? Wo steht das?
Zurzeit werden Aktien von grösseren (kotierten) Firmen in meiner Steuererklärung zum Börsenwert besteuert.
Das hängt vermutlich damit zusammen, dass Sie an diesen Firmen keine massgebliche Beteiligung besitzen.
Zur Frage, wo das steht? Nirgends. Das entsprechende Erbschaftssteuer-Gesetz müsste erst noch geschrieben werden. So funktioniert unser Demokratie: Erst schreibt das Volk die Verfassung, dann macht das Parlament das Gesetz.
Ich wünschte mir, dass Spuhler nach Österreich zieht. Es würden keine Erbschaftssteuern anfallen, jedoch beim Gehalt (bis zu 50 % und den Dividenden 27,5 % Kest.) einen schönen Batzen an das Finanzamt abliefern. Die Quelle lautet: https://www.raisin.com/de-at/steuer/kapitalertragsteuer/
Er wird dann ganz gerne wieder zurückkommen wollen.
Wie immer bei SVP Politikern, viel heisse Luft und Fakenews verbreiten. Da machen auch die Multimilliardäre keine Ausnahme.
Die allermeiste der Reichen und der Firmenchef’s wissen ganz genau, dass sie steuerlich in der Schweiz ausgezeichnet fahren. Im Vergleich und Gegensatz zum Ausland. Nicht mal heisse Luft sondern maximal ein laues Lüftelin der Gegenerschaft. Man könnte meinen, es gehe ihnen an’s Lebendige.