Der Fight um Open-Source ist geopolitisch entbrannt
Red. Als Vizekanzlerin im Bundeshaus von 1991 bis 2005 leitete die Autorin verschiedene Digitalisierungsprojekte. Nach der Pensionierung engagierte sie sich ehrenamtlich für die Digitalisierung im Bildungsbereich. Heute analysiert Hanna Muralt Müller Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz in ihren Newslettern.
Trumps Politik fördert in den europäischen Staaten Bestrebungen zu grösserer Unabhängigkeit von Big Tech. Microsoft reagierte darauf mit einer Charme-Offensive. Gleichzeitig löste das chinesische DeepSeek Anfang Jahr eine Open-Source-Welle aus, nicht nur in den USA, auch in China. Europa, das seit längerer Zeit Open Source als Alternative zu den geschützten, proprietären US-Angeboten von Big Tech fördert, wird von den chinesischen Open-Source-Erfolgen übertrumpft.
Microsoft gehorchte Trump und verunsichert Europa
Auf Anordnung von Präsident Trump sperrte Microsoft im Februar 2025 den Account von Karim Khan, Generalstaatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs, da dieser Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister verhängte. Die US-Zeitung Politico vom 4. Juni 2025 arbeitete diesen Vorfall auf, dies mitsamt Microsofts Erklärung, dass diese Massnahme in keiner Weise die Einstellung der Dienste für den Internationalen Strafgerichtshof beinhaltete. In Europa schürte dieser Vorfall die Bedenken wegen zu grosser Abhängigkeit von Big Tech.
Wie das US-Online-Nachrichtenportal TechCrunch im März 2025 berichtete, gelangten rund hundert europäische Tech-Unternehmen in einem offenen Brief an die EU-Kommission und forderten griffige Massnahmen zur Förderung der digitalen Souveränität Europas. Trump könne die Big Tech unter Umständen sogar zwingen, in Europa die digitalen Dienste abzuschalten. Europa will deshalb seine Abhängigkeit von den proprietären Modellen reduzieren und setzt auf Open Source (siehe Infosperber vom 28.1.2025).
Microsoft hat auf die Verunsicherung bei den europäischen Partnern reagiert. Bereits am 30. April 2025 versprach der Microsoft-Konzern auf seiner Homepage, das Unternehmen würde alle Massnahmen, auch juristische, ergreifen, falls der Konzern gezwungen würde, die digitalen Dienste in Europa abzuschalten. Die sei jedoch sehr unwahrscheinlich.
Zudem beruhigte der Konzern, er werde das Backup seines Quellcodes in einem sicheren Depot in der Schweiz platzieren, auf den die europäischen Partner zugreifen könnten: «We will store back-up copies of our code in a secure repository in Switzerland, and we will provide our European partners with the legal rights needed to access and use this code if needed for this purpose».
Sputnik-Schock mit DeepSeek
Es war das chinesische DeepSeek, das Anfang 2025 mit seinem Open-Source-Modell so etwas wie den Sputnik-Schock in KI ausgelöst hat. Dieses Tool kann seit Januar kostenlos zur Weiterentwicklung auf Hugging Face heruntergeladen werden. Es kann mit den besten proprietären US-Sprachmodellen mithalten, obwohl es mit einem Bruchteil der Kosten entwickelt wurde und ihm wegen der Exportbeschränkungen der USA keine Chips zur Verfügung standen, die auf dem neusten technischen Stand sind. Das Tool sei zudem wesentlich energieeffizienter und verursache im Betrieb rund fünf Prozent der Kosten für ChatGPT (siehe Infosperber vom 28.1.2025).
DeepSeek hat viel Aufsehen erregt und rückte ins Zentrum, dass sich in China ein ganzes KI-Ökosystem auf Open-Source-Basis entwickelt hat. Es ist offensichtlich, dass in China die Open-Source-Bewegung mit einem Vorfall im März 2023 zusammenhängt. Wie die Medien (zum Beispiel The Verge vom 8.3.2023) berichteten, wurde das leistungsstarke KI-Sprachmodell Llama von Meta geleakt. Als Open Source wurde das Sprachmodell vorerst selektiv der Forschung zur Verfügung gestellt, um deren Expertenwissen für die Verbesserung zu nutzen. Die britische Technologie-Nachrichten-Website The Register vermutete bereits im März 2023, dass ein Forscher, der Zugang zum Modell erhielt, es auf eine Plattform stellte, die ihm volle Anonymität bot. Die Open-Source-Community stürzte sich weltweit sofort auf das Tool. China war besonders rasch und erfolgreich in seiner Nutzung.
Offen ist, wieweit Meta mit diesem Expertenwissen vor allem auch seinen Rückstand auf das bereits erfolgreiche ChatGPT wettmachen wollte. Jedenfalls kritisierten zwei US-Senatoren, wie das US-Tech-Nachrichtenportal VentureBeat im Juni 2023 berichtete, die fehlende Risikobewertung bei der Freigabe für die Forschung. Meta könnte hierin vor allem eigene Interessen haben: «While Meta has described the release as a leak, its chief AI scientist has stated that open models are key to its commercial success».
Wie Reuters bereits im Mai 2024 berichtete, stellte die Beijing Academy of Artificial Intelligence, ein hochrangiges auf KI spezialisiertes Forschungslabor in Peking, fest, dass die Mehrheit der in China entwickelten KI-Modelle auf dem Llama von Meta aufbaue. Ein längerer Artikel im englischsprachigen Hongkonger Nachrichtenportal Asia Times vom 13. Februar 2025 leuchtete im Zusammenhang mit DeepSeek die chinesische Open-Source-Strategie näher aus. Nicht zuletzt wegen der Exportkontrollen, mit denen die USA Chinas KI-Entwicklung auszubremsen versuchten, setzte das Reich der Mitte auf eine Open-Source-Strategie. Es gelang der chinesischen Regierung, in Zusammenarbeit von Universitäten, grossen Tech-Unternehmen, darunter Alibaba, Huawei und Tencent, sowie Start-ups ein blühendes KI-Ökosystem aufzubauen.
Gemäss dem gemeinnützigen US-Think-Tank Information Technology & Innovation Fondation ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis China die USA in KI einholt, wenn nicht sogar übertrifft. Insbesondere seien rund um die Tsinghua University in Peking eine Reihe innovativer Start-ups entstanden.
Open Source erschreckt Big Tech
Die Erfolge der Open-Source-Strategie in China haben in den USA zu einer Kehrtwende geführt. Die Vorteile offener Modelle, die mit dem Expertenwissen einer globalen Community weiterentwickelt werden können, sind offensichtlich. Der CEO von OpenAI, Sam Altmann, hielt bereits im Januar 2025 fest – so berichtete VentureBeat –, dass seine Firma in der Open-Source-Debatte auf der falschen Seite der Geschichte stand und eine Open-Source-Strategie entwickeln müsse: «I personally think we have been on the wrong side of history here and need to figure out a different open source strategy». Dies ist eine bemerkenswerte Abkehr vom zunehmend proprietären Ansatz, den OpenAI – ursprünglich ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen – mit der Aufnahme von Investorengeldern einschlug.
Gemäss Business Insider vom 19. Mai 2025, einer US-Nachrichtensite, brachte der weltweit bekannte US-Wagniskapitalgeber Marc Andreessen die neue Sachlage auf den Punkt. Seiner Ansicht nach könnte sich Open Source zum globalen Standard entwickeln. Die USA müssten deshalb ein führendes Open-Source-Modell entwickeln, damit nicht die ganze Welt – einschliesslich USA – auf chinesischer Software laufe.
China übertrumpft Europa in Open Source
DeepSeek verschärfte auch in China den Wettbewerb der Tech-Firmen und löste gleichzeitig eine Open-Source-Welle aus.
- Wie die britische Agentur Reuters berichtete, nahm Alibaba in Anspruch, mit seiner bereits Ende Januar 2025 veröffentlichten neuen Version von Qwen2.5 das Konkurrenzprodukt DeepSeek zu übertreffen.
- Baidu kündigte im Februar laut Reuters seine neue Ernie 4-5-Serie an, die künftig als Open Source zur Verfügung stehen soll.
- Andere Tech-Firmen mit proprietären Sprachmodellen wurden gezwungen, die Preise zu senken, so zum Beispiel auch Tencent, wie Reuters Ende Februar berichtete.
- DeepSeek verschärfte inzwischen die Konkurrenz mit den USA und innerhalb von China mit seinem ersten Update, so Reuters Ende Mai 2025.
Dies sind nur einige Beispiele – unerwähnt bleiben hier die zahlreichen Start-ups, die sich rund um die Tech-Riesen entwickelten.
Chinesische Sprachmodelle genügen EU-Vorgaben nicht
Allerdings gibt es einige Negativpunkte, die die Verbreitung chinesischer Open-Source-Modelle zumindest in Europa behindern. Diese Sprachmodelle stehen zwar zur Weiterentwicklung unentgeltlich zur Verfügung, aber – wie bei anderen Modellen, zum Beispiel jenen von Meta – wurden die Trainingsdaten und die Architektur nicht offengelegt. Sie sind deshalb nur halbwegs Open Source. Wegen dieser fehlenden Transparenz genügen diese Modelle den Vorgaben im AI Act der EU nicht. Dieser verlangt von Sprachmodellen (General Purpose AI, GPAI) volle Transparenz und auferlegt den Betreibern Rechenschaftspflichten.
Grosse Bedenken wecken auch der mangelnde Datenschutz und die Speicherung der Daten in China. Wie Reuters bereits im Februar 2025 berichtete, befasste sich die EU-Datenschutzbehörde umgehend mit DeepSeek – ohne gleich wie Italien (so Reuters am 4.2.2025) die Nutzung von DeepSeek zu blockieren. Undurchsichtig ist auch, was China mit den mit DeepSeek anfallenden Daten ausspioniert. Bedenken zur nationalen Sicherheit werden geltend gemacht, um die Nutzung in verschiedenen Ländern, vor allem auch in den USA, einzuschränken. Sustainable Tech Partner, die US-Plattform einer Community für Green-IT-Dienstleister, veröffentlichte am 11. Mai 2025 eine beachtlich lange Liste dieser Einschränkungen.
Es ist insofern von Bedeutung, dass bei den vorliegenden Open-Source-Modellen die Trainingsdaten und weitere wichtige Parameter nicht bekannt sind. Wie Jensen Huang, CEO von Nvidia, der wichtigsten Firma für Computer-Chips, bereits im Business Insider vom Februar letzten Jahres festhielt, kodifizieren KI-Sprachmodelle die Traditionen, Werte und die Kultur eines Landes. Die EU und auch die Schweiz sind deshalb daran, eigene Open-Source-Sprachmodelle, fokussiert auf die europäischen Sprachen, zu entwickeln (siehe Infosperber vom 28.1.2025).
Europa möchte unabhängiger werden – aber so einfach ist dies nicht
China war gezwungen, in Innovationen zu investieren. Europa dagegen konnte sich mit der Nutzung der US-Modelle gut einrichten. Wie sich nun zeigt, ist es für Europa nicht so einfach, sich unabhängiger von diesen so praktischen US-Angeboten zu machen. Wie euronews – ein von der EU finanziell unterstützter Fernsehsender – am 12. Juni 2025 informierte, wandten sich die beiden grössten Städte in Dänemark, Kopenhagen und Aarhus, bereits von Microsoft ab, ebenso das deutsche Bundesland Schleswig-Holstein. Für öffentliche Verwaltungen gibt es bereits geeignete Open-Source-Anwendungen, zum Beispiel openDesk. OpenDesk wurde von einer Open-Source-Community entwickelt, wobei das Zentrum für digitale Souveränität (ZenDiS) in Deutschland als Anlauf- und Koordinierungsstelle wirkt.
Aber, wie das deutsche Handelsblatt am 11. Juni 2025 mitteilte, setzt die Bundeswehr trotz scharfer Kritik für die nächsten zehn Jahre weiterhin auf das Cloud-System von Google und SAP (weltweit tätiger Softwarekonzern mit Sitz in Baden-Württemberg). Das Leistungsvermögen der grossen US-Firmen und der Innovationsrückstand europäischer Anbieter schaffen Realitäten. Immerhin verfolge die Bundeswehr eine Multi-Cloud-Strategie und die Truppe könne auf verschiedene Cloud-Dienste, darunter auch auf Open-Source-Lösungen, zurückgreifen.
Open-Source im Aufwind – proprietäre Modelle bleiben
Die Pluspunkte für nicht-öffentliche proprietäre Modelle sind beachtenswert. Sie sind leistungsstark mit professionellem Support, regelmässigen Updates, integrierten Schutzmechanismen und einfach in der Nutzung.
Aber auch Open-Source-Modelle werden von einer Community laufend weiterentwickelt und können – ein grosser Vorteil – flexibel an die je spezifischen Anforderungen einer Anwendung angepasst werden. Zudem muss für Schutzmassnahmen und regelmässige Updates vorgesorgt werden. Dies setzt grösseres technisches Knowhow – meist spezielles IT-Expertenwissen – voraus.
Ein Nachteil: Open-Source-Modelle erleichtern Kriminellen betrügerische Machenschaften. Immerhin wacht eine weltweite Community über Sicherheitslücken und identifiziert möglichst rasch vermeintlich vertrauenswürdige, von Cyberkriminellen umgestaltete Open Source-Anwendungen.
Eine gute Übersicht zu den Vor- und Nachteilen von Open Source im Vergleich mit proprietären Systemen bietet die globale Newsplattform PYMNTS Newswire mit physischen Niederlassungen in Boston, Chicago und Buenos Aires.
Die rund hundert europäischen Tech-Unternehmen, die, wie eingangs erwähnt, in einem offenen Brief an die EU-Kommission Massnahmen für eine grössere digitale Souveränität forderten, wollen aussereuropäische Firmen nicht ausschliessen. Aber sie verlangen für Open Source gleichlange Spiesse. Das US-Online-Nachrichtenportal TechCrunch vom März 2025 zitiert aus dem Brief wie folgt: «The aim is not to exclude non-European players, but to create space where European suppliers can legitimately compete (and justify investment».
Die EU-Kommission sagt, für sie sei der konkrete Anwendernutzen bei der Wahl zwischen Open Source und proprietären Modellen entscheidend. Sie schreibt in ihrer Open-Source-Strategie im Absatz «Equal treatment in procurement»: «This means that open source solutions and proprietary solutions will be assessed on an equal basis, being both evaluated on the basis of total cost of ownership, including exit costs».
Charme-Initiative von Microsoft
Microsoft kennt die Präferenz seiner europäischen Kunden für Open Source und zeigt sich offen. Wie The Verge am 19. Mai 2025 mitteilte, stellte es kürzlich sein Windows-Subsystem für Linux als Open Source zur Verfügung. Damit können Linux-Tools, also Open-Source-Anwendungen, direkt auf Windows ausgeführt und weiterbearbeitet werden. Aber auch Windows gewinnt. Es zeigt sich offen gegenüber Open Source. Entwicklerinnen und Entwickler fühlen sich bei Windows wie auf ihrem gewohnten Linux.
Zusätzlich zum bereits erwähnten Versprechen, alles zu unternehmen, um eine Abschaltung der Dienste in Europa zu verhindern, machte Microsoft im März 2025 auf seiner Homepage den europäischen Partnern vier weitere Zusicherungen. Die Firma will erstens die Rechenkapazität in Europa in den nächsten zwei Jahren um 40 Prozent erhöhen. Im zweiten und dritten Punkt geht es um Datenschutz und Cybersecurity. Mit dem fünften Punkt verspricht Microsoft Unterstützung für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere durch einen erweiterten Zugang zu seiner KI-Infrastruktur, die kompatibel mit Open-Source-Technologien sei: «We will need to support governments, non-profit organizations, and open-source developers across the continent».
Wie Reuters am 5. Juni 2025 berichtete, bot Microsoft inzwischen den europäischen Regierungen einen kostenlosen, besonders wirksamen, in Europa hochwillkommenen KI-unterstützten Schutz an, der Cyberattacken aus Russland, China, Iran und Nordkorea sicher abwehren könne: «We don’t feel that we have seen AI that has evaded our ability to detect the use of AI or the threats more broadly».
Europa mit eigener Strategie
Europa setzt sich von der businessgetriebenen KI-Entwicklung der USA ab, aber – mit seinem Fokus auf den Menschenrechten – auch von der Open-Source-Strategie in China. DeepSeek und die chinesischen KI-Modelle kommen jedoch nicht als Basismodelle für eigene Entwicklungen in Frage – zu gross seien hier begründete Bedenken. Aber das chinesische DeepSeek hat bewiesen, dass das Wettrennen noch nicht gelaufen ist. Europa könnte eine Open-Source-KI auf höchstem Niveau entwickeln – ohne die enormen Investitionen für proprietäre Modelle. Gleichzeitig will Europa mit seinem verstärkten Einsatz für Open Source auf die Vorteile nicht verzichten, die sich aus einer Zusammenarbeit mit Big Tech ergeben.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.







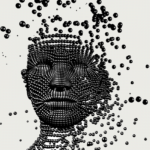


Zum guten Artikel möchte ich ergänzen:
Die Lizenzkosten sind zwar nur ein kleiner Teil der Gesamtkosten von IT, läppern sich jedoch zusammen. Ich habe Belege gesehen, dass die Schweiz 10 Milliarden pro Jahr an die Trump-unterstützende US-Bigtech Konzerne zahlt. Bei freier OSS fällt das weg und allfällige erhöhte Supportkosten bleiben im Land.
Die meisten Schulen in der Schweiz «fixen» die SchülerInnen mit Microsoft Office an, zunächst gratis, jedoch später im Leben fallen jährliche Kosten an, gesamtheitlich Tausende Franken pro Person.
Microsoft und teilweise Apple-Betriebsysteme altern rasch und es muss viel zu schnell neue Hardware gekauft werden. Aktuell läuft Windows 10 im Herbst aus, was ein gigantischer Berg Elektroschrott produziert, da Windows 11 auf alteren Geräten absichtlich nicht läuft.
Bei Linux finden sich auch für sehr alte Hardware aktuelle Betriebssysteme. Diese Systeme sind zudem sehr robust gegen Viren und Co, Erpressungstrojaner und Datenklau.