Versuchter Staatsstreich: Brasiliens Justiz setzt ein Signal

Mit einer langen Haftstrafe sanktioniert Brasiliens Oberster Gerichtshof die Umsturzgelüste des früheren Staatspräsidenten Jair Bolsonaro: 27 Jahre soll der mutmassliche Anführer der Verschwörung absitzen, allenfalls im Hausarrest, eine Möglichkeit, die das Gesetz für älter als 70-jährige Verurteilte in Brasilien vorsieht. Im Putsch-Prozess mitangeklagt waren sieben weitere Beschuldigte – darunter drei Generäle und ein Admiral, die ebenfalls viele Jahre in Haft müssen.
Im grössten Land Lateinamerikas scheint der Justizapparat zu funktionieren – anders als in vielen anderen Staaten des Erdteils, wo Korruption und schleppende Langsamkeit die richterliche Gewalt behindern. Selbst in den USA, wo zwei Jahre zuvor Trump-Anhänger unter ganz ähnlichen Umständen den Sitz des Kongresses stürmten, kommen die Ermittlungsversuche gegen Präsident Donald Trump als mutmasslicher Anstifter dieser gescheiterten Verschwörung nur zögerlich in Gang.
In beiden Fällen versuchte die Umsturzbewegung mit extremer Gewalt, den kurz zuvor durch eine Bevölkerungsmehrheit an den Wahlurnen geäusserten Willen umzustossen. Bolsonaro wollte nicht nur die gesamte Führung der Streitkräfte für sein antidemokratisches Unterfangen gewinnen – was ihm nur im Fall des Oberkommandos der Marine gelang, während Landarmee und Luftwaffe der Verfassung treu blieben. Darüber hinaus zielte er mit seinen Verschwörern darauf ab, Wahlsieger Lula da Silva und den Vorsitzenden des Obersten Gerichts, Alexandre de Moraes, umzubringen. Ein Artikel in der «NZZ» (Bezahlschranke) schildert detailliert,
wie Brasilien knapp an einem Militärputsch vorbeischrammte.
Brasiliens Gesellschaft ist tief gespalten
Dank der Entschlossenheit von vier der fünf zuständigen obersten Richter Brasiliens soll der von langer Hand vorbereitete Putschversuch nicht ungesühnt bleiben. Dennoch ist nicht damit zu rechnen, dass sich die ultrakonservative Bewegung von Jair Mesías Bolsonaro nun in Luft auflösen werde, schreibt Niklas Franzen in der deutschen «taz». Fakt ist: Die brasilianische Gesellschaft ist tief gespalten. Während die einen Bolsonaros Verurteilung als einen Sieg der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit feiern, bezeichnen seine Anhänger das Urteil als politisch motivierte Farce und hoffen auf eine Amnestie Bolsonaros und seiner Komplizen. Allein die Tatsache, dass Lula da Silva die Präsidentschaftswahl 2022 äusserst knapp mit 50,9 Prozent der Wählerstimmen gewann, lässt die Rechten neuen Mut schöpfen. Man putscht sich mit der nie bewiesenen Behauptung auf, bei dem Urnengang im Oktober 2022 sei nicht alles sauber gewesen.
Zur Polarisierung im Land trägt auch US-Präsident Donald Trump bei. Dieser hatte sich wiederholt lobend über Bolsonaro geäussert und den Putsch-Prozess als «Hexenjagd» bezeichnet. Bereits im Juli erhob die US-Regierung Strafzölle von 50 Prozent auf Importe aus Brasilien und verhängte harte Finanzsanktionen gegen Richter Moraes. Bei seinen Druckversuchen stösst Trump mit einem Präsidenten zusammen, der sich der Stärke Brasiliens als Sprachrohr der südlichen Hemisphäre bewusst ist und diese Karte bei den Bestrebungen um eine multipolare Welt – vor allem im Zusammenhang mit der Brics-plus-Bewegung – gerne ausspielt. Damit zieht Lula da Silva den Zorn des US-Präsidenten erst recht auf sich. Dieser sieht die Felle Washingtons im südlichen Teil Amerikas davonschwimmen und den Einfluss Chinas in der Region bedrohlich wachsen, wie das «IPG Journal» bemerkt.
Argentinien: Korruptionsaffäre drückt Mileis Umfragewerte
Die Aufmerksamkeit der Justiz hat auch Argentiniens Staatschef Javier Milei auf sich gezogen. Schon vor einigen Monaten brachte ein Skandal um die Kryptowährung $Libra Milei in Bedrängnis. Dabei verloren Tausende Anlegerinnen und Anleger viel Geld (Infosperber berichtete). Nun ist eine weitere Affäre im innersten Kreis des Präsidenten geplatzt. Dabei geht es um einen krassen Fall von Korruption im Zusammenhang mit Lieferungen von Medikamenten für eine staatliche Invalidenversicherung, wie die auflagenstarke lokale Tageszeitung «Clarín» berichtet. Geleakte Tonaufnahmen legen nahe, dass Mileis Schwester Karina Schmiergeld erhalten habe, und zwar drei Prozent der Summe, die die Behörde für den Kauf von Arzneimitteln bei einer Grossdrogerie ausgebe. Karina Milei ist die rechte Hand ihres Bruders und die Generalsekretärin des Präsidenten.
Dass solche Skandale just in einer Phase von Kongresswahlen publik werden, ist kein Zufall. Schon der vorgezogene Urnengang in der Provinz Buenos Aires, wo rund 40 Prozent der landesweit Stimmberechtigten wohnen, zeigte auf, dass Peinlichkeiten solchen Kalibers Stimmen kosten. Die Beliebtheit des amtierenden «Kettensägepräsidenten» ist laut Umfragen in den vergangenen drei Monaten um rund einen Drittel geschrumpft, während der Peronist Axel Kiciloff als Gouverneur im Amt bestätigt wurde. Eine Orientierung im Dschungel der politischen Machtverhältnisse bietet die ausführliche Analyse in «Nueva Sociedad». Die Parlamentswahlen in den übrigen Landesteilen sollen am letzten Oktobersonntag stattfinden und dürften den angekündigten Trend bestätigen.
El Salvador: Bukele festigt seine Diktatur
Mit derartigen Problemen hat sich der starke Mann im zentralamerikanischen Kleinstaat El Salvador kaum herumzuschlagen. Nahib Bukele pflegt sich über allfällige Bedenken der lokalen Justiz souverän hinwegzusetzen. Schliesslich verfügt er über die Willfährigkeit der allermeisten, sorgfältig selektionierten Staatsanwälte und Richter, und in der 60 Mandate umfassenden Legislative bekennen sich deren 57 als Anhänger des Regimes. Bei solchen Machtverhältnissen gestaltet sich das Herrschen geschmeidig und (angeblich) effizient. Dass die Demokratie dabei auf der Strecke bleibt, macht ein Beitrag in der «taz» deutlich. So wird es denn auch verständlich, dass immer mehr Juristen, Journalisten, Geistliche und andere unbequeme Elemente das Land fluchtartig verlassen.
Wie schwierig das Leben einzelner Kämpferinnen und Kämpfer für mehr Gerechtigkeit im Justizwesen ist, davon zeugt ein Interview von «BBC Mundo» mit dem Präsidenten von Guatemala, Bernardo Arévalo. Im Gegensatz zu El Salvador ist es in diesem Nachbarland das Staatsoberhaupt, das mit seinem sozialdemokratisch orientierten Kurs den Menschenrechten zu mehr Beachtung verhelfen möchte. Ein fast unmögliches Unterfangen: Weite Teile des bürokratischen Apparats verweigern dem demokratisch gewählten Präsidenten schlicht und einfach die Unterstützung und blockieren den Reformprozess wo immer möglich. Arévalo geniesst zwar nach wie vor ein hohes Mass an Beliebtheit – aber eben vor allem bei der armen Mehrheit des 18 Millionen Menschen zählenden Landes.
Dominikanische Republik wirft Migranten aus Haiti aus dem Land
Die Dominikanische Republik gilt seit dem Sturz von Diktator Rafael Trujillo (1961) als demokratisch regierter Staat – und zudem mehrheitlich sozialdemokratisch ausgerichtet. Über Jahrzehnte lösten sich gewählte Regierungen an den Hebeln der Macht ab. Ausser den karibischen Traumstränden schien es nichts Bemerkenswertes zu geben im Inselstaat – wären da nicht die Tausenden von Migranten aus dem bettelarmen Nachbarland Haiti. Solange diese als Erntearbeiter in der Tropenhitze schufteten und sich als anspruchslose Hausangestellte still hielten, schien alles in Ordnung. Doch der überforderten lokalen Bürokratie wurde es plötzlich zu viel, und der frisch gewählte Staatschef Luis Abinader fand: Es reicht! Seit Anfang 2025 wurden laut amtlichen Schätzungen rund 250‘000 Haitianer und Haitianerinnen in ihr Ursprungsland abgeschoben, unter ihnen zahllose Frauen mit Kindern und Neugeborenen. Laut einem Bericht der «Deutschen Welle» gab es anstatt gerichtlicher Abklärungen für sie nur den sofortigen Abtransport auf überfüllten Vehikeln – meistens von einem Tag auf den andern.
Peru: Amnestie für Kriegsverbrecher
Tabula rasa schliesslich auch in Peru. Dort unterzeichnete Staatspräsidentin Dina Boluarte ein Amnestiegesetz, das alle von Militär, Polizei und rechten Paramilitärs begangenen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen während der bewaffneten Konflikte zwischen 1980 und 2000 straffrei stellt. Damit sei «der Albtraum peruanischer Menschenrechtsorganisationen wahr geworden», heisst es in der deutschen «taz». Nach Ansicht nationaler und internationaler Menschenrechtsorganisationen hätte eine Versöhnung, wie es einst in Südafrika unter Nelson Mandela geschah, erst nach Aufklärung der Tatbestände erfolgen dürfen.
___________________________________________________________________________
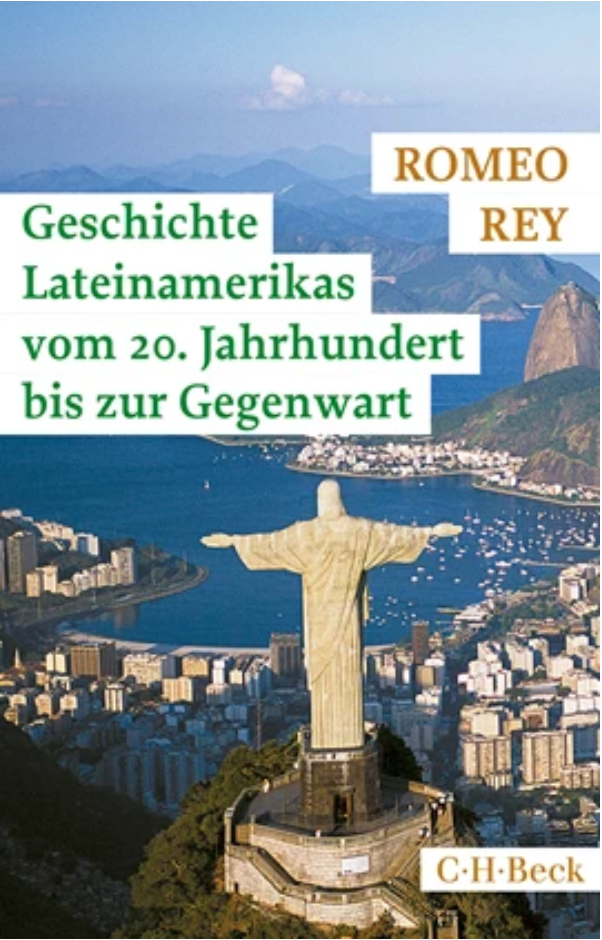
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine. Der Autor war 33 Jahre lang Korrespondent in Südamerika, unter anderem für den «Tages-Anzeiger» und die «Frankfurter Rundschau».
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.










Wenn sich ein bekanntermassen politisches, nämlich linkes Gericht so gegen einen konservativen Politiker stellt, so hat das m.E. mit Demokratie nichts, aber auch gar nichts zu tun!
Die vorliegende Interpretation der Umstände entlarvt m.E. einzig die politische Gesinnung des Verfassers des Artikels. Mit sachlichem Journalismus hat dies nicht viel zu tun.
Ich gratuliere Ihnen
Sie haben SRF Niveau erreicht!
Bin sprachlos
Wenn Gerichte sich der linksorientierten Regierung anpassen, ist das keineswegs ein objektives Urteil, sondern eindeutig politisch motiviert. Bitte etwas genauer recherchieren, sonst kann man sich solche Beiträge sparen.