Kommentar
Der harte Franken und das ausgetrunkene Meer
TA-Chefredaktor Res Strehle blickt durch, bevor er genau hingeguckt hat: «Und Währungsabsicherungen sind der Versuch, einen See auszutrinken», schreibt er in seinem jüngsten Leitartikel. Das ist insofern originell, als alle andern, die dieses Bild benutzt haben, ein Meer statt bloss einen See nicht ausgetrunken haben.
Gemeint sind die 1100 Milliarden Euro, die der EZB-Präsident in den nächsten anderthalb Jahren auf dem Markt werfen wird. Kann unsere Nationalbank notfalls dieses «Meer» aufkaufen?! Sicher nicht, da erübrigt sich – hat Strehle wohl überlegt – jede weitere Überlegung. Also war es gut, dass die SNB erst gar nicht ernsthaft mit Trinken angefangen hat.
Am selben Samstag war Hansueli Schöchli von der NZZ nicht ganz so denkfaul und hat einen Blick auf den Grund dieses Meeres gewagt: Was, wenn die SNB tatsächlich für 3000 Milliarden Devisen aufgekauft hätte? Stimmt die Überlegung der Jordan-Kritiker, dass «die SNB die Devisen ja mit praktisch ‹gratis› gedruckten Franken kaufen würde, so dass selbst bei sinkendem Euro-Kurs keine ‹richtigen› Verluste entstünden»? Und, so spielt Schöchli die Rolle des Advocatus Diaboli weiter, hätte die SNB nicht noch über zusätzliche Mittel, wie noch höhere Mindestzinsen oder gar Kapitalverkehrskontrollen verfügt? Und hätte sie so nicht Buchverluste von 200 oder gar 1000 Milliarden Franken erleiden können, ohne ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren?
All das gesteht Schöchli den Kritikern von Thomas Jordan zu, doch dann blickt er noch tiefer auf den Grund des Strehle-Sees und findet dort folgendes Totschlagargument: «Doch irgendwann würde die SNB den Grossteil des Devisenbergs verkaufen wollen – dann werden aus Buchverlusten realisierte Verluste.» Etwas weiter im Text finden wir auch die Antwort auf die Frage, wenn denn «irgendwann» eintritt: «Irgendwann würde die SNB die Frankenliquidität wieder eindämmen wollen, um einen Inflationsschub zu vermeiden – dann müssten die Franken so ‹gratis› verschwinden, wie sie gekommen wären.»
Gemäss Schöchli wird also die SNB erstens ihre Devisenberge dann verkaufen müssen, wenn ein Inflationsschub droht, und zweitens würde sie dann mit Verlust verkaufen müssen. Dazu kommt noch eine unausgesprochene dritte Annahme, nämlich, dass diese Verluste die Gewinne übersteigen, welche die SNB zwischen heute und irgendwann erzielen wird. Gehen wir also noch tiefer auf den Meeresgrund und schauen, ob diese Voraussetzungen zutreffen.
Zunächst: Warum und unter welchen Umständen würden die Devisenberge zu Inflation führen? Nun, das Gegenstück zu den Devisenbergen der Nationalbank sind die kurzfristigen Guthaben (Kontokorrentkredite) der Spekulanten gegenüber der SNB. Solange diese weiterhin auf eine Aufwertung des Franken hoffen, bleiben sie bei der SNB liegen und bewirken nichts.
Inflation droht erst, wenn die Spekulanten nervös werden und anfangen, mit ihren Franken Schweizer Dienstleistungen, Güter oder Immobilien zu kaufen und so deren Preise hoch zu treiben. Doch Inflation bedeutet auch immer eine reale Entwertung des Frankens und wenn die Inflation in der Schweiz höher ist als im Ausland, dann sinkt der Wert des Frankens auch im Vergleich mit den übrigen Währungen. Folglich werten sich die Devisenberge der Nationalbank im Falle von Inflation auf und nicht ab. Sehr zu Freude der Nationalbank.
Und wenn die Inflation im Ausland noch grösser ist als in der Schweiz? Nun, dann wäre eben noch nicht das von Schöchli befürchtete «irgendwann». Die Nationalbank hat erst dann Grund, die Inflation zu bekämpfen, wenn diese höher ausfällt als bei den Handelspartnern, wodurch die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Produkte beeinträchtigt würde. Doch je länger «irgendwann» auf sich warten lässt, desto grösser sind die Profite der SNB bzw. der Schweiz.
Rechnen wir: Die SNB kassiert auf ihren Schulden einen Strafzins von 0,75 und ihre Guthaben konnte sie 2014 mit rund 2 Prozent verzinsen. Macht eine Totalrendite von 2,75 Prozent. Bei den von Schöchli angenommenen 3000 Milliarden sind dies jährlich 82,5 Milliarden Franken Zinsertrag. Wenn irgendwann zehn Jahre auf sich warten lässt, sind wir bei 825 Milliarden angelangt. Selbst wenn die SNB dann den Mindestkurs des Euro abrupt auf 1 Franken senken würde, hätten wir netto immer noch mehr als 300 Milliarden Franken verdient.
Spätestens an dieser Stelle gebietet es das Mitgefühl, nicht nur immer an uns, sondern auch einmal an die armen Spekulanten zu denken. Sie würden nämlich genau diese Summen verlieren, wenn sie es tatsächlich wagen sollten, Devisen im Wert 3000 Milliarden auf eine Aufwertung des Frankens zu setzen. Doch so dumm sind sie kaum. Sie hätten wohl spätestens bei 600 Milliarden die Nerven verloren. Und wenn nicht? Bitte sehr, her mit den geschenkten Milliarden!
So, jetzt haben wir den Strehle-See und das Schöchli-Meer ausgetrunken und stellen ernüchtert fest, dass es sich um einen sehr seichten Tümpel gehandelt hat.
—
PS. Ein Mindestkurs, der uns chronische Leistungsbilanzüberschüsse von 60 Milliarden und mehr beschert, mit denen wir eh nichts schlaues anzufangen wissen, ist nicht das Gelbe vom Ei. Ein Mindestkurs von 1,15 wäre für die Schweizer Konsumenten besser und für unsere Firmen und Produzenten noch tragbar. Und die SNB könnte diesen Kurs erst recht problemlos halten.
—
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine






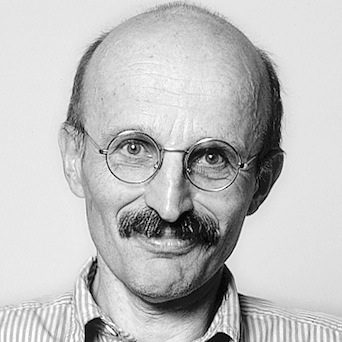





Die SNB hat immer wieder betont, der CHF sei stark ueberbewertet, nun kam sie in Zugzwang weil sie das Meer von Euros fuerchtete, gleich wie die US Notenbank die Aufblaehung ihrer Bilanzsumme!
Die Schweiz hat ein Problem, die Wirtschaft ist stark und das Land ist noch sicher, darum ist der CHF begehrt. Wer dies nicht will und Leistungsbilanzueberschuesse nicht zu schaetzen vermag, muss in die EU….! Dann ist der CHF keine Waehrung mehr! Dies ist wohl nicht der Konsens des Souveraens!
Auch wenn manche das vielleicht gerne sehen würden: Die SNB ist gemäss Verfassung und Gesetzen nicht für Wirtschaftspolitik zuständig, sondern primär für Preisstabilität. (http://www.snb.ch/de/iabout/snb/id/snb_tasks).
2011 wertete der CHF gegenüber allen Weltwährungen rasant und massiv auf. Die SNB intervenierte und argumentierte (indirekt) mit der Preisstabilität. Die ausländischen Zentralbanken akzeptierten diesen Schritt, obschon es eigentlich unfein ist, wenn ein Land mit Ertragsbilanzüberschuss die Währung abwertet bzw. künstlich tief hält (Beispiel China).
Thomas Jordan zeigte aber schon damals schlüssig, dass der Handelsbilanzsaldo nur wenig zum Schweizer Ertragsbilanzüberschuss beiträgt. Die wichtigen Faktoren sind vielmehr Auslandsvermögensgewinne, internationale Finanzdienstleistungen, und der Rohstoffhandel. Und diese sind allesamt unabhängig vom Schweizer Franken. Jordan: «Die drei für den Ertragsbilanzüberschuss wichtigsten Grössen hängen ab von der Entwicklung im Ausland, von den internationalen Finanzmärkten und von der weltweiten Rohstoffnachfrage. Der Wechselkurs des Frankens spielt dagegen keine bestimmende Rolle.» (http://www.snb.ch/de/mmr/speeches/id/ref_20130219_tjn)
Heute ist die Situation eine andere: Der CHF wertete wegen der EUR-Kopplung zuletzt ab (!) ggü. USD, GBP und sogar JPY. Allein schon deswegen wäre eine weitere Intervention der SNB unmöglich zu rechtfertigen.
2/2 Dass die SNB zudem wenig Lust verspürt, zum Hauptgläubiger von Marios Euro-Party zu werden – auch wenn sie dies rein technisch könnte – ist nachvollziehbar. Nicht nur sind Eurobestände auf absehbare Zeit mit realen Risiken verbunden. Die SNB-Franken würden ja grösstenteils wieder zurück in die Schweiz schwemmen und hier insb. den Obligationen-, Aktien- und Immobilienmarkt weiter verzerren, während die SNB aufgrund der negativen Zinsen kaum noch Steuermöglichkeiten hat bzw. die Nebenwirkungen immer wie grösser werden (in Dänemark gibt’s bereits negative Hypothekarzinsen). Schliesslich sähen sich die Kantone noch mit dem Ausfall der SNB-Ausschüttungen konfrontiert.
Der Schweizer Handelsbilanzüberschuss (im Q3/2014 7.7 Mrd CHF) wirkt in dieser Situation ja eher als Puffer gegen übermässigen Lohndruck. Letztlich wird dieser Ueberschuss ja auch in Steuereinnahmen und den interkantonalen Finanzausgleich umgemünzt und trägt damit zu Stabilität und Wohlergehen der ganzen Schweiz bei.
Eine neue Untergrenze, etwa bei 1.15, liesse sich auch aus Sicht der Preisstabilität rechtfertigen. Angesicht einer Inflationsrate, die schon vor der Aufwertung unter Null lag, drängt sich das sogar geradezu auf. In erster LInie geht es aber darum, vermeidbaren massiven Schaden von der Schweiz abzuwenden. Dazu darf man auch mal die Verfassung flexibel auslegen, bzw. den aktuellen Umständen anpassen.
In seiner Rede ging es Jordan damals nicht darum, einen Sachverhalt neutral darzulegen. Vielmehr hat er im Sinne eines Verteidigers alle Argumente zusammengekratz, die für den Angeklagten sprechen. Wahrscheinlich geben die publizierten Leistungsbilanzüberschüsse tatsächlich ein übertriebenes Bild. Aktuell geht es jedoch um die Frage, ob ein viel zu harter Franken Jobs kostet und sogar ganze Industrien definitiv vernichtet, die bei einem Kurs, den die SNB nicht für massiv überbewertet erachtet – also z.B. bei 1.15 – überlebensfähig wären. Siehe dazu unter anderem das Interview von Prof. Aymoz Brunetti in der NZZ.
Das mit dem «viel zu harten Franken» müsste man doch auch mal kritisch hinterfragen.
Ueber die letzten Jahrzehnte betrachtet war der CHF gegenüber den europäischen Währungen ja noch nie so schwach wie heute. Vor Einführung des EUR war die DEM die stärkste Währung auf dem Kontinent, und die lag irgendwo bei 0.8 zum CHF! Die Niederländer wechselten ihre NLG zu 0.5, die Italiener lagen mit ihrer ITL zuletzt bei 0.0006. Heute kaufen die bei uns selbst nach der kürzlichen Aufwertung alle für 1.05 ein. Kein Wunder erzielte die Schweiz zuletzt Rekordüberschüsse in der Handelsbilanz. Währenddessen liegt das GBP weiterhin bei 1.41 zum CHF und bei 1.34 zum EUR, aber deswegen gibt’s keine Nervosität auf den Inseln. Klar, auch Kaufkraftparitäten und Inflationsraten sind zu berücksichtigen, aber das Schlagwort «überbewerteter Franken» scheint mir doch zu kurz zu greifen.
Für den Tourismus, der ausser Eurogästen nichts importiert (anders als die Industrie), könnte der Franken vielleicht bevorzugt auf türkischem Niveau liegen, doch selbst hier darf nicht vergessen werden, dass unsere Gäste nach CH und DE auf dem dritten Platz aus den USA kommen, und nach FR auf dem fünften Platz aus UK. Und gegenüber dem USD liegt der CHF derzeit etwa gleich wie 2011.